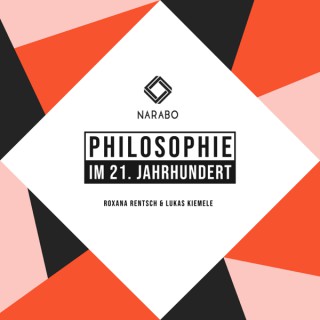Podcasts about philosophischen fakult
- 27PODCASTS
- 62EPISODES
- 33mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 17, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about philosophischen fakult
Latest podcast episodes about philosophischen fakult
„Mit dem Sammeln beginnen sofort Tätigkeiten des Klassifizierens, Sortierens und Einteilens“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Struck. Wir sammeln Dinge, sie werden aufgehoben, geordnet und archiviert. Doch Sammeln ist keine neutrale Praxis. Es entscheidet darüber, was erinnert und aufbewahrt werden soll – und was verschwindet. Es ist eine Kulturtechnik, die auf Auswahlprozessen beruht, Machtverhältnisse impliziert und Ausschlüsse generiert, mit der Wissen entsteht und Geschichte erzählt wird. Doch was passiert, wenn Sammlungen zu groß werden – in Museen, Archiven, aber auch in der eigenen Forschung? „Museen sind verpflichtet, alle einmal aufgenommenen Sammlungsgegenstände für alle Zeiten zu bewahren – das ist eine Wahnsinnsforderung“, sagt Wolfgang Struck. Ob kommende Generationen unser Bewahrenswertes noch immer für so bewahrenswert finden werden, stellt er in dieser Folge in Frage und weist daraufhin, dass Museen sich dringend der Tatsache stellen müssen, „dass sie selber Teil eines Prozesses sind, Neuverhandlungen darüber zu führen, was relevant ist und was nicht.“ Überhaupt ließen sich doch gerade erst im Loslassen neue Perspektiven eröffnen. „In dem Moment, in dem ich aussortiere, entsteht eine Sammlung“, sagt Dr. Jana Mangold. Neben klassischen und neueren Sammlungstheorien geht Jana Mangold in dieser Folge auch auf gegenwärtige Debatten um Deaccession, also das Entsammeln in der Museumspraxis, ein – auch im Kontext kolonialer Fragen: „Objekte aus Unrechtskontexten können nicht einfach Eigentum von Kolonialmächten sein.“ Sammeln und Entsammeln versteht Mangold nicht als gegensätzliche Handlungen, sondern als miteinander verschränkte Prozesse. Zusammen mit Wolfgang Struck spricht sie sich aus für das geordnete Chaos, aber auch das bewusste Begrenzen, Reduzieren und Loslassen von Material als einer zentralen Voraussetzung wissenschaftlicher Erkenntnis – und verrät, weshalb sich das notwendige Gespür für Relevanz weder formal noch algorithmisch ersetzen lässt. Dass der Wert einer großen und bislang kaum erschlossenen Sammlung erheblich gesteigert werden kann, berichtet Nadine Fechner. In dem semesterübergreifenden Seminar „Die kleine Freiheit“ konnten durch sie erschlossene Fotos, die öffentliche Feste in Gotha zu DDR-Zeiten zeigen, mit den persönlichen Erinnerungen durch Gothaer Bürger*innen verbunden werden. Damit hätten „die Studierenden die Lücke zwischen dem, was offiziell überliefert wurde und dem, was individuell erinnert wird, analysiert und damit Geschichte als etwas Dynamisches erfahren“, erklärt Fechner und ergänzt, dass „das Archiv so wieder zu einem partizipativen Ort des Forschens und Erinnerns wurde.“ Geschichte, haben die Studierenden gelernt, sei „kein abgeschlossenes und feststehendes Narrativ“, die Studierenden hätten vielmehr verstanden, dass die Realität in der DDR aus Grauzonen bestand und „so auch im Kontrast zu den großen Staatsnarrativen stehen, wie hier der offiziellen Geschichte der DDR.“ Prof. Dr. Wolfgang Struck ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt. Sein Interesse gilt den vielfältigen Überlagerungen von Literatur, Wissen und Wissenschaft. Dr. Jana Mangold ist wissenschaftliche Koordinatorin der Forschungsgruppe „Kulturtechniken des Sammelns“. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Materialität und Formaten der Popkultur, in Gebrauchsweisen reproduzierter Abbildungen und Formen des Archivs. Nadine Fechner ist Projektmitarbeiterin im Kooperationsprojekt „Kulturtechniken des Sammelns“ mit der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha. Sie forscht zu Stadtdarstellungen in Malerei, Grafik und Fotografie. Forschungsprojekt „Kulturtechniken des Sammelns“: https://www.uni-erfurt.de/philosophische-fakultaet/forschung/netzwerke/kulturtechniken-des-sammelns Lesetipp: Ursula Le Guin „The Carrier Bag Theory of Fiction“, 2019 Alle Podcastfolgen auch unter: https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/wissenschaftspodcast-wortmelder
Nachrichten, Tagesthema. (19.9.2024 15:30)
Die Slowakei hautnah, Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache
Nachrichten, Tagesthema, Magazin - Theateraufführung von Studierenden der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in deutscher Sprache im Österreichischen Kulturforum Bratislava - ein Sissi-Musical. Und wir stellen ein 2023 erschienene Buch von František Hýbl vor, das an ein unvorstellbar grausames Massaker nach dem Kriegsende1945 erinnert: "Was geschah am 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen bei Prerau?".
Pro-Palästina Demonstranten besetzen das Unitobler Gebäude der Universität Bern. Die Forderung: ein akademischer Boykott Israels. Grund genug, sich vor Ort ein Bild zu machen. Zwischen Kafichränzli und antisemitischen Parolen finden sich die Journalistinnen wieder und werden nicht nur mit offenen Armen empfangen. Ein Interview wird nach Zusage wegen «Kapazitätsproblemen» wieder abgesagt. Eine besondere Situation auch für Maria-Rahel, die selbst an der Philosophischen Fakultät studiert und daher regelmässig Vorlesungen in diesem Gebäude hat. Genau dieses Gebäude ist nun besetzt, von genau den Leuten, mit denen sie teilweise den Hörsaal teilt.
Aus Prag kommen in diesen Tagen schreckliche Nachrichten von Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität direkt an der Moldau, von vielen Toten und Verletzten. Das soll nicht vergessen werden, wenn wir hier - trotz allem - über den Zauber von Prag sprechen. Über das besondere Licht dieser Stadt. Über magische Begegnungen beim Bier. Über Kneipen, in denen man sich auch in der Heiligen Nacht verlieren kann. Über all das hat der tschechische Autor Jaroslav Rudis ein hübsches Buch geschrieben mit dem schlichten Titel „Weihnachten in Prag“ (Luchterhand) - eine heiter-melancholische Geschichte, wunderschön illustriert von Jaromir Svejdik. Christoph Scheffer spricht mit Jaroslav Rudis über seine Prager Weihnachtsgeschichte. (Foto: Vojtech Veskrna)
Schießerei an der Philosophischen Fakultät in Prag: Informationen und Augenzeugenberichte, Archäologischer Fund in Südmähren lässt vergangenen Schlangenkult vermuten
Schießerei an der Philosophischen Fakultät in Prag: Informationen und Augenzeugenberichte, Archäologischer Fund in Südmähren lässt vergangenen Schlangenkult vermuten
#84 Die Serienmörderin Gesche Gottfried - 1831 war mehr Mäusebutter
In dieser Folge widmen sich Nina und Katharina einem Fall, der sich besonders oft gewünscht wurde. Die Rede ist von einer der ersten uns bekannten deutschen Serienmörderin: Gesche Gottfried. Von 1813 bis zu ihrer Verhaftung 1828 ermordete sie mittels Gift fünfzehn Menschen und verabreichte mindestens neunzehn weiteren Personen Gift, ohne diese jedoch damit zu töten. Zu ihren Opfern zählen ausschließlich Menschen aus ihrem Umfeld: Bekannte, Familienmitglieder, ihre Partner, Eltern und Kinder. Auf welcher Basis sie ihre Opfer auswählte, bleibt jedoch ebenso rätselhaft. // Quellen & Shownotes // - Dertinger, M., Mutter, Gattin, Mörderin - Eine Untersuchung zu Weiblichkeit und weiblicher Kriminalität in Recht und Literatur, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg, Heidelberg 2018. - Meter, P., Gesche Gottfried. Eine Bremer Tragödie, Bremen 2010. - Seling-Biehusen, P. & Feest, J., Gesche Gottfried und die bremische Strafjustiz. Aktenauszüge mit Anmerkungen, in: Criminalia. Bremer Strafjustiz 1810 - 1850, hg. v. Johannes Feest, Bremen 1988, S. 151–194. - Voget, F. L., Lebensgeschichte der Giftmörderin Gesche Margarethe Gottfried, geborene Timm. Nach erfolgtem Straferkenntnisse höchster Instanz herausgegeben vom Defensor derselben, Bremen 1831. //Tickets und weitere Infos zur Lesung am 08.12.2023 in Gelnhausen gibt's hier// buecherei@gelnhausen.de oder telefonisch unter 06051/830250 // Folgt uns auf Instagram // https://www.instagram.com/frueher.war.mehr.verbrechen/?hl=de // Karte mit allen „Früher war mehr Verbrechen“-Tatorten // https://bit.ly/2FFyWF6 // Mail //: https://linktr.ee/fwmv // Kaffeekasse //: https://ko-fi.com/fwmvpodcast GEMAfreie Musik von https://audiohub.de
Politik und Wahrheit - Wissenschaft als Mittel gegen eine 'postfaktische' Welt?
ein Vortrag des Philosophen Frieder VogelmannModeration: Katrin Ohlendorf ********** Wir leben in einem "postfaktischen" Zeitalter, heißt es oft. Stimmt das? Nein, sagt der Philosoph Frieder Vogelmann und warnt vor dieser falschen Diagnose, die das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft fördern könnte. Warum, erklärt er in seinem Vortrag. Frieder Vogelmann ist Professor für Epistemology & Theory of Science am University College Freiburg und der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Unter anderem arbeitet er zur Beziehung zwischen (Un)Wahrheit und Demokratie und zum Bild wissenschaftlicher Praktiken. Seinen Vortrag "Wissenschaft als Mittel gegen das 'postfaktische Zeitalter'?" hat er am 25. Mai 2023 im Rahmen der Vortragsreihe "Colloqium Fundamentale" des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gehalten, das zu diesem Zeitpunkt, im Sommersemester 2023, unter dem Titel "Was ist Wahrheit? Annäherung an ein umstrittenes Konzept" stand. ********** Schlagworte: +++ Politik +++ Wissenschaft +++ Forschung +++ Medien +++ Soziale Medien +++ Social Media +++ Gesellschaft +++ Demokratie +++ Diskurs +++ Debatte +++ postfaktisch +++ postfaktisches Zeitalter +++ Postfaktizität +++ Fake News +++ Fakenews +++ Polarisierung +++ Rechtspopulismus +++ Wahrheit +++ Erkenntnistheorie +++ Epistemologie +++ Wissenschaftstheorie +++ Wissenschaftskommunikation +++**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Vertrauen, Schuld und Lüge: Bessere Wissenschaftskommunikation in KrisenzeitenSoziale Medien: Mitte der Gesellschaft weniger fragmentiertWissenschaft und Politik: Die Macht des Wissens als Gefahr für die Demokratie**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
«Meine Lehrmeister waren die Biobauern und Biobäuerinnen!»In dieser Jubiläumsfolge zum 50-jährigen Bestehen des Forschungsinstituts für biologische Landwirtschaft FiBL erzählt unser dienstältester, noch aktive Mitarbeiter, Otto Schmid, von seinen 47 Jahren am FiBL. Er beschreibt, weshalb die Verwendung des Wortes «Bio» für Lebensmittel zunächst nicht zugelassen wurde und die Direktoren der Forschungsanstalten den FiBL Forschenden verboten hatten in ihren Publikationsorgangen zu veröffentlichen. Die Schweizer Biobewegung hat Otto einiges zu verdanken. Er hat den Bioberatungsdienst am FiBL aufgebaut und an der Entwicklung der Schweizer und internationalen Biorichtlinien mitgearbeitet. Wieso Otto im Dezember 1989 sogar ins Büro des Chefs des Bundesamtes für Landwirtschaft einmarschiert ist, ist in dieser Folge zu hören. Weitere Informationen:50 Jahre FiBL auf fibl.org Rachel Carson (2021): Der Stumme Frühling, Übersetzung: Margaret Auer, Nachdruck, C.H.Beck, München, ISBN: 978-3-406-73177-8 Ursina Eichenberger (2012): «Ökologie und Selbstbestimmung», Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät der Universität ZürichSilvia Henggeler, Otto Schmid (2012): Biologischer Pflanzenschutz im Garten, Neuauflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN-10: 3800176319 Dennis Meadows, Donella Meadows, Erich Zahn, Peter Milling (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Übersetzung: Hans-Dieter Heck Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, ISBN: 3-499-16825-1FiBLFilm: Zwischen Zorn und Zärtlichkeit – Die Geschichte des Biolandbaus in der Schweiz (2012)Gast: Otto SchmidModeration und Redaktion: Sophie Thanner, FiBLAn- und Abmoderation: Anke Beermann, FiBLE-Mailpodcast@fibl.orgInstagram@fibl_focusWebsitewww.fibl.orgFiBL Focus ist der Podcastkanal des FiBL Schweiz, einem der weltweit grössten Forschungsinstitute für biologischen Landbau.
Astrid Riehl-Emde - Wie das Glied einer unzerreissbaren Kette–Blick ins Genogramm
Astrid Riehl-Emde eröffnet ihren 1995 bei den Lindauer Psychotherapiewochen gehaltenen Vortrag mit einer Passage aus dem Erfolgsroman "Das Geisterhaus" von Isabel Allende. Kein Zufall, dient ihr diese Familiengeschichte doch als Leitfaden für eine großartige Hinführung zur Bedeutung der persönlichen und therapeutischen Beschäftigung mit Familiengeschichten und deren teils sehr mächtigen Wirkspiel in menschlichen Biographien, sowie zur Arbeit mit Genogrammen. Beides eröffnet Möglichkeiten, achtungsvoll Delegationen und Verstrickungen zu erkennen, zu lösen und neue, autonomere Lebensmöglichkeiten zu finden. Der Schlussapplaus eines gebannt zuhörenden Publikums dokumentiert, wie beeindruckt die Zuhörenden waren, die diesen von der Autobahnuniversität glücklicherweise dokumentierten Vortrag in Präsenz mitverfolgen konnten. Die Aufnahme lässt dies in nahezu gleicher Weise erfahren. Prof. Dr. Astrid Riehl-Emde ist seit 2009 Titularprofessorin an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Ihr beeindruckender beruflicher Werdegang führte sie seit 1976 über verschiedene Stationen, u.a. in Forschung und Lehre in ambulanter und stationärer Psychotherapie, Hochschulassistenz, Oberassistenz in Zürich, in die stellvertretende Leitung des Instituts für Kooperationsforschung und Familientherapie am Universitätsklinikum Heidelberg und danach des Instituts für Psychosoziale Prävention am Zentrum für Psychosoziale Medizin ebendort. Seit 2018 ist sie in Heidelberg bei der Spezialambulanz für ältere Paare am Institut für medizinische Psychologie (Prof. Dr. Beate Ditzen) tätig. Prof. Riehl-Emde ist u. a. Mitglied des Editorial Board der Zeitschrift Familiendynamik, Geschäftsführende Herausgeberin der Zeitschrift Psychotherapie im Alter und im Vorstand der Vereinigung für psychotherapeutische Fort- und Weiterbildung, dem Trägerverien der Lindauer Psychotherapiewochen. Beim Mund-Nasen-Schutz bleiben die Ohren frei! Also: Ob im Auto oder mit der oder ohne die Maske in der großen weiten Welt: Kopfhörer auf und Autobahnuniversität hören! Und Carl-Auer Sounds of Science, Heidelberger Systemische Interviews, "Sich sicher sein", Formen (reloaded) oder den Wahrnehmungspdcast "Frauen führen besser". Jeder Stau bringt Sie weiter. Wo es geht, die freien Augen und den freien Geist nutzen: Carl-Auer Bücher lesen, Carl-Auer Wissen nutzen! Alle Folgen der "Autobahnuniversität" finden Sie auch hier: www.carl-auer.de/magazin/autobahnuniversitat Die anderen Podcasts des Carl-Auer Verlags finden Sie hier: Heidelberger Systemische Interviews www.carl-auer.de/magazin/heidelbe…ische-interviews Sounds of Science www.carl-auer.de/magazin/sounds-of-science sich-sicher-sein www.carl-auer.de/magazin/sich-sicher-sein
Jessica Marx: Wohin soll die Reise gehen? Orientierungshilfe zwischen Unileben und Arbeitswelt
Jessica Marx ist Alumna der Universität zu Köln und heute Leiterin des CareerService der Philosophischen Fakultät. Sie unterstützt Studierende der Geistes- und Kulturwissenschaften mit vielfältigen Angeboten bei Berufseinstieg, Bewerbungsprozess und individueller Profilbildung.
Philosoph Henrik Jäger über chinesische Philosophie #24
Henrik Jäger hat in Freiburg, Taipeh und München Sinologie, Philosophie und Japanologie studiert und lehrt derzeit an der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Bereich chinesischer Philosophie. In dieser Episode des Narabo-Podcasts geht es um interkulturelle Philosophie am Beispiel der chinesischen Philosophie. Der Schwerpunkt liegt auf Fragen der Didaktik, also wie wir Philosophie aus anderen Kulturen verstehen und lernen können. Darüber hinaus werden Aspekte des Kolonialismus in der Rezeption chinesischer Philosophie durch europäische Philosophie thematisiert.
Peter Haerlin - Spiritualität und Psychotherapie
In einer Art Kindersprache, wie Peter Haerlin zu Beginn dieses Vortrags aus den 1990er Jahren bei den Lindauer Psychotherapiewochen sagt, könne Spiritualität oder das, worum es dabei geht, in zwei Sätzen zu je drei Worten gesagt sein: "Alles ist gut". - "Alles ist eins." Weitere Definitionen seien durch Methoden, Riten o.ä. nicht zu erlangen. Und auch Wirkzusammenhänge von Handeln bzw. Tun oder auch Substanzialität in der Welt zu als spirituell erlebter Erfahrung seien nicht, wie sie zuweilen zu sein scheinen oder vorschnell erklärt werden. Es sind nicht die Substanzen selbst, oder das Beten, die retten oder Bewusstsein anders machen, sondern das, was darum ist und die menschliche Begleitung. Spiritualität sei der ganz persönliche Sprung in das Tragende Ganze – von welchem inneren Ort aus auch immer – geschehend in der Leere. Von dort her entwickelt Haerlin seine Überlegungen zum Verhältnis und zu möglichen gegenseitigen Einflüssen von Spiritualität bzw. spiritueller Praxis und Psychotherapie als Gesundungsweg, der von Menschen miteinander begangen wird. Es gebe eigentlich nur einen bedeutenden Gegensatz zwischen Psychotherapie und spiritueller Praxis. Dieser betreffe unbegrenzte (Spiritualität) und begrenzte (Psychotherapie) Zielhorizonte. Und genau damit werde es für beide spannend miteinander. Dr. Peter Haerlin (1940 - 2018) war Philosoph und Psychoanalytiker, von 1990 - 2008 Lehrbeauftragter und Privatdozent an der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit 1993 Lehranalytiker und Supervisor der Süddeutschen Akademie für Psychotherapie. Seit 1977 arbeitete er als Psychotherapeut in freier Praxis. Sein besonderes Interesse galt stets dem besonderen Verhältnis und Zusammenspiel psychologischer und spiritueller Ressourcen für Therapie und Heilung sowie nichtsprachlichen und sprachlichen Methoden zu Bewusstseinsveränderungen, in Gruppen oder bei und mit Einzelnen. Beim Mund-Nasen-Schutz bleiben die Ohren frei! Also: Ob im Auto oder mit der Maske in der großen weiten Welt: Kopfhörer auf und Autobahnuniversität hören! Und Carl-Auer Sounds of Science, Heidelberger Systemische Interviews und "Sich sicher sein". Jeder Stau bringt Sie weiter. Wo es geht, die freien Augen und den freien Geist nutzen: Carl-Auer Bücher lesen, Carl-Auer Wissen nutzen! Alle Folgen der "Autobahnuniversität" finden Sie auch hier: www.carl-auer.de/magazin/autobahnuniversitat Die anderen Podcasts des Carl-Auer Verlags finden Sie hier: Heidelberger Systemische Interviews www.carl-auer.de/magazin/heidelberger-systemische-interviews Sounds of Science www.carl-auer.de/magazin/sounds-of-science sich-sicher-sein www.carl-auer.de/magazin/sich-sicher-sein
Die Renaissance war eine Revolution, die erst Europa und dann die ganze Welt für immer veränderte. In seinem grandios erzählten Buch entfaltet der Historiker Bernd Roeck ein beeindruckendes Panorama dieser glanzvollen Zeit mit ihren vielfältigen Schauplätzen: von der Politik über die Religion bis zu den Künsten und der Philosophie. Zugleich erklärt er im Horizont der Globalgeschichte, wieso es ausgerechnet in Europa zu dieser einzigartigen Verdichtung von weltbewegenden Ideen und historischen Umwälzungen, von spektakulären Entdeckungen und künstlerischen Meisterleistungen kommen konnte. Bernd Roeck, geboren 1953 in Augsburg/Deutschland, promovierte 1979 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine Habilitation folgte 1987. Von 1986 bis 1990 war er Direktor des Deutschen Studienzentrums in Venedig, Italien, dann, 1990, außerordentlicher Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Augsburg. Von 1991 bis 1999 hatte er den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Bonn inne. Darüber hinaus war er von 1996 bis 1999 gewählter Generalsekretär des Deutsch-Italienischen Zentrums Villa Vigoni (Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz) in Loveno di Menaggio am Comer See. Im Jahr 1999 wurde er auf den Lehrstuhl für Allgemeine und Schweizerische Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich/Schweiz berufen. Von 2009 bis 2011 war er Dekan der Philosophischen Fakultät. Im Jahr 2019 wurde Roeck emeritiert
Philosoph Frieder Vogelmann über politische Epistemologie und Verantwortung #23
Frieder Vogelmann ist Professor für Epistemology & Theory of Science am University College Freiburg und der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der politischen Epistemologie, der Kritischen Theorie und der Philosophie Michel Foucaults.
Marie Krappmann: Deutsch öffnet die Tür hinter den Kulissen #Germanistspricht
Mgr. Marie Krappmann, Ph.D. ist Absolventin der Französischen und Deutschen Philologie. Sie ist derzeit an der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität in Olomouc in den Fachbereichen Germanistik und Judaistik tätig. Ihre Spezialgebiete sind Syntax, Jiddisch und Religionswissenschaft. In ihrer Freizeit widmet sie sich der Malerei; und von Zeit zu Zeit findet man ihre Bilder auch auf Ausstellungen. Außer Tipps und Tricks zum Deutschlernen gibt Marie auch Antworten auf folgende Fragen: Warum lohnt es sich Deutsch zu können? Was bringt und erfordert das Studium der Germanistik? ----- Wortschatz: erlernen begeistert sein sich spezialisieren auf r Baukasten, - hinter den Kulissen ----- Nützliche Links zum Deutschlernen, die Marie empfiehlt: Musik: Tomte https://www.youtube.com/watch?v=M6zP71psCT4&ab_channel=GrandHotelvanCleef Tocotronic https://www.youtube.com/watch?v=r6O9uGmujvU&ab_channel=TocotronicVEVO Literatur Daniel Kehlamann, Juli Zeh, Wilhelm Genazino, Sibylle Berg ----- Gutes Deutsch besser www.germanist.cz
Schulden und Euro sind Gift für Italien
bto - beyond the obvious 2.0 - der neue Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter
In der 82. Folge von „beyond the obvious – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ geht es um Staatsschulden, den Euro und Italien. Kann Italien auf Dauer im Euro bestehen? Schwerpunkt der Episode ist ein Gespräch mit Dr. Tobias Straumann. Der Schweizer Wirtschaftshistoriker lehrt an der Universität Basel und ist Titularprofessor an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Im Podcast spricht der Experte für europäische Geld- und Finanzgeschichte über die Lehren aus Schuldenkrisen – wie jener in Deutschland Anfang der 1930er Jahre – für die aktuellen Herausforderungen. Täglich neue Analysen, Kommentare und Einschätzungen zur Wirtschafts- und Finanzlage finden Sie unter www.think-bto.com. Sie erreichen die Redaktion unter podcast@think-bto.com. Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Anregungen und Kritik.
Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss "In den ersten Wochen war es wie Bullerbü", sagte eine Mutter während des ersten Corona-Lockdowns. Seitdem sind rund 8 Monate vergangen. Zeit, die alle Verantwortlichen genutzt haben, um einen zweiten Schullockdown über die kalten Wintermonate zu verhindern. Denn auch wenn manche Familie die intensive gemeinsame Zeit ohne Termine auch genossen hat - im Kontext von Homeschooling tun sich viele Fragen auf: Klafft die Schere zwischen Kindern und Jugendlichen aus wohlbehaltenen und ärmeren Familien oft mit Migrationshintergrund weiter auseinander? Haben Gewalt, Computersucht und Vernachlässigung durch Corona alarmierend zugenommen? Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf die Maßnahmen der Pandemie-Eindämmung? Unser heutiger Gast, der Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch, sagt Ihnen heute, was wir tun können, um den aktuellen Krisenmodus mit und für unsere Zukunft - und das sind unsere Kinder - gut zu bewältigen? Dr. Albert Wunsch ist Psychologe, promovierter Erziehungswissenschaftler, Diplom Pädagoge und Diplom Sozialpädagoge. Bevor er 2004 eine Lehrtätigkeit an der Katholischen Hochschule NRW in Köln begann, leitete er rund 25 Jahre das Katholische Jugendamt in Neuss. 2013 begann er eine hauptamtliche Lehrtätigkeit an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in Essen und Neuss. Außerdem hat er seit vielen Jahren einen Lehrauftrag an der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf und arbeitet in einer eigenen Praxis als Paar-, Erziehungs-, Lebens- und Konflikt-Berater sowie als Supervisor und Konflikt-Coach (DGSV).
(18) Auch ein Trump ist nicht stärker als die Macht der Geschichte
Prof. Dr. Ulrich Schlie vertraut der demokratischen DNA der Amerikanerinnen und Amerikaner: „Das schaffen die, den aus dem Amt rauszubekommen, aber es wird sicher rumpelig werden“. Zugleich liegen zwischen der Wahl und der Vereidigung des nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten hochbrisante Wochen für die Zukunft der USA. Unser Gast im Atlantic Talk Podcast, Prof. Dr. Ulrich Schlie, geht davon aus, dass Joe Biden am 20. Januar verfassungsgemäß vereidigt wird. Es sei kein gutes Zeichen, dass der amtierende Präsident Donald Trump nicht nur mit gerichtlichen Mitteln gegen das Wahlergebnis vorgeht, sondern seit seiner Niederlage auch die Spitzenpositionen verschiedener Sicherheitsinstitutionen neu besetzt, aber auch ein Trump sei nicht stärker als die Macht der Geschichte. Um die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu heilen, werde sich Joe Biden in erster Linie der Innenpolitik zuwenden und den Focus auf wirtschaftliche Fragen lenken müssen, ist Schlie überzeugt. Im Gespräch mit Moderator Oliver Weilandt analysiert der Historiker und Politikwissenschaftler, welche Implikationen der Sieg des Demokraten Biden für die internationale Politik hat, welche Schwerpunkte die USA in geostrategischen Fragen setzen und wie sich die USA zukünftig in internationalen Institutionen wie der UNO, der WHO und der NATO positionieren werden. Prof. Dr. Ulrich Schlie ist unter anderem Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn und ebenda Inhaber der Henry-Kissinger-Professur für Sicherheits- und Strategieforschung. Er war von 2005 bis 2014 Leiter im Planungsstab und Politischer Direktor im Bundesministerium der Verteidigung und ist seit nunmehr 27 Jahren Angehöriger des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik.
Eine Million Infizierte, über 50.000 Todesopfer - Brasilien ist der aktuelle Corona-Hotspot. Während sich im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land die Pandemie ausbreitet, kämpft es weiter mit Skandalen und wirtschaftlichen Problemen. Der Regierung von Jair Messias Bolsonaro wird der falsche Umgang mit der Krise vorgeworfen. Bernardo Johannes Bahlmann stammt aus dem Bistum Münster und ist Bischof von Óbidos. Er schildert im Interview mit Daniel Heinze die aktuellen Herausforderungen. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Warum fühlt es sich als ein Mangel an, zu beten, ohne an Gott zu glauben? Till Raether beschreibt, wie er seit seiner Kindheit dieses Ritual pflegt, wie einen Wunschzettel, aber ohne heilige Schrift, ohne Gemeinde, ohne an Gott zu glauben. Er sucht Erklärungen dafür, warum er trotz der Unfähigkeit zu glauben an diesem Ritual festhält: weil es ihn tröstet, und am Ende auch, weil er erfahren hat, dass es vielen Menschen so geht, und dass er auf diese Weise womöglich doch Teil einer größeren Gemeinschaft ist. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Prof. Dr. Mira Sievers und Prof. em. Dr. Eberhard Tiefensee bieten einen Dialog auf Distanz, woher das Übel kommt, was das Böse ist und wie angesichts des Leids in der Pandemie ein Glaube an Gott noch denkbar ist. Es ist die Theodizee-Frage, der sich zwei TheologInnen aus zwei verschiedenen Religionen auf ihre je eigene Art stellen. Und dem anderen entgegnen. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Russland und die Pandemie - wie geht's Europas großem Nachbarn im Osten?
Corona ist ja eine Pandemie und betrifft somit die ganze Welt. Zugleich hat man ein bisschen den Eindruck: Durch Corona hat sich der Blick etwas verengt – jeder Nationalstaat schaut nur auf die Entwicklung im eigenen Land, allenfalls noch auf die europäischen Nachbarn. Aber wie geht's eigentlich Europas großem Nachbarn im Osten? Wie hat sich Gesellschaft und Kirche in der Pandemie verändert? Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Singles sind von den derzeitigen Kontaktbeschränkungen in besonderem Maß betroffen. Wer alleine lebt, sieht sich derzeit der vormals üblichen Möglichkeiten beraubt, soziale Kontakte zu pflegen. Der Haushalt wird wieder zu der Bezugsgröße, wie er in der Geschichte lange Zeit gewesen ist. Freundschaften und Netzwerke, die für viele Singles einen hohen Stellenwert haben, können nur telefonisch gepflegt werden. Diese und andere Herausforderungen, vor die sich Singles gegenwärtig gestellt sehen, werden benannt. Es folgt ein Blick in Bibel und Menschheitsgeschichte mit der Frage, wie Leben alleine oder in Gemeinschaft ausgesehen hat und was das für das Single-Dasein heute bedeutet. Schließlich werden einige Anregungen genannt, wie Singles diese Krise besser bewältigen können. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Welche Auswirkungen hat das Phänomen des Social Distancing? Die Corona-Pandemie brachte über Wochen hinweg diese Erscheinung als besondere Herausforderung für weite Teile der Gesellschaft. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
ITV-1: So findest du den passenden Job nach dem Studium #experteninterview
Wie findest du den perfekten Job nach dem Studium? Jessica Marx ist Leiterin des Careerservice der philosophischen Fakultät der Universität zu Köln und verrät worauf du beim Berufseinstieg achten solltest. In der heutigen Folge sprechen Jessica und ich darüber, wie du nach Abschluss deines Studiums einen Job findest, der zu dir passt. Auch wenn wir im Schwerpunkt über Einstiegsjobs nach dem Studium sprechen, findest du in der heutigen Folge auch sehr viele wichtige Hinweise wenn es darum geht, welche Ausbildung du machen möchtest und grundsätzlich worauf du bei der Suche nach dem idealen Job achten solltest. Jessica Marx ist 30 Jahre alt und leitet u.a. seit zweieinhalb Jahren den Career Service der Philosophischen Fakultät der Uni Köln. Dabei begleitet sie angehende Geisteswissenschaftler*innen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt und unterstützt sie bei ihrer Berufsorientierung und beim Bewerbungsprozess. "Da sie ich mich schon immer selbst finanzieren musste und zusätzlich zum Studium drei bis vier Nebenjobs gleichzeitig hatte, habe ich zum einen gelernt, dass es unglaublich bereichernd ist, über den Tellerrand zu gucken. Andererseits blieb jedoch kaum Raum für mich, um zu überlegen, wo ich mich beruflich eigentlich wirklich sehe. Umso dankbarer bin ich heute, dass ich einen Job gefunden habe, der mich erfüllt und der es mir ermöglicht, anderen Studierenden genau diesen Raum zu schaffen, der viel zu oft in unserem stressigen Alltag verloren geht." Darum gehts: - Wie hat Jessica den passenden Job nach dem Studium gefunden - Was hat sie dabei gelernt und was kannst du für dich daraus mitnehmen - 5 Tipps, um den richtigen Job nach dem Studium zu finden Du möchtest mit Jessica in Kontakt treten? Hier kannst du sie erreichen: Email: jessica.marx@uni-koeln.de Hat dir die Folge gefallen und glaubst du, dass auch andere von dieser Folge profitieren können? Dann abonniere unseren Podcast und teile die Folge jetzt über den "Teilen"-Button in deiner Podcast-App. Folge uns auf Instagram für noch mehr Inspiration: https://www.instagram.com/berufsoptimierer/?hl=de ----- Übrigens! Kennst du schon unsere Live-Webinare? 120 Minuten geballtes Wissen zu den Themen Bewerbung, Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlung. Das Ganze live und interaktiv so dass du das Meiste aus dem Webinar mitnehmen kannst und vor allem auch alle deine Fragen stellen kannst die dir Bastian direkt beantwortet. Alle weiteren Informationen findest du unter: www.berufsoptimierer.de/webinare Für unsere Hörer*innen gibt es zudem 5% Rabatt mit dem Code "Podcast_5" auf jedes Webinar!
ITV-2: So findest du den passenden Job nach dem Studium #experteninterview
Wie findest du den perfekten Job nach dem Studium? Jessica Marx ist Leiterin des Careerservice der philosophischen Fakultät der Universität zu Köln und verrät worauf du beim Berufseinstieg achten solltest. In der heutigen Folge sprechen Jessica und ich darüber, wie du nach Abschluss deines Studiums einen Job findest, der zu dir passt. Auch wenn wir im Schwerpunkt über Einstiegsjobs nach dem Studium sprechen, findest du in der heutigen Folge auch sehr viele wichtige Hinweise wenn es darum geht, welche Ausbildung du machen möchtest und grundsätzlich worauf du bei der Suche nach dem idealen Job achten solltest. Jessica Marx ist 30 Jahre alt und leitet u.a. seit zweieinhalb Jahren den Career Service der Philosophischen Fakultät der Uni Köln. Dabei begleitet sie angehende Geisteswissenschaftler*innen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt und unterstützt sie bei ihrer Berufsorientierung und beim Bewerbungsprozess. "Da sie ich mich schon immer selbst finanzieren musste und zusätzlich zum Studium drei bis vier Nebenjobs gleichzeitig hatte, habe ich zum einen gelernt, dass es unglaublich bereichernd ist, über den Tellerrand zu gucken. Andererseits blieb jedoch kaum Raum für mich, um zu überlegen, wo ich mich beruflich eigentlich wirklich sehe. Umso dankbarer bin ich heute, dass ich einen Job gefunden habe, der mich erfüllt und der es mir ermöglicht, anderen Studierenden genau diesen Raum zu schaffen, der viel zu oft in unserem stressigen Alltag verloren geht." Darum gehts: - Wie hat Jessica den passenden Job nach dem Studium gefunden - Was hat sie dabei gelernt und was kannst du für dich daraus mitnehmen - 5 Tipps, um den richtigen Job nach dem Studium zu finden Du möchtest mit Jessica in Kontakt treten? Hier kannst du sie erreichen: Email: jessica.marx@uni-koeln.de Hat dir die Folge gefallen und glaubst du, dass auch andere von dieser Folge profitieren können? Dann abonniere unseren Podcast und teile die Folge jetzt über den "Teilen"-Button in deiner Podcast-App. Folge uns auf Instagram für noch mehr Inspiration: https://www.instagram.com/berufsoptimierer/?hl=de ----- Übrigens! Kennst du schon unsere Live-Webinare? 120 Minuten geballtes Wissen zu den Themen Bewerbung, Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlung. Das Ganze live und interaktiv so dass du das Meiste aus dem Webinar mitnehmen kannst und vor allem auch alle deine Fragen stellen kannst die dir Bastian direkt beantwortet. Alle weiteren Informationen findest du unter: www.berufsoptimierer.de/webinare Für unsere Hörer*innen gibt es zudem 5% Rabatt mit dem Code "Podcast_5" auf jedes Webinar!
Kirchen und Corona: Selbstsuche statt Hoffnungsanker?
Pfingsten. Für Christen eines der höchsten Feste. Denn: Pfingsten gilt als der Geburtstag der Kirche. Doch: Geburtstag in Corona-Zeiten - da ist nix mit großer Party. Außerdem ist die Frage: Gibt's bei Kirchens eigentlich überhaupt noch Grund zum Feiern? Schon vor Corona steckten die Kirchen in der Krise, jetzt - so scheint's - noch mehr. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm diskutiert im 'Pfingst-Special' mit ZdK-Präsident Thomas Sternberg. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Werden wir am Ende voller Stolz auf diese Zeit zurückblicken und betrachten, was wir alles geleistet haben? Prof. Dr. Anja Besand stellt dem romantischen Bild, was im Kontext der Covid-19-Pandemie gegenwärtig an Lern- und Veränderungsprozessen angestoßen wird, entgegen, wie wir auch lernen, auf Freiheitsrechte zu verzichten, autoritärer Politik zu vertrauen und nationale Grenzen neu zu schützen. Was sind also die wirklichen pädagogisch didaktischen Kollateral-Effekte der Covid-19-Pandemie? Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Die Covid-19-Pandemie ist auch ein menschenrechtliches Problem. Diese Diagnose mag verwundern, da oft die Annahme vorherrscht, Menschenrechte würden den Bereich der Interaktion zwischen Menschen untereinander oder zwischen Menschen und Institutionen beschreiben, wogegen Krankheiten oder Naturkatastrophen – und die Pandemie scheint beides gleichzeitig zu sein – nicht als Menschenrechtsverletzungen wahrgenommen werden. Was sind die menschenrechtliche Aspekte der Pandemie und was steht im Mittelpunkt? Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Warum globale Gesundheit nicht erst seit COVID-19 die internationale Politik beschäftigt und wie vergangene Krisen globale Gesundheitspolitik beeinflusst haben. Wi ist der Zusammenhang zwischen Praxis und Wissenschaft der internationalen Beziehungen einerseits und der Geschichte globaler Pandemien auf der anderen Seite? Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Hinter den bereits in der Antike ausgebildeten Mechanismen religiöser Krisenbewältigung für Einzelne und Gruppen verbirgt sich die Logik, hinter der Bedrohung letztlich eine gute Macht zu sehen und daraus Hoffnung zu schöpfen. Nach der Aufklärung ist dieser Zusammenhang als Sinnpotential erschließbar. Immer dann, wenn dagegen eigene religiöse Vorstellungen (etwa von göttlichen Strafen) anderen als „Hilfe“ angeboten werden, verstärkt das die Krisen und Bedrohungsgefühle. Dagegen gilt es, Hoffnung wieder als erlern- und übbare Tugend zu verstehen. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Für manche war er 'Mister Europa', Daniel Heinze sprach mit ihm jetzt über den aktuellen Zustand der Europäischen Union angesichts der Corona-Pandemie - und wie der europäische Gedanke neu buchstabiert werden kann. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Ist unsere Gesellschaft in der Lage, mit dem Tod durch Corona umzugehen? Vor welchem Dilemma stehen Politiker, Ethiker und Mediziner? Und wie können wir Entscheidungen über Leben und Tod moralisch verantworten? In diesem unmittelbar vor Veröffentlichung aufgezeichneten Gespräch diskutieren Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU und Bundesministerin der Verteidigung, und Pater Klaus Mertes, Jesuit, Autor und Schuldirektor, über die Bedeutung des Rechts auf Gesundheit und Leben in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
„Seuche ist etwas, das man tut“ lautet die These der Historikerin und kulturwissenschaftlichen Seuchenforscherin Dr. Katharina Wolff aus München. Infektionskrankheiten sind seit jeher Katalysatoren für Gesellschaften. Mit ihrem Blick in die Geschichte und die aufschlussreichen Parallelen, die dabei zwischen den Pest-Epidemien und der aktuellen Corona-Pandemie aufscheinen, zeigt Dr. Katharina Wolff auf, was man daraus für die Bewertung der heutigen Krisensituation lernen kann. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Kontaktverbot, soziale Isolation und “home Office” bedeutet für viele Menschen psychischen Stress. Welche Ängste löst das aus? Und: besteht die Gefahr, dass sich in unserer Gesellschaft eine “schleichende Depressivität” ausbreitet? Prof. Dr. Jürgen Hoyer ist Professor für Behaviorale Psychotherapie an der Technischen Universität Dresden. Als Leiter zahlreicher randomisiert-kontrollierter und naturalistischer Studien untersucht Professor Hoyer schwerpunktmäßig Wirkmechanismen und neue Settings in der Psychotherapie der Angststörungen und Depression. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Die Corona-Krise wird mittelfristig unsere Fremdheitserfahrungen und -wahrnehmungen radikal verändern. Auf welchen gedanklichen Boden fällt also das Erleben in dieser Krise? Mark Arenhövel nimmt als apl. Professor am Institut für Politikwissenschaft diese Frage auf. Sein Wissen über Politische Theorie, Demokratieforschung, Transitions- und Transformationsforschung sowie Erinnerungs- und Geschichtspolitik eröffnet Perspektiven des phantasmatischen Kerns. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Heiß erwartet, hart umstritten? Die Corona-Tracking-App
Sehnsuchtsvoll wird die App erwartet, die Deutschland aus dem 'social distancing' für alle holt. Immerhin zeichnet sie alle Begegnungen mit anderen App-Nutzern auf und warnt, wenn jemand an Covid-19 erkrankt, dem Sie begegnet sind. Wann kommt die App, die Nähe aufzeichnet? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Forscher angesichts der Pandemie? Prof. Fettweis bietet einen Blick hinter die Kulissen, mitten in die Entwicklungslabore Dresdens. Und verspricht: Bald könnte es soweit sein. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
In der Corona-Krise bleiben die Kirchen leer. Ist das ein Zeichen Gottes? Ein Essay des tschechischen Religionsphilosophen Tomáš Halík aus der ZEIT-Beilage 'Christ und Welt', gelesen von Bischof Heinrich Timmerevers. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Pater Dr. Anselm Grün ist Deutschlands bekanntester Benediktinermönch und gleichzeitig Referent, Kursleiter und Bestsellerautor - von ihm stammen zahlreiche spirituelle Bücher. Mit der Situation rund um Corona und der “gesellschaftlichen Quarantäne” erleben derzeit viele Menschen eine besondere Herausforderung: auf einmal lebt man wochenlang an einem Ort, mit den immer gleichen Menschen. Niemand hat das vorher ausprobiert – oder etwa doch? Die Mönche haben seit 1500 Jahren Erfahrungen mit exakt dieser Situation. Anhand ihrer Erfahrungen eröffnet Anselm Grün Perspektiven für eine konstruktive Bewältigung der Corona-Challenge. Die Idee, einen eigenen Bildungspodcast der Katholischen Akademie einzurichten, entstand aus einer Kooperation mit der Philosophischen Fakultät der TU Dresden, die zum Sommersemester 2020 eine „Digitale Ringvorlesung“ anbietet.
Dr. Reto Schölly: Roboterdesign – Theorie, Praxis, Philosophie
Open Codes | Vortrag [01.03.2019] An der Universität Freiburg bauen Studierende, die noch nie mit der Materie zu tun hatten eigenhändig Roboter. »Robot Design – Theory Practice Philosophy« heißt der Kurs, den Dr. Reto Schölly an der Philosophischen Fakultät anbietet. Bei seinem Vortrag am ZKM berichtet er von seinem neuartigen Seminar.
Episode 10: Gesten, ihre Grammatik und was man Maschinen „zeigen“ kann
Interviewpartner: Prof. Dr. Ellen Fricke – Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommunikation Merkel-Raute, Victory-Zeichen, Mittelfinger. Bei allen dreien hat man sofort ein Bild und eine Assoziation im Kopf und je nach Situation mitunter eine heftige Reaktion. Warum diese kleinen Handgesten so eine Wirkung haben, darüber sprechen wir in dieser Folge des TUCscicast. Lara-Lena Gödde ist diesmal extra nach Berlin ins Museum für Kommunikation gereist. Hier ist aktuell die Ausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ zu sehen – initiiert und geleitet von Prof. Dr. Ellen Fricke, Dekanin der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz und dort auch Inhaberin der Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommunikation an der TU Chemnitz. Mit ihr sprechen wir in dieser Folge des TUCscicast über Gesten und ihre Grammatik. Und wenn Ihr in Berlin seid, dann schaut doch mal in der Ausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ im Museum der Kommunikation vorbei. Und das war die letzte Folge des TUCscicast in dieser Staffel! Aber keine Sorge, im Herbst geht es weiter mit der Staffel 2! Die findet ihr dann wie diese Folge auch uns auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den TUCscicast auf Facebook oder Twitter und lasst dort auch gerne Feedback und Kommentare da!
Episode 10: Gesten, ihre Grammatik und was man Maschinen „zeigen“ kann
Interviewpartner: Prof. Dr. Ellen Fricke – Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommunikation Merkel-Raute, Victory-Zeichen, Mittelfinger. Bei allen dreien hat man sofort ein Bild und eine Assoziation im Kopf und je nach Situation mitunter eine heftige Reaktion. Warum diese kleinen Handgesten so eine Wirkung haben, darüber sprechen wir in dieser Folge des TUCscicast. Lara-Lena Gödde ist diesmal extra nach Berlin ins Museum für Kommunikation gereist. Hier ist aktuell die Ausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ zu sehen – initiiert und geleitet von Prof. Dr. Ellen Fricke, Dekanin der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz und dort auch Inhaberin der Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommunikation an der TU Chemnitz. Mit ihr sprechen wir in dieser Folge des TUCscicast über Gesten und ihre Grammatik. Und wenn Ihr in Berlin seid, dann schaut doch mal in der Ausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ im Museum der Kommunikation vorbei. Und das war die letzte Folge des TUCscicast in dieser Staffel! Aber keine Sorge, im Herbst geht es weiter mit der Staffel 2! Die findet ihr dann wie diese Folge auch uns auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den TUCscicast auf Facebook oder Twitter und lasst dort auch gerne Feedback und Kommentare da!
Martin Rhonheimer – Christliche Sozialethik & Kapitalismus: ein Widerspruch?
Kann ein Christ Kapitalist sein? Was macht die christliche Sozialethik aus? Eine spannende Folge mit herrlich unorthodoxen Ansichten. Dr. Martin Rhonheimer ist seit 1990 Professor für Ethik und politische Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. 1983 empfing er die Priesterweihe. Er ist Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy (Wien), dessen Aufbau er sich zur Zeit widmet. Livemitschnitt vom 8.11.2017 (Stadtbräu Josef, Linz) © Theologie vom Fass
Welche Möglichkeit haben Studierenden die Lehrqualität in ihrem Studienfach zu verbessern?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Welche Möglichkeit haben Studierenden die Lehrqualität in ihrem Studienfach zu verbessern?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Was würden Sie die Studierenden fragen?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Was würden Sie die Studierenden fragen?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Was halten Sie von der Befragung der Studierenden?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Wie sieht die Universität in 10 Jahren aus?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Dr. Christina Schoch, Leiterin Service Center Studium Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Wie sieht die Universität in 10 Jahren aus?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Dr. Christina Schoch, Leiterin Service Center Studium Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Was halten Sie von der Befragung der Studierenden?
Dr. Harald Baßler, Administrativer Geschäftsführer des Deutschen Seminars Dr. Janina Kirsch, Studiengangkoordinatorin der Fakultät für Biologie Prof. Dr. Alexander Renkl, Institut für Psychologie Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét, Studiendekanin für akademische Studiengänge im Dekanat der Philosophischen Fakultät
Vom Baum der Erkenntnis zum Social Network – Treffpunkt Bibliothek! (1/2)
Mitschnitt einer Podiumsdiskussion im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin (Teil 1 von 2, 55 Min.)Diskutiert wird über die Herausforderungen und Veränderungen, die das Internet und die neuen Medien an Wissensaneignung, Wissensproduktion und Wissensverbreitung stellen. Die Digitalisierung von Bibliotheksschätzen kommt ebenso zur Sprache, wie Open Access als Kultur des Publizierens, elektronisches vs. analoges Leseverhalten, die Bibliothek als sozialer Ort, das sich wandelnde Berufsbild des Bibliothekars, der Umgang mit primären Forschungsdaten und nicht zuletzt auch die Weiterentwicklung der Informationsstruktur der HU.Auf dem Podium Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität Dr. Karl Werner Finger, Ständiger Vertreter der Generaldirektorin der Staatsbibliothek Dr. Alexander Grossmann, Vice President Publishing STM des De Gruyter-Verlages Maxi Kindling, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Prof. Dr. Peter Schirmbacher, Direktor des Computer- und Medienservice und Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Prof. Dr. Michael Seadle, Dekan der Philosophischen Fakultät I und geschäftsführender Direktor des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität @font-face { font-family: "Verdana"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Begrüßung und Eröffnung: Prof. Dr. Peter Frensch, Vizepräsident für Forschung der Humboldt-UniversitätModeration: Andrea Thilo, Journalistin und ModeratorinDie Podiumsdiskussion fand statt am 24.10.2011
Vom Baum der Erkenntnis zum Social Network – Treffpunkt Bibliothek! (2/2)
Mitschnitt einer Podiumsdiskussion im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin (Teil 2 von 2, 54 Min.)Diskutiert wird über die Herausforderungen und Veränderungen, die das Internet und die neuen Medien an Wissensaneignung, Wissensproduktion und Wissensverbreitung stellen. Die Digitalisierung von Bibliotheksschätzen kommt ebenso zur Sprache, wie Open Access als Kultur des Publizierens, elektronisches vs. analoges Leseverhalten, die Bibliothek als sozialer Ort, das sich wandelnde Berufsbild des Bibliothekars, der Umgang mit primären Forschungsdaten und nicht zuletzt auch die Weiterentwicklung der Informationsstruktur der HU.Auf dem Podium Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität Dr. Karl Werner Finger, Ständiger Vertreter der Generaldirektorin der Staatsbibliothek Dr. Alexander Grossmann, Vice President Publishing STM des De Gruyter-Verlages Maxi Kindling, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Prof. Dr. Peter Schirmbacher, Direktor des Computer- und Medienservice und Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Prof. Dr. Michael Seadle, Dekan der Philosophischen Fakultät I und geschäftsführender Direktor des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Begrüßung und Eröffnung: Prof. Dr. Peter Frensch, Vizepräsident für Forschung der Humboldt-UniversitätModeration: Andrea Thilo, Journalistin und ModeratorinDie Podiumsdiskussion fand statt am 24.10.2011
Globalisierung war Thema an den Fakultätstagen der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät.
Die "Bejlis-Affäre" im Spiegel der liberalen russischen Tageszeitung "Reč"
Am 20. März 1911 wurde in Kiew, auf dem Gelände einer Ziegelei in jüdischem Besitz, die Leiche des 12-jährigen Andrej Jučinskij gefunden, der einige Tage zuvor spurlos verschwunden war. Schnell verbreiteten sich Gerüchte, forciert von den örtlichen Schwarzhundertervereinigungen, Juden hätten einen Ritualmord an dem Jungen begangen. Die Ermittlungen wurden immer mehr auf einen Ritualmord hin fokussiert, nachdem die Mörder zunächst in der Verwandtschaft des Jungen und im Kreis einer kriminellen Bande um Vera Čeberjak gesucht worden waren. Vier Monate nach dem Leichenfund wurde der Jude Mendel Bejlis, Angestellter der besagten Ziegelei, verhaftet, und der Fall Jučinskij wurde zum Fall Bejlis. Gegen Bejlis lag ganz offensichtlich nichts vor – Indizien wurden konstruiert und Anfang 1912 schließlich eine Anklageschrift aufgestellt. Das Besondere am Fall Bejlis ist das enorme Aufsehen, das er in der russischen Öffentlichkeit, zunehmend aber auch in Europa und Amerika, erregte. Nach der Revolution von 1905 hatte sich in Russland ein äußerst lebendiges Pressewesen entwickelt. In den Zeitungen fanden, stärker als in der wenig einflussreichen Staatsduma, heftige Wortgefechte statt – vor allem zwischen dem konservativen Lager, das die uneingeschränkte Autokratie des Zaren wiederherstellen, und dem liberalen, westlich orientierten Lager, das die Reformen des Revolutionsjahres 1905 weiterführen wollte. Dem Antisemitismus kam in diesem Kampf eine Schlüsselrolle zu, da die Juden als Speerspitze der Moderne gesehen wurden. Kein früherer Ritualmordprozess hat einen solchen Widerhall in der Presse gefunden. Angesichts der Bedeutung der Presse in den Zeiten der entstehenden Massenkommunikation stellt sich die Frage, welche Rolle die Presse selbst in diesem Fall gespielt hat. Aus diesem Grund ist die Behandlung des Falls Bejlis in der russischen Presse Gegenstand dieser Arbeit. Als Grundlage wurde die liberale Tageszeitung "Reč" gewählt. Sie verfolgt einen gewissen Anspruch an Objektivität, so dass auch Auszüge aus und Informationen über die gegnerische Presse verwertbar sind. Informationen über die liberale Presse aus reaktionären Organen würden diesen Ansprüchen nicht genügen. Innerhalb der liberalen Presse hatte die "Reč" eine Führungsrolle inne, zum einen, da sie als Sprachrohr der bedeutendsten liberalen Oppositionspartei, der Konstitutionellen Demokraten, galt, zum anderen wegen der großen Resonanz, die sie in der russischen Presse fand. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster angenommen.
Identität und Abgrenzung
Die polnische Adelsgesellschaft der Frühen Neuzeit wurde durch ihren hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung des polnisch-litauischen Staates und ihre ethnische, konfessionelle und sozio-ökonomische Heterogenität gekennzeichnet. Gleichzeitig verstand sich die szlachta trotz der trennenden Elemente als eine Gemeinschaft und bezeichnete sich als Adelsnation (naród szlachecki). Der polnische Historiker Benedykt Zientara deutet die "Nation" als eine historisch herausgebildete und objektiv existierende Gemeinschaft, die durch eine Kombination unterschiedlicher Faktoren (Beziehungen und Bindungen) verbunden ist. Diese Auffassung erlaubt die Entwicklung eines für die Quellenanalyse zweckmäßigen Instrumentariums in Form eines Katalogs der Faktoren, welche die nationale Identität der szlachta und somit die Adelsnation formten. Die vorliegende Arbeit untersucht die Faktoren, welche die nationale Identität des polnischen Adels, während der Regierungszeit Jan Kazimierzs (1648-1668) konstituierten. Dabei beschränkt sich die Analyse der adligen Identität auf die Regierungszeit. Die chronologische Eingrenzung geschah in Hinsicht auf die diese Epoche kennzeichnenden innen- und außenpolitischen Ereignisse, welche auch eine starke zeitgenössische publizistische Reaktion auslösten. Die politisch-verfassungsrechtlichen, sozio-wirtschaftlichen und kulturell-religiösen Konsequenzen der Vorgänge dieser Zeit hatten eine starke Wirkung auf das Nationalbewusstsein. Hauptsächlich stützt sich die Arbeit auf das Werk Obrona Polski von Łukasz Opaliński. Daneben wird auf einzelne, hauptsächlich anonym verfasste Schriften aus der Quellensammlung politischer Publizistik aus der Regierungszeit des Jan Kazimierz Waza zurückgegriffen. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster angenommen.
Studien zur Stadt in der Literatur
Anders als im Falle vieler westlicher und einiger weniger osteuropäischer Metropolen, haben die literarischen Diskurse zu den Städten Südosteuropas noch wenig Aufmerksamkeit von der Wissenschaft erfahren. Dies scheint gerade im Falle Belgrads zunächst erstaunlich, zieht man die politische wie kulturelle Bedeutung der Stadt für die sie umgebende Region in Betracht. Die scheinbare Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Stadt und ihrer Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit, die sich einem Verstehen der Stadt Belgrad als kulturellem Phänomen nähern will, indem sie Antworten auf folgende Fragen erarbeitet: Wie lässt sich anhand von einigen Beispielen der Umgang mit dem Belgrad-Thema im literarischen Text beschreiben? Welche Rückschlüsse lässt dies auf die Deutung der Stadt als Kulturform zu? Welches kulturelle Selbstverständnis äußert sich in den literarischen Gestaltungen des Belgrad-Themas? Diese Arbeit beschränkt sich auf eine kleine Anzahl von Texten, unterzieht diese aber einer eingehenden Untersuchung. Es wird also keine Überblicksdarstellung über die literarischen Belgrad-Texte des 20. Jahrhunderts vorgelegt, sondern eine Auswahl von Texten getroffen, die jeweils eine bestimmte Sicht auf die Stadt, unterschiedliche Epochen und Stilrichtungen repräsentieren. Bei der Auswahl des Materials ausgeschlossen wurden: Memoirenliteratur, Trivialliteratur und Reisebeschreibungen. Um die ausgewählten Texte unter der oben formulierten Fragestellung betrachten zu können, werden im ersten Teil der Arbeit methodische und begriffliche Voraussetzungen für die Untersuchung vorgestellt und erörtert. Insbesondere wird ausführlich erläutert, wie der Begriff "Stadtdiskurs" in dieser Arbeit verstanden wird und warum die entwickelten Konzepte von der Persönlichkeit und der Lesbarkeit der Stadt nützlich sind, um sich einem Verstehen der Stadt anzunähern. In einem zweiten Teil werden dann die ausgewählten Texte in der chronologischen Reihenfolge ihres Erscheinens vorgestellt und ihr jeweiliger Beitrag zum literarischen Diskurs über Belgrad beschrieben. Als Anhaltspunkte dafür dienen übergreifende Themen, deren Diskussion für ein Verständnis der Stadt als Kulturform sinnvoll scheint. Das sind vor allem Fragen nach Geschichts- und Raumbildern, mit deren Hilfe ein Gesamtbild Belgrads konstruiert wird. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig angenommen.
Politisches Leben in der bulgarischen Dorfgesellschaft 1919-1944
Nachdem mit dem Ende der Sowjetunion das von ihr gestützte kommunistische System zusammengebrochen ist, wird für die historische Forschung eine Herangehensweise möglich, die sich mehr der Innensicht der zugehörigen Gesellschaften widmet. Neben Aspekten von Macht und Kontrolle geraten jetzt auch Fragen ins Blickfeld wie der Alltag in der sozialistischen Gesellschaft oder das Leben des "kleinen Mannes" (oder der "kleinen Frau") im Kommunismus. Diese waren nicht nur Opfer des Systems. Sie waren ebenso seine Teile oder seine Profiteure, je nach persönlichen Lebensumständen, Einstellungen, Vorerfahrungen oder familiärem Hintergrund. Diese Arbeit über das politische Leben in der bulgarischen Dorfgesellschaft (1919-1944) widmet sich der Aufarbeitung kommunistischer Vergangenheit, indem sie nach Ursachen fragt: Wie konnte ein in sich so widersprüchliches System entstehen, und wie konnte es 50 oder mehr Jahre überdauern? Antworten darauf sind nicht nur durch die Analyse internationaler politischer und ökonomischer Konstellationen und Entwicklungen zu suchen, sondern auch im Innern der betroffenen Gesellschaften selbst. Die sozialistischen Staaten waren nicht nur von ihren Kontrollinstitutionen getragen, sondern auch von der aktiven oder passiven Zustimmung mehr oder weniger großer Bevölkerungsteile. Die Arbeit beleuchtet dies anhand der Lebenserinnerungen eines bulgarischen Kommunisten am unteren Ende der Hierarchie, und zwar für die Zeit vor der Etablierung der kommunistischen Parteiherrschaft. Es geht damit um die Entstehung von pro-kommunistischen oder pro-sowjetischen Einstellungen in den 1920er bis frühen 1940er Jahren als Vorbereitung für den späteren Systemwechsel. Die Erinnerungen des Stefan Rajkov Canev, nach 1980 verfaßt, widmen sich insbesondere dem Parteileben und den politischen Kämpfen in der dörflichen Gesellschaft der Jahre zwischen den beiden Weltkriegen. Stefan Rajkov Canev war Enkel eines dörflichen Mühlenbesitzers, wandte sich in der Schulzeit und beim Studium (1920er und 1930er Jahre) der kommunistischen Bewegung zu und wurde in seinem Heimatdorf Parteivorsitzender. Mit dem Einzug der sowjetischen Armee im September 1944 brachte er es zum kommunistischen Funktionär auf Bezirksebene, doch wurde die politische Karriere bald abgeschnitten. Trotzdem blieb er seiner politischen Überzeugung treu. Am Ende seines Lebens zog er eine positive Bilanz der kommunistischen Zeit. In Teil 1 der Arbeit werden theoretische Probleme der Verwendung von autobiographischen Zeugnissen als historische Quelle umrissen, wobei Subjektivität und Konstruiertheit von Erinnerung im Mittelpunkt stehen. Teil 2 skizziert die Gesellschaft, in die Rajkovs Leben 1919 bis 1944 eingebettet war (Politische Geschichte Bulgariens, Parteigeschichte, Dorfsoziologie). Teil 3 widmet sich dann der eigentlichen Frage nach dem politischen Leben in der bulgarischen Dorfgesellschaft zwischen den Weltkriegen, besonders im Hinblick auf die Entstehung pro-kommunistischer Haltungen bei ländlicher Bevölkerung. - Die der Untersuchung zugrundeliegende Autobiographie war bisher unpubliziert und wird deshalb als Anhang in Übersetzung beigefügt. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität München angenommen.
Der Briefwechsel zwischen Sergej Makovskij und seiner Schwester Elena Luksch-Makovskaja, 1914-1961 2/2
Der Name Sergej Konstantinovič Makovskij ist meist nur dem Kenner der russischen Literatur- und Kulturgeschichte bekannt und wird öfters mit den Namen der Maler Konstantin Egorovic oder Vladimir Egorovič Makovskij verwechselt. Kenntnisse von seinen Leistungen beschränken sich bei den unerfahrenen Lesern meistens auf seine Tätigkeit in der Zeitschrift "Apollon", seine Bücher "Portrety sovremennikov" und "Na parnase Serebrjannogo veka". Für den Forscher dagegen, der sich mit dem "Silbernen Jahrhundert" der russischen Geschichte auseinandersetzt, sind seine Werke von großer Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit soll der Briefwechsel zwischen Sergej Makovskij und seiner Schwester Elena Luksch-Makovskij untersucht werden. Diese Korrespondenz ist ein Bestandteil des Nachlasses von Elena Luksch-Makovskij. Zu Beginn wird die erhaltene Korrespondenz charakterisiert und der Leser über das Aufbauprinzip der Edition aufgeklärt. Den zentralen Teil bilden dann die Edition und die Bearbeitung der Briefe von Sergej Makovskij. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster angenommen.
Der Briefwechsel zwischen Sergej Makovskij und seiner Schwester Elena Luksch-Makovskaja, 1914-1961 1/2
Der Name Sergej Konstantinovič Makovskij ist meist nur dem Kenner der russischen Literatur- und Kulturgeschichte bekannt und wird öfters mit den Namen der Maler Konstantin Egorovic oder Vladimir Egorovič Makovskij verwechselt. Kenntnisse von seinen Leistungen beschränken sich bei den unerfahrenen Lesern meistens auf seine Tätigkeit in der Zeitschrift "Apollon", seine Bücher "Portrety sovremennikov" und "Na parnase Serebrjannogo veka". Für den Forscher dagegen, der sich mit dem "Silbernen Jahrhundert" der russischen Geschichte auseinandersetzt, sind seine Werke von großer Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit soll der Briefwechsel zwischen Sergej Makovskij und seiner Schwester Elena Luksch-Makovskij untersucht werden. Diese Korrespondenz ist ein Bestandteil des Nachlasses von Elena Luksch-Makovskij. Zu Beginn wird die erhaltene Korrespondenz charakterisiert und der Leser über das Aufbauprinzip der Edition aufgeklärt. Den zentralen Teil bilden dann die Edition und die Bearbeitung der Briefe von Sergej Makovskij. Diese Arbeit wurde als Magisterarbeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster angenommen.
Auszug aus der Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (1. Sektion) der Ludwig-Maximilians-Universität München
Fri, 1 Jan 1926 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/2673/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/2673/1/WU8H.lit.19391.pdf Unbekannter Autor Universität München / Philosophische Fakultät (Hrsg.): Auszug aus der Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (1. Sektion) der Ludwig-Maximilians-Universität München. genehmigt 31. März, 8. Juni 1921, 15. Dezember 1926. München: Druc