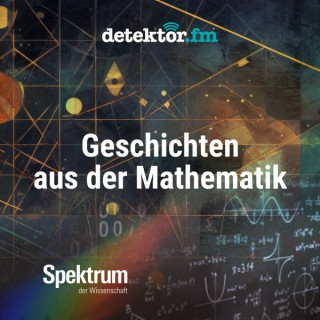Podcasts about protestantismus
- 76PODCASTS
- 111EPISODES
- 32mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Jan 21, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about protestantismus
Latest news about protestantismus
- Propylaeum-DOK: Digital Repository: Ancient History AWOL - The Ancient World Online - Dec 26, 2025
Latest podcast episodes about protestantismus
Joyce Meyer: "Predigten und Vorträge nicht korrekt?"
"Ich sehe mir seit Jahren die Sendung von Joyce Meyer 'Das Leben gnießen' an. Ihre Vorträge und Bücher haben ähnliche Inhalte wie von Pater Anselm Grün, sind in viele Sprachen übersetzt und habe riesige Auflagen" (Zuschrift).Mit Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner.Unsere Mission:K-TV steht zu Tradition und Lehramt der katholischen Kirche. Der Sender möchte die katholische Lehre unverfälscht an die Menschen weitergeben und so die Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens verbreiten. Die Vermittlung von Glaubensinhalten ist zudem ein zentrales Anliegen.Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Links zu K-TV: YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ TikTok: https://www.tiktok.com/@katholisches.fernsehenPodcasts: https://www.k-tv.org/podcast LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/k-tv-katholisches-fernsehen/ X: https://x.com/ktv_fernsehen Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ Mediathek: https://www.k-tv.org/mediathek/Newsletter: https://www.k-tv.org/newsletter/Datenschutzerklärung: https://www.k-tv.org/datenschutz Impressum: https://www.k-tv.org/impressum
Katholische Kirche: "Nicht protestantisch werden!"
"Auch wenn der Papst keine zweite protestantische Kirche in Deutschland will, de facto lebt mehr als die Hälfte der Katholiken protestantisch" (Zuschrift).Mit Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner.Unsere Mission:K-TV steht zu Tradition und Lehramt der katholischen Kirche. Der Sender möchte die katholische Lehre unverfälscht an die Menschen weitergeben und so die Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens verbreiten. Die Vermittlung von Glaubensinhalten ist zudem ein zentrales Anliegen.Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Links zu K-TV: YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ TikTok: https://www.tiktok.com/@katholisches.fernsehenPodcasts: https://www.k-tv.org/podcast LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/k-tv-katholisches-fernsehen/ X: https://x.com/ktv_fernsehen Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ Mediathek: https://www.k-tv.org/mediathek/Newsletter: https://www.k-tv.org/newsletter/Datenschutzerklärung: https://www.k-tv.org/datenschutz Impressum: https://www.k-tv.org/impressum
Philosoph Alexander Grau: Protestantismus bedeutet Freiheit und Individualismus
Röther, Christian www.deutschlandfunk.de, Tag für Tag
Am dritten Adventssonntag bleiben wir direkt in Dresden und dürfen einen Gesprächspartner begrüßen, der sich nicht nur mit der Musik rund um die Frauenkirche genau auskennt, sondern auch mit dem Liedgut besonders aus der Weihnachtstradition des Protestantismus vertraut ist.
Fegfeuer: "Eine Erfindung im katholischen Glauben?"
"Es ist vielmehr der von innen her notwendige Prozess der Umwandlung des Menschen, in dem er christus-fähig, gott-fähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Communio sanctorum wird" (Joseph Ratzinger).Mit Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner.Unsere Mission:K-TV steht zu Tradition und Lehramt der katholischen Kirche. Der Sender möchte die katholische Lehre unverfälscht an die Menschen weitergeben und so die Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens verbreiten. Die Vermittlung von Glaubensinhalten ist zudem ein zentrales Anliegen.Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Links zu K-TV: YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ TikTok: https://www.tiktok.com/@katholisches.fernsehenPodcasts: https://www.k-tv.org/podcast LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/k-tv-katholisches-fernsehen/ X: https://x.com/ktv_fernsehen Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ Mediathek: https://www.k-tv.org/mediathek/Newsletter: https://www.k-tv.org/newsletter/Datenschutzerklärung: https://www.k-tv.org/datenschutz Impressum: https://www.k-tv.org/impressum
Claudia Jetter: Evangelikale Frauen – einflussreich und unbekannt
Das Bild, das wir uns vom US-amerikanischen Protestantismus machen, ist stark Trump-fixiert. Unter Evangelikalismus verstehen die meisten Europäer heute eine fundamentalistische, frauenfeindliche religiös-politische Massenbewegung. Dabei kann man über den Evangelikalismus auch anderes berichten – zum Beispiel von sehr wirkmächtigen Frauen. Diese Frauen-Geschichten aus den vergangenen 200 Jahren können uns helfen, ein differenziertes Bild von US-amerikanischer Religion zu gewinnen – das hätte auch Folgen für unser Selbstverständnis im europäischen Christentum. Die Amerikanistin und evangelische Theologin Claudia Jetter (Berlin) hat intensiv zu evangelikalen Frauen geforscht und kann erstaunliche, beeindruckende, aber auch zwiespältige Geschichten erzählen. Genannt werden: Phoebe Palmer Sojourner Truth Phyllis Schlafly Beth Moore Jen Hatmaker
Albert Schweitzers Schatten. Ein „protestantischer Heiliger“ kritisch gewürdigt
Vortrag und Diskussion vom 28. August 2025 mit Autorin und Journalistin Dr. Caroline Fetscher, Björn Blumenhagen (Netzwerk Decolonize Theology) und Dr. Roland Wolf (Deutscher Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene), moderiert von Dr. Helge Bezold (Evangelische Akademie Frankfurt) und Dr. Gunter Volz (Evangelisches Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach). Das Wirken von Albert Schweitzer (1875–1965) findet bis heute nicht nur eine enorme Resonanz, sondern wirft auch einen weiten Schatten. Im Nachkriegsdeutschland entstand ein regelrechter Hype um den Arzt, Theologen, Philosophen, Musiker und Friedensnobelpreisträger. Im Albert-Schweitzer-Jahr 2025 erscheint er als Symbolfigur für humanitäres und friedensstiftendes Engagement – im Protestantismus hat er quasi den Status eines Heiligen. Doch es gibt auch rassistische und paternalistische Schattenseiten der Lichtgestalt, wie die Publizistin Caroline Fetscher in ihrer Studie „Tröstliche Tropen“ (2023) gezeigt hat. Nach einem Vortrag hierüber reflektieren wir mit weiteren Fachleuten Schweitzers Bedeutung für die Gegenwart und diskutieren, inwiefern seine Ideen und sein Handeln heute noch Vorbildcharakter haben.
Nach seinem Aussetzer letzte Woche, wo Matussek mit lauter Country-Hippie-Schnulzen seine Gothic-Fans vergraulte, legt er sich nun mit seiner Kirche an, der katholischen Kirche. Die steuert derzeit mit ihrer staatsnahen „Regenbogenpastoral“ auf eine erneute Reformation in der eigenen Kirche zu: Aufhebung des Zölibats, Frauenpriestertum, statt bischöflicher Hirten-autorität nun Pastoral- oder Gemeindereferentinnen und unzählige Gremien, die meisten von ihnen mit Geschlechtergerechtigkeit befasst. In anderen Worten Protestantismus heute. Als der Papst davon Mitteilung bekam, rief er entgeistert nach Norden: Ihr habt doch bereits eine wunderbare protestantische Kirche! Schon wieder also Protestantismus, schon wieder auch irgendwo, jetzt in Echt, die „Frauenfrage“, also „wolle ma se heiroooode lossä“, auf der Ebene wird das mittlerweile verhandelt, losgekoppelt vom tiefen Ernst dieser Lebensentscheidung zur Priesterschaft, von Sakrament, Weihe und Aura, zu der selbstverständlich auch das Zölibat gehört … Macht weiter so, aber diesmal auf der regenbogenfarbenen Rutschbahn in die Hölle. Musik zur Philippika: Gram Parsons, Mozart, Elvis.
#232 GddZ - Konfliktfeld Arbeitswelt. Im Gespräch mit Prof. Peter Nieschmidt
Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung.
In dieser Episode von „Gut durch die Zeit“ sprechen wir mit Prof. Dr. Peter Nieschmidt über die faszinierende und komplexe Welt der Arbeitsorganisation. Wir analysieren die Wurzeln unserer aktuellen Arbeitskultur und beleuchten die historische Entwicklung von Arbeitsbeziehungen, die einst von sozialer Interaktion und Vertrauen geprägt waren. Nieschmidt reflektiert seine Erlebnisse in der hierarchischen Arbeitswelt der 1960er Jahre und erörtert die Herausforderungen, die sich aus den Veränderungen hin zu mehr Selbstverantwortung und Integration in Entscheidungsprozesse ergeben. Besonders hervorzuheben ist sein Ansatz zur Authentizität von Führung, der die Notwendigkeit unterstreicht, soziale Wirklichkeiten zu gestalten und Empathie zu zeigen. Abschließend diskutieren wir die Lernerfahrungen, die gute Führung erfordert, und wie sie unser Verständnis von Arbeits- und Führungsstrukturen nachhaltig beeinflussen können.
Ein Standpunkt von Felix Feistel.Nicht erst seit dem Coronatotalitarismus zeigt sich vor Allem im globalen Norden und im politischen Westen eine enorme Krise. Europa und Nordamerika, die Epizentren der Industrialisierung, des sogenannten Fortschritts und die Speerspitze der entwickelten Staaten, zeichnen sich seit Jahrhunderten durch Extreme, vor allem extreme Gewalt, Unterdrückung und globale Hegemonialansprüche aus. Doch seit etwa einem Jahrhundert scheinen die Extreme zuzunehmen. Zwei vernichtende Weltkriege, die systematische Verfolgung und Auslöschung von Minderheiten, Kriege, die überall auf der Welt um Ressourcen und Machtansprüche geführt werden, und die Menschheit immer wieder an den Rand der nuklearen Auslöschung treiben, all das findet in großer Konzentration im globalen Westen und von diesem ausgehend in den ehemaligen Kolonialgebieten statt.Auch innerhalb der westlichen Gesellschaften erleben wir immer wieder geradezu wahnhafte Zeiten, die in Massenhysterie mit vielen Opfern ausarten, und sich meist entlang unsichtbarer Bedrohungen und imaginärer Feinde entwickeln. Schon die Ideologie des Nationalsozialismus, die in einen totalitären Terrorstaat mündete, war ein solcher Massenwahn. Mit einigen Abstrichen kann dasselbe über die kommunistischen Bewegungen überall auf der Welt, vor Allem aber in Osteuropa, gesagt werden. Letztlich war auch der Coronafaschismus nichts anderes als eine Massenhysterie, die eine ganze Gesellschaft in Bewegung versetzt und sie entlang bestimmter, politisch gewollter Linien ausgerichtet hat, wie ein Magnet Metallspäne ausrichtet. Massenhysterien und kollektiver Wahn werden von Herrschenden systematisch und gezielt als Herrschaftsmittel genutzt. Doch wie ist es zu erklären, dass die Menschheit immer wieder anfällig für diese ist?Aufklärung als AusgangspunktHier im Westen, vor Allem in Europa, ist man stolz auf die Aufklärung. Die Aufforderung, sich seines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines Anderen zu bedienen, die Kant formulierte, hat die Wissenschaft hervorgebracht, und unsere Kenntnis von der Welt auf eine ganz neue Ebene gehoben. Der Natur auf den Grund zu gehen, die Geschehnisse in der Welt zu verstehen, Naturgesetze zu formulieren, und das alles losgelöst von einer göttlichen Entität, die zuvor die Auslegung der Wahrnehmung diktiert hat, war eine große Errungenschaft, welche die Welt neu ordnete. Die Macht der Kirche nahm ab, die weltlichen Mächte traten hervor, und in diesem Zuge formten sich Staaten losgelöst von kirchlichen Weihen. Entdeckungen und Erfindungen wurden gemacht, neue Maschinen und Techniken bis hin zu den digitalen Geräten, die wir heute haben, hoben die Welt vollständig aus den Angeln und sortierten sie vollkommen neu.Schon lange ist das Leben im Westen nicht mehr bestimmt von göttlichen Kräften. Auch das Wertesystem, das die Religion vorgibt, wurde vollkommen hinterfragt und ersetzt. An die Stelle einer Gottheit, einer metaphysischen Existenz, einer letzten Wahrheit und Quelle allen Seins, trat eine rein physische, eine materielle Welt, die bestimmt ist von Ursache und Wirkung. Es zählte keine metaphysische Realität mehr, sondern nur noch das Hier und Jetzt der fassbaren Wirklichkeit. Diese Vorstellung war von Martin Luther und dem Protestantismus schon vorbereitet worden, indem diese propagierten, Gott belohne die besonders Gläubigen bereits im Diesseits – und nicht, wie die Kirche es zuvor propagiert hatte erst im Jenseits. Diese Belohnung, und damit die göttliche Gunst, drückte sich dieser Vorstellung zufolge im materiellen Wohlstand aus....hier weiterlesen: https://apolut.net/die-krise-der-vernunft-von-felix-feistel/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Zu politisch, zu angepasst, zu flach – und vor allem: zu wenig Kirche. Hannah Bethke hält der evangelischen Kirche in Deutschland den Spiegel vor. In ihrem neuen Buch „Vom Glauben abgefallen“ rechnet sie mit dem Zustand des Protestantismus ab – und ruft zur Rückbesinnung auf das Theologische auf. In dieser Folge diskutieren Stephan und Manu, wie berechtigt diese Kritik ist. Geht es der Kirche wirklich schlechter, weil sie zu politisch geworden ist? Oder ist das Gegenteil der Fall? Was bedeutet eigentlich „Theologisierung“ – und wie kann die Kirche in einer pluralen Demokratie sprechen, ohne sich aufzugeben? Ein Gespräch über Selbstsäkularisierung, politische Überforderung, spirituelle Tiefe – und über die Frage, wie Kirche heute stören darf, ohne destruktiv zu wirken. Manu meldet sich aus der Ardèche, Stephan bringt einen Fahrradverlust (und -fund) mit – und beide fragen sich, ob Bethkes Essay ein Weckruf oder eine Selbstvergewisserung für konservative Protestant:innen ist. Das Buch, auf das wir uns beziehen, ist: Hannah Bethke: Vom Glauben abgefallen. Eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche. Kösel 2025. Mehr dazu findet ihr in Stephans Blogbeitrag: https://www.eks-eers.ch/blogpost/hannah-bethke-vom-glauben-abgefallen/ – oder auch in dieser älteren Folge von Ausgeglaubt: https://www.reflab.ch/ausgeglaubt-wir-muessen-nicht-in-eine-kirche-gehen/, in der Stephan und Manu über die These streiten: «Ich glaube nicht, dass wir in eine Kirche gehen müssen…». Korrigenda: In der Vorstellung von Hannah Bethke haben sich gleich mehrere Fehler eingeschlichen, die wir hier gerne richtigstellen: Frau Dr. Hannah Bethke hat Jahrgang 1980 und ist also dieses Jahr nicht 42, sondern 45 Jahre alt geworden. Sie hat in Politikwissenschaft promoviert (und nicht wie im Podcast gesagt in Literaturwissenschaft) – und sie arbeitet nicht mehr im Feuilleton der FAZ, sondern ist zur Zeit innenpolitische Redakteurin in der WELT und WELT AM SONNTAG. Ausserdem ist das von uns besprochene Buch nicht Ende letzten Jahres, sondern im Februar 2025 erschienen. Wir entschuldigen uns für die falschen Angaben und bedanken uns bei Hannah Bethke für die Richtigstellungen!
Im Jahr 1934 tobt der Kirchenkampf im deutschen Protestantismus. Ein Netzwerk von Pfarrern für Pfarrern wehrt sich gegen das Reichskirchenregime" von Ludwig Müller. Aber kann man sagen, der Pfarrernotbund gehört zu den "Guten"? Melde dich und unterstütz mich doch auf Patreon oder mit Paypal: https://linktr.ee/deutschland33_45pod Intro-Musik arrangiert und vertont von Max, Auszüge aus Reden von Joseph Goebbels (Rede vor dem Reichsverband der Deutschen Presse am 18.11.1934) und Adolf Hitler (Abschlussrede auf dem Reichsparteitag am 10.9.1934), beide via www.archive.org Outro: "Hein spielt abends so schön auf dem Schifferklavier" von den Comedian Harmonists Erwähnte Folgen: #33.10 (Radiobeitrag von Dietrich Bonhoeffer) Ausgewählte Literatur: Klaus Scholder: Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung 1934, Berlin 1985. Danke für die Spende, Benedikt! Tags: #Neuere_und_neueste_Geschichte #Deutschland
Dietrich Bonhoeffer zum 80. Todestag - Vom NS-Gegner zum Messias der evangelikalen Rechten
Am 9. April 1945 wurde der evangelische Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz ermordet. Viele Jahre war Dietrich Bonhoeffer ein "Heiliger" des Protestantismus insgesamt. Nun eine Überraschung: 80 Jahre nach seinem Tod hat die evangelikale Rechte in den USA den Theologen für sich entdeckt. Simon Berninger über Bonhoeffer und den Streit um sein geistiges Erbe.
Konversion: "Ich sehne mich nach den katholischen Sakramenten"
"Aus Rücksicht auf meine evangelische Familie warte ich. Sobald meine Familie, insbesondere mein Mann, keine Vorbehalte mehr hat, möchte ich katholisch werden" (Zuschrift).Unsere Mission:K-TV steht zu Tradition und Lehramt der katholischen Kirche. Der Sender möchte die katholische Lehre unverfälscht an die Menschen weitergeben und so die Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens verbreiten. Die Vermittlung von Glaubensinhalten ist zudem ein zentrales Anliegen.Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Links zu K-TV: YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/k-tv-katholisches-fernsehen/ X: https://x.com/ktv_fernsehen Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ Mediathek: https://www.k-tv.org/mediathek/Newsletter: https://www.k-tv.org/newsletter/Datenschutzerklärung: https://www.k-tv.org/datenschutz Impressum: https://www.k-tv.org/impressum
Neue Wege in der Kirchenarbeit: Multi-, Inter- und Transprofessionelle Teams
In der Kirche werden verstärkt neue Formen der Zusammenarbeit erprobt. Das traditionelle Modell von Kirchengemeinde und ihrer Pfarrerin/Ihres Pfarrers tritt zunehmend in den Hintergrund. Fachkräftemangel, finanzieller Druck und die wachsende Vereinzelung des kirchlichen Personals führen vielerorts zu einem Umdenken. Hinzu kommen Mitgliederverluste, Relevanzprobleme und die Überforderung der bisherigen Strukturen. Unser Gast, Pastor Dr. Gunther Schendel, diskutiert mit uns über die Notwendigkeit agilerer Arbeitsmodelle und den Einsatz von Multi-, Inter- und Transprofessionellen Teams in der Kirchen- und Personalentwicklung. Wir beleuchten die Chancen, rechtlichen Grenzen und Herausforderungen dieser neuen Strukturen und erfahren, wie sich diese Veränderungen auf das Bild der Gemeinde und der Kirche auswirken können. So kann die Kirche in Zukunft zu einem auftragsbezogenen, sozialraumorientierten und kundenorientierten Akteur werden. Hier findet ihr weitere Infos: Multiprofessionalität und mehr. Multiprofessionelle Teams in der evangelischen Kirche – Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven, SI-Kompakt 3-2020: https://www.siekd.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28_SI-KOMPAKT_Multiprofessionelle-Teams_Schendel.pdf Schendel, Gunther (2017): Pfarrpersonen unter Veränderungsdruck. Ein Gang durch die Befragungen zum Pfarrberuf, in: ders. (Hg.): Zufrieden gestresst herausgefordert – Pfarrerinnen und Pfarrer unter Veränderungsdruck, Leipzig 2017, S. 51-93: https://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p4124_Zufrieden---gestresst---herausgefordert.html Schendel, Gunther (2019): Wie geht's den Diakon*innen? Aktuelle Ergebnisse aus der hannoverschen Landeskirche, in: Praktische Theologie 3-2019, S. 176-185: https://www.degruyter.com/document/doi/10.14315/prth-2019-540310/html Schendel, Gunther (2020a): Relevant im Sozialraum, profiliert im Team? Aktuelle Veränderungen und Perspektiven im Pastoren- und Diakonenberuf, in: Jahrbuch sozialer Protestantismus, Bd. 12, Leipzig, S. 112-137: http://www.stiftung-sozialer-protestantismus.de/jahrbuecher Schendel, Gunther (2020b): Ehrenamtliche im Verkündigungsdienst: systemrelevant und offen für neue Rollen, Aktuelle empirische Ergebnisse aus der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, SI-Kompakt 2-2020: https://www.siekd.de/wp-content/uploads/2020/07/SI-KOMPAKT-2-2020-Schendel.pdf Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Schreibt uns! --> info@si-ekd.de
Im 15. Jahrhundert ist Maria Stuart Königin von Schottland — aber sie will mehr. Sie ist auf den englischen Thron aus, legt sich mit der Königin Elisabeth I. an, spinnt Intrigen. Schließlich wird sie zum Opfer ihrer eigenen Verschwörungen: Menschliche und kryptografische Fehler kosten sie das Leben. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:02) Einleitung (00:02:34) Drei Königreiche für ein Drama (00:05:46) Die junge Königin von Schottland und Frankreich (00:10:31) Katholizismus vs. Protestantismus (00:13:10) Das Schicksal von Elisabeth I. (00:16:28) Kabale und Liebe (00:19:42) Maria Stuart in englischer Gefangenschaft (00:23:10) Eine kurze Geschichte der Kryptografie (00:30:01) Verschlüsselte Verschwörung (00:32:11) Fazit & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/geschichten-aus-der-mathematik-maria-stuart
Geschichten aus der Mathematik | Maria Stuart und ihr ‚Game of Thrones‘
Im 15. Jahrhundert ist Maria Stuart Königin von Schottland — aber sie will mehr. Sie ist auf den englischen Thron aus, legt sich mit der Königin Elisabeth I. an, spinnt Intrigen. Schließlich wird sie zum Opfer ihrer eigenen Verschwörungen: Menschliche und kryptografische Fehler kosten sie das Leben. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:02) Einleitung (00:02:34) Drei Königreiche für ein Drama (00:05:46) Die junge Königin von Schottland und Frankreich (00:10:31) Katholizismus vs. Protestantismus (00:13:10) Das Schicksal von Elisabeth I. (00:16:28) Kabale und Liebe (00:19:42) Maria Stuart in englischer Gefangenschaft (00:23:10) Eine kurze Geschichte der Kryptografie (00:30:01) Verschlüsselte Verschwörung (00:32:11) Fazit & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/geschichten-aus-der-mathematik-maria-stuart
Im 15. Jahrhundert ist Maria Stuart Königin von Schottland — aber sie will mehr. Sie ist auf den englischen Thron aus, legt sich mit der Königin Elisabeth I. an, spinnt Intrigen. Schließlich wird sie zum Opfer ihrer eigenen Verschwörungen: Menschliche und kryptografische Fehler kosten sie das Leben. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:02) Einleitung (00:02:34) Drei Königreiche für ein Drama (00:05:46) Die junge Königin von Schottland und Frankreich (00:10:31) Katholizismus vs. Protestantismus (00:13:10) Das Schicksal von Elisabeth I. (00:16:28) Kabale und Liebe (00:19:42) Maria Stuart in englischer Gefangenschaft (00:23:10) Eine kurze Geschichte der Kryptografie (00:30:01) Verschlüsselte Verschwörung (00:32:11) Fazit & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/geschichten-aus-der-mathematik-maria-stuart
Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine bereits zum dritten Mal. Eine Stimme aus dem Protestantismus, die sich von Beginn an für eine primär diplomatische Lösungen aussprach und militärische Zurückhaltung anmahnte, ist die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und hannoverische Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann. Dr. Karin Wollschläger hat mit ihr für "Mit Herz und Haltung" über die aktuelle Friedensinitiative der USA und Auswege aus dem Krieg gesprochen.
“Von Arbeit stirbt kein Mensch. Aber von Ledig- und Müßiggehen kommen die Leute um Leib und Leben; denn der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen” Martin Luther Martin Luther (1483–1546) war ein deutscher Theologe, Mönch und Reformator, der eine zentrale Rolle in der protestantischen Reformation spielte. Er wurde in Eisleben geboren und studierte zunächst Jura, bevor er Mönch im Augustinerorden wurde. Luther erlangte Berühmtheit, als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. In diesen Thesen kritisierte er den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche Gläubigen versprach, durch den Kauf von Ablassbriefen ihre Sündenstrafen zu verkürzen. Er stellte die Autorität des Papstes in Frage und forderte eine Rückkehr zur Bibel als der zentralen Quelle des christlichen Glaubens. Einige der wichtigsten Überzeugungen Luthers waren: Rechtfertigung allein durch den Glauben (sola fide): Luther glaubte, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch gute Werke oder kirchliche Riten gerettet wird. Die Bibel als einzige Autorität (sola scriptura): Er betonte, dass allein die Schrift die Grundlage des Glaubens sein sollte, nicht kirchliche Traditionen oder päpstliche Dekrete. Das Priestertum aller Gläubigen: Luther lehrte, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott habe, ohne die Vermittlung eines Priesters. Seine Ansichten führten zu seiner Exkommunikation durch Papst Leo X. im Jahr 1521 und zu einem Reichstag in Worms, wo er sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Dies führte zur Spaltung der westlichen Kirche in katholische und protestantische Gruppen. Die von ihm inspirierte Bewegung führte zur Gründung der lutherischen Kirchen, einer der wichtigsten Zweige des Protestantismus. Luther übersetzte auch die Bibel ins Deutsche, was die Verbreitung der Heiligen Schrift für Laien erleichterte und die Entwicklung der deutschen Sprache förderte. Luthers Ideen hatten weitreichende Auswirkungen auf Religion, Politik und Gesellschaft in Europa und darüber hinaus. Quelle: ChatGPT Fragen? Schreib an: bibelverse@christliche-gewohnheiten.de
#14 Zitate | Luther - Christus vertreibt den Tod ✝️
“Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod.” Martin Luther Martin Luther (1483–1546) war ein deutscher Theologe, Mönch und Reformator, der eine zentrale Rolle in der protestantischen Reformation spielte. Er wurde in Eisleben geboren und studierte zunächst Jura, bevor er Mönch im Augustinerorden wurde. Luther erlangte Berühmtheit, als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. In diesen Thesen kritisierte er den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche Gläubigen versprach, durch den Kauf von Ablassbriefen ihre Sündenstrafen zu verkürzen. Er stellte die Autorität des Papstes in Frage und forderte eine Rückkehr zur Bibel als der zentralen Quelle des christlichen Glaubens. Einige der wichtigsten Überzeugungen Luthers waren: Rechtfertigung allein durch den Glauben (sola fide): Luther glaubte, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch gute Werke oder kirchliche Riten gerettet wird. Die Bibel als einzige Autorität (sola scriptura): Er betonte, dass allein die Schrift die Grundlage des Glaubens sein sollte, nicht kirchliche Traditionen oder päpstliche Dekrete. Das Priestertum aller Gläubigen: Luther lehrte, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott habe, ohne die Vermittlung eines Priesters. Seine Ansichten führten zu seiner Exkommunikation durch Papst Leo X. im Jahr 1521 und zu einem Reichstag in Worms, wo er sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Dies führte zur Spaltung der westlichen Kirche in katholische und protestantische Gruppen. Die von ihm inspirierte Bewegung führte zur Gründung der lutherischen Kirchen, einer der wichtigsten Zweige des Protestantismus. Luther übersetzte auch die Bibel ins Deutsche, was die Verbreitung der Heiligen Schrift für Laien erleichterte und die Entwicklung der deutschen Sprache förderte. Luthers Ideen hatten weitreichende Auswirkungen auf Religion, Politik und Gesellschaft in Europa und darüber hinaus. Quelle: ChatGPT Fragen? Schreib an: bibelverse@christliche-gewohnheiten.de
“Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und das allerkleinste Geschenk, das Gott dem Menschen geben kann. Darum gibt unser Herrgott gewöhnlich Reichtum den groben Eseln, denen er sonst nichts gönnt.” Martin Luther Martin Luther (1483–1546) war ein deutscher Theologe, Mönch und Reformator, der eine zentrale Rolle in der protestantischen Reformation spielte. Er wurde in Eisleben geboren und studierte zunächst Jura, bevor er Mönch im Augustinerorden wurde. Luther erlangte Berühmtheit, als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. In diesen Thesen kritisierte er den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche Gläubigen versprach, durch den Kauf von Ablassbriefen ihre Sündenstrafen zu verkürzen. Er stellte die Autorität des Papstes in Frage und forderte eine Rückkehr zur Bibel als der zentralen Quelle des christlichen Glaubens. Einige der wichtigsten Überzeugungen Luthers waren: Rechtfertigung allein durch den Glauben (sola fide): Luther glaubte, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch gute Werke oder kirchliche Riten gerettet wird. Die Bibel als einzige Autorität (sola scriptura): Er betonte, dass allein die Schrift die Grundlage des Glaubens sein sollte, nicht kirchliche Traditionen oder päpstliche Dekrete. Das Priestertum aller Gläubigen: Luther lehrte, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott habe, ohne die Vermittlung eines Priesters. Seine Ansichten führten zu seiner Exkommunikation durch Papst Leo X. im Jahr 1521 und zu einem Reichstag in Worms, wo er sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Dies führte zur Spaltung der westlichen Kirche in katholische und protestantische Gruppen. Die von ihm inspirierte Bewegung führte zur Gründung der lutherischen Kirchen, einer der wichtigsten Zweige des Protestantismus. Luther übersetzte auch die Bibel ins Deutsche, was die Verbreitung der Heiligen Schrift für Laien erleichterte und die Entwicklung der deutschen Sprache förderte. Luthers Ideen hatten weitreichende Auswirkungen auf Religion, Politik und Gesellschaft in Europa und darüber hinaus. Quelle: ChatGPT Fragen? Schreib an: bibelverse@christliche-gewohnheiten.de
#12 Zitate | Luther - Glaube ist eine lebendige Zuversicht ✨
“Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Uns solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen” Martin Luther Martin Luther (1483–1546) war ein deutscher Theologe, Mönch und Reformator, der eine zentrale Rolle in der protestantischen Reformation spielte. Er wurde in Eisleben geboren und studierte zunächst Jura, bevor er Mönch im Augustinerorden wurde. Luther erlangte Berühmtheit, als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. In diesen Thesen kritisierte er den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche Gläubigen versprach, durch den Kauf von Ablassbriefen ihre Sündenstrafen zu verkürzen. Er stellte die Autorität des Papstes in Frage und forderte eine Rückkehr zur Bibel als der zentralen Quelle des christlichen Glaubens. Einige der wichtigsten Überzeugungen Luthers waren: Rechtfertigung allein durch den Glauben (sola fide): Luther glaubte, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch gute Werke oder kirchliche Riten gerettet wird. Die Bibel als einzige Autorität (sola scriptura): Er betonte, dass allein die Schrift die Grundlage des Glaubens sein sollte, nicht kirchliche Traditionen oder päpstliche Dekrete. Das Priestertum aller Gläubigen: Luther lehrte, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott habe, ohne die Vermittlung eines Priesters. Seine Ansichten führten zu seiner Exkommunikation durch Papst Leo X. im Jahr 1521 und zu einem Reichstag in Worms, wo er sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Dies führte zur Spaltung der westlichen Kirche in katholische und protestantische Gruppen. Die von ihm inspirierte Bewegung führte zur Gründung der lutherischen Kirchen, einer der wichtigsten Zweige des Protestantismus. Luther übersetzte auch die Bibel ins Deutsche, was die Verbreitung der Heiligen Schrift für Laien erleichterte und die Entwicklung der deutschen Sprache förderte. Luthers Ideen hatten weitreichende Auswirkungen auf Religion, Politik und Gesellschaft in Europa und darüber hinaus. Quelle: ChatGPT Fragen? Schreib an: bibelverse@christliche-gewohnheiten.de
“Das Evangelium macht Christen, aber man siehts ihnen nicht an den Kleidern an, sondern an den Werken der Liebe.” Martin Luther Martin Luther (1483–1546) war ein deutscher Theologe, Mönch und Reformator, der eine zentrale Rolle in der protestantischen Reformation spielte. Er wurde in Eisleben geboren und studierte zunächst Jura, bevor er Mönch im Augustinerorden wurde. Luther erlangte Berühmtheit, als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. In diesen Thesen kritisierte er den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche Gläubigen versprach, durch den Kauf von Ablassbriefen ihre Sündenstrafen zu verkürzen. Er stellte die Autorität des Papstes in Frage und forderte eine Rückkehr zur Bibel als der zentralen Quelle des christlichen Glaubens. Einige der wichtigsten Überzeugungen Luthers waren: Rechtfertigung allein durch den Glauben (sola fide): Luther glaubte, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch gute Werke oder kirchliche Riten gerettet wird. Die Bibel als einzige Autorität (sola scriptura): Er betonte, dass allein die Schrift die Grundlage des Glaubens sein sollte, nicht kirchliche Traditionen oder päpstliche Dekrete. Das Priestertum aller Gläubigen: Luther lehrte, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott habe, ohne die Vermittlung eines Priesters. Seine Ansichten führten zu seiner Exkommunikation durch Papst Leo X. im Jahr 1521 und zu einem Reichstag in Worms, wo er sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Dies führte zur Spaltung der westlichen Kirche in katholische und protestantische Gruppen. Die von ihm inspirierte Bewegung führte zur Gründung der lutherischen Kirchen, einer der wichtigsten Zweige des Protestantismus. Luther übersetzte auch die Bibel ins Deutsche, was die Verbreitung der Heiligen Schrift für Laien erleichterte und die Entwicklung der deutschen Sprache förderte. Luthers Ideen hatten weitreichende Auswirkungen auf Religion, Politik und Gesellschaft in Europa und darüber hinaus. Quelle: ChatGPT Fragen? Schreib an: bibelverse@christliche-gewohnheiten.de
Ein Podcast über die Geschichte des Weihnachtsessens. Gastrosoph Peter Peter erklärt, warum im Dezember der Weg vom Keks zur Gans führen muss. Das Thema:Erklärungsbedarf besteht, denn eigentlich ist nämlich der gesamte Dezember, bis zum 24., ein Fastenmonat für Christen. Erst nach der Messe um Mitternacht durfte nach katholischem Brauch geschlemmt werden, weshalb es heute noch an Heiligabend in manchen Gegenden üblich ist, relativ einfach zu essen – danach aber sollte die Schlemmerei keine Grenzen kennen. Gastrosoph Peter Peter erklärt im Podcast die vielen Ursprünge dieses emotional, sozial und kalorisch überfrachteten Essens. Über machtHungerIn unserer Podcastreihe machtHunger geht es um die Kulturgeschichte des Essens und alle wirtschaftlichen Verstrickungen und politischen Machtspiele, die mit dem Essen und mit kulinarischen Traditionen verbunden sind. macht Hunger ist ein Podcast von Der Pragmaticus. Sie finden uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und X (Twitter).Staffel I macht Hunger I: Nationalgerichte macht Hunger II: Frankreichmacht Hunger III: Italienmacht Hunger IV: Das Schnitzelmacht Hunger V: Globale Küchemacht Hunger VI: Zucker!macht Hunger VII: Slawische Küchemacht Hunger VIII: Jenseits des FleischesStaffel IImacht Hunger I: Die Geschichte der Muskatnussmacht Hunger II: Der lange Weg zum Besteckmacht Hunger III: Weltenlenkerin Kartoffelmacht Hunger IV: Alkohol – Geschichte einer rosaroten BrillemachtHunger V: Salz, Ursprung von fast AllemmachtHunger VI: Ekel: Das Grauen bei Tischmachthunger VII: Wie der Tee drei Mal nach Europa kammachthunger VIII: Es trieft! Eine Geschichte vom FettStaffel III machthunger I: Bittersüß: Die Geschichte der ZitrusfrüchteÜber Peter PeterDer Kulturwissenschaftler Peter Peter ist in der bayerischen Hauptstadt München aufgewachsen, hat in Klassischer Philologie promoviert und ist Autor zahlreicher Bücher über das Reisen und die Kochkulturen dieser Welt (unter anderem verfasste er auch eine Kulturgeschichte des Schnitzels bzw. der österreichischem Küche). Er lehrte an der von Slow Food gegründeten Università delle scienze gastronomiche in Pollenzo und Colorno. Seit 2009 lehrt er für den Masterstudiengang des Zentrums für Gastrosophie der Universität Salzburg das Modul „Weltküchen und Kochsysteme“ und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Sein jüngstes Buch ist den Zitrusfrüchten und Italien gewidmet. Es heißt Blutorangen und ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. macht Hunger ist ein Podcast von Der Pragmaticus. Sie finden uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und X (Twitter).
Queere Ikone, die Europa schockierte: Christina von Schweden
Kultur statt Kinder und ein skandalöser Glaubenswechsel: Christina lebt nach ihren Regeln. Am 17.12.1644 übernimmt sie die Regierung und plant dabei schon ihre Abdankung. Von Marfa Heimbach.
Ab17 - der tägliche Podcast mit Kathrin und Tommy Wosch. Montag bis Freitag. Morgens und AbendsKlick hier für Rabatte und Partner Aktionen: https://bio.to/Ab17shownotesAnfragen wegen Kooperationen oder Werbung gerne an: kontakt@diewoschs.deInstagram: https://www.instagram.com/ab17podcastWhatsapp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaBSCV98kyyQceNs4A1IIn dieser Spezialfolge des Podcasts “Ab 17” dreht sich alles um den Reformationstag und das Leben von Martin Luther. Kathrin und Toni tauchen tief in die Geschichte ein und geben eine humorvolle und detailreiche Einführung in die Reformation, Martin Luthers Leben und seine Lehren. Die beiden Hosts diskutieren unter anderem Luthers Leben als Mönch, seine Theologie und die berühmten 95 Thesen. In humorvoller, teils provokanter Weise werden historische Fakten zu Luthers kritischen Ansichten über die Kirche und deren Ablasshandel erzählt, wobei die beiden auch die Frage stellen, was Buße für Luther bedeutete und wie diese sich von den kirchlichen Praktiken seiner Zeit unterschied.Luther wird als widersprüchliche Figur gezeigt: Ein Mensch mit kontroversen Ansichten, der jedoch auch revolutionäre Gedanken für das damalige Verständnis von Gnade und Buße hatte. Seine Liebesgeschichte mit Katharina von Bora kommt zur Sprache, ebenso wie seine Stellung zu Ehe und Zölibat. Mit historischen Anekdoten und Funfacts beleuchten die Hosts die Bedeutung von Luthers Werk und seiner Schriften für die Reformation und die Entstehung des Protestantismus. Amüsant wird auch sein Faible für das berühmte Einbecker Bier beschrieben und schließlich sein Tod und Vermächtnis reflektiert. Zum Ende diskutieren Kathrin und Toni, was man auch als Nicht-Gläubiger vom Reformationstag mitnehmen kann, und geben Ausblicke auf kommende Folgen, die auch exklusive Inhalte enthalten werden.Inhalt00:00:00 Begrüßung und Einführung in das Thema00:01:26 Erste Diskussion über Martin Luther00:06:24 Luther und die Heilige Anna00:09:44 Luthers Reise nach Rom und ihre Folgen00:14:04 Entstehung und Inhalte der 95 Thesen00:26:55 Luthers Liebesgeschichte mit Katharina von Bora00:36:34 Luthers letzte Worte und Vermächtnis00:40:28 Abschluss und Ausblick auf Special Content Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Die westliche Tradition insgesamt, insbesondere aber der Protestantismus, ist in der Tendenz körpervergessen. Die Gestaltung von Transformationsprozessen benötigt aber einen ganzheitlichen Ansatz und greift zu kurz, wenn Menschen nicht als leibliche Wesen adressiert werden. Tobias Künkler spricht in dieser Folge mit Heidi Braun und Alexander Jasczyk darüber, wie dies geschehen kann. Heidi Braun arbeitet in Süddeutschland in Teilzeit als Mesnerin und ansonsten ehrenamtlich. Sie liebt es Bewegung in die Kirche zu bringen – auch ganz wörtlich. Alexander Jasczyk ist Pfarrer und Lehrer an der Ingeborg-Drewitz Gesamtschule in Gladbeck. Aktuell erprobt er mit einem Team einen spirituellen Fitnesskurs namens „TMS-Training“ (Tiny Monastic Sabatical Training). Shownotes: • Sommerfeld, H. (2016). Mit Gott in der Stadt. Die Schönheit urbaner Transformation. Transformationsstudien Band 8. Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlungen. • Bosch, D. J. (2001). A Spirituality of the Road. Cambridge. • Dhar N, Chaturvedi SK, Nandan D. (2013). Spiritual health, the fourth dimension: a public health perspective. WHO South-East Asia J Public Health. S. 2:3-5 • Knoblauch, H. (2004). Die Soziologie der religiösen Erfahrung. In Ricken, F. (Hrsg.). Religiöse Erfahrung: ein interdisziplinärer Klärungsversuch (S. 69-80). Stuttgart. • Faix, T., & Reimer, J. (Hrsg.). (2012). Die Welt verstehen: Kontextanalyse als Sehhilfe für die Gemeinde. Marburg: Francke • Kusay-Merkle, U. (2018), Agiles Projektmanagement im Berufsalltag Für mittlere und kleine Projekte. Berlin. • Kurz, B. und Kubek, D. (2018). Kursbuch Wirkung. Das Praxisbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen. Berlin. • Rosa, H. (2005), Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt a.M. • Karle, I. (2014). Liebe in der Moderne. Körperlichkeit, Liebe und Sexualität. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. • Nymoen, O. & Schmitt, W. M. (2021). Influencer. Die Ideologie der Werbekörper. Berlin: Suhrkamp. • Riemen, Rob (2010). Der Adel des Geistes. Ein vergessenes Ideal. München: Siedler Verlag. • https://wanneparcours.jimdosite.com/ • https://www.ekd.de/kirche-und-sport-48549.htm • https://www.neuenarrative.de/
#243 Lise Meitner – Kernphysikerin und Pionierin der Radiochemie
Bestimmt hat jede/r von euch diesen Namen schon einmal gehört – z.B. in einem Schulnamen oder weil eine Straße nach ihr benannt wurde.Aber wusstet ihr, dass Lise Meitner zu den bedeutendsten Naturwissenschaftler*innen des 20. Jahrhunderts zählt? Und dennoch hat man ihr jahrzehntelang den Nobelpreis verwehrt, obwohl sie immer und immer wieder dafür nominiert worden war. Dabei war sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Kernspaltung entdeckt wurde. 1878 in Wien als Kind jüdischer aber dem Protestantismus zugewandter Eltern geboren, zeigte sich bei Lise schon früh die Leidenschaft für Naturwissenschaften. Und das in einer Zeit, in der Mädchen offiziell wenig Zugang zu Bildung bekamen. Die wurde aber von Haus aus sehr gefördert, weswegen sich Lises Leidenschaft auch entfalten konnte. Mit Ehrgeiz und viel Disziplin kämpfte sie sich bis zum Physikstudium – sie war die zweite Frau in Österreich überhaupt – und bis zu dessen Abschluss, der Doktorinnentitel folgte bald darauf. Es trieb Lise in die Forschung und nach Berlin, wo sie mit Otto Hahn arbeitete. Es sollten turbulente Zeiten folgen, zwei Weltkriege, Flucht und … die oben erwähnte Entdeckung der Kernspaltung. Wie das alles kam und warum die unzähligen Schulnamensnennungen nicht die verwehrte Anerkennung aufwiegen können: Das erfahrt ihr in dieser Folge von Starke Frauen über eine Frau, die die Welt veränderte.Quellen (Auswahl):https://www.swr.de/swrkultur/wissen/archivradio/lise-meitner-frauen-in-der-wissenschaft-100.htmlhttps://www.knerger.de/html/meitnerlwissenschaftler_36.htmlhttps://www.deutschlandfunk.de/vor-50-jahren-gestorben-die-physikerin-lise-meitner-100.htmlhttps://www.zeit.de/1996/26/Im_Schatten_des_Kollegen/komplettansichthttps://taz.de/Frauen-in-der-Naturwissenschaft/!5982128/https://www.stern.de/panorama/wissen/geschichte/lise-meitner-war-49-mal-fuer-den-nobelpreis-nominiert---und-ging-immer-leer-aus-33108060.htmlhttps://www.derstandard.de/story/2000088285151/die-verlorene-ehrung-der-lise-meitner Team:Hosts: Kim Seider und Cathrin JacobRedaktion: Cathrin JacobScriptarbeit: Daniel JacobSchnitt: Eva RaabeAlle Informationen zu unserem Podcast, Episoden, unseren Workshops etc. findet ihr auf unserer Website: Podcaststarkefrauen.de Schreibt uns gern, schickt uns Feedback, teilt, liked, ihr wisst doch Bescheid!Photo Credit: © Österreichische Zentralbibliothek für Physik & Fachbereichsbibliothek Chemie#fraueninmint #physikerin #lisemeitner #sheroes Möchtest Du Cathrin oder Kim auf einen Kaffee einladen und dafür die Episoden werbefrei hören? Dann klicke auf den folgenden Link: https://plus.acast.com/s/starke-frauen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Ein noch wenig aufgearbeitetes Thema ist der Umgang der katholischen Kirche mit dem aufkeimenden Protestantismus. Am kommenden Sonntag, 15. September, lädt die evangelische Kirche Wien zu einem Gedenktag für den evangelischen Märtyrer Caspar Tauber ein. Der angesehene Tuchhändler war von den Schriften Martin Luthers begeistert und begann darüber zu predigen. Es kostet ihn das Leben. Am 17. September 1524 wurde er enthauptet. In mehreren Stationen wird am 15. September seiner gedacht. Den Abschluss des Tages bildet ein Theatergottesdienst in der Pauluskirche. Hören Sie dazu im Beitrag die Musikerin, Schauspielerin und Regisseurin Friederike von Krosigk. Musikausschnitt: "Love divided" von Philipp Glass (Flöte: Annegret Bauerle, Klavier: Sybille v. Both) Gestaltung: Veronika Bonelli
In dieser Folge zu hören sind: Gast: Annika Brockschmidt Moderation: Oliver Rautenberg alias Anthroblogger Aus dem Team #ExWaldi: Sarah, Katharina Technik: Steffen In dieser Folge unterhalten wir uns über Religion, die amerikanische christliche religiöse Rechte und die thematischen Überschneidungen und Parallelen zur anthroposophischen Lehre. Content-Notes: Content Note für die gesamte Folge: Wir thematisieren in der gesamten Folge u. a. Transfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Ableismus, christliche Religion und die christliche religiöse Rechte. Wir benennen dabei auch diskriminierende Begriffe sowie trans- und queerfeindliche Narrative. Steiner im Original: 04:12 - 05:20 (Aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat) Queer- und Transfeindlichkeit der christlichen religiösen Rechten und der Anthroposophie: 48:09 - 52:20 Mutter Theresas Menschenfeindlichkeit, Benennung anthroposophischer Konzepte: 52:25 - 55:20 Sexismus: 56:16 - 59:50 Wir reden über 00:00:00 Prolog 00:01:35 Intro 00:05:10 Aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat zur Religiosität 00:06:40 Rekrutierung und Missionierung von Kindern durch die religiöse Rechte in den USA 00:10:40 Religiosität im Alltag an der Waldorfschule 00:19:50 Christengemeinschaft, Exkurs: Epochenunterricht 00:29:55 Religionsunterricht als Pflichtfach, Heiligenlegenden 00:32:20 Privatschulen, Schulwahl der Eltern und Schulgemeinschaft 00:43:45 Parallelen zur religiösen Rechten, insbesondere Geschlechterbilder 00:48:40 Geht die Transfeindlichkeit der christlichen religiösen Rechten mit einem steinerschen Weltbild zusammen? 00:53:00 Scheinbar empathische Weltbilder, die eigentlich unmenschlich sind 00:56:10 Reaktionäre Geschlechterbilder, rosig verkauft 01:00:40 Anthroposophie zum Rosinenpicken, Steiner als “Kind seiner Zeit” 01:03:55 Evolutionstheorie, Dinosaurier und Fabelwesen 01:10:40 Menschengemachter Klimawandel und Wissenschaftsfeindlichkeit 01:17:20 Impfgegnertum und Verschwörungsglauben, Tarnformulierungen, Doppelsprech 01:25:10 Wünsche für die Zukunft 01:31:50 Wortsalat - Das Zitat in seinem Zusammenhang Zu Annika Brockschmidt: Annika Brockschmidt ist eine deutsche Journalistin, Autorin und Podcast-Produzentin. In ihrem Buch “Amerikas Gotteskrieger: Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet” beschäftigt sie sich mit der evangelikalen Bewegung in den Vereinigten Staaten. Ihr aktuelles Buch: “Die Brandstifter. Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen” erschien am 26. Februar 2024. Webseite: https://www.rowohlt.de/autorin/annika-brockschmidt-18251 Twitter und Instagram: @ardenthistorian Podcasts: Kreuz und Flagge Feminist Shelf Control Der Bätchcast Weiterführende Links und Anmerkungen Literatur: Helmut Zander: Die Anthroposophie. Rudolf Steiners Ideen zwischen Esoterik, Weleda, Demeter und Waldorfpädagogik. Paderborn 2019. https://brill.com/display/title/53491 Christengemeinschaft/Christentum: S. 61 - 73 Protestantismus - Katholizismus: S. 189 - 192 Rudolf Steiners Religiosität: Rudolf Steiner war katholisch getauft, seine Jugend war aber kaum vom Katholizismus geprägt. Helmut Zander bezeichnet die Anthroposophie als “ein Kind des Protestantismus”. Seine erste tiefergehende religiöse Sozialisation erhielt Rudolf Steiner laut Zander bei dem Protestanten Karl Julius Schröer. (Zander, Die Anthroposophie, S. 189.) Auch die Christengemeinschaft wurde mehrheitlich von Protestant*innen begründet, wobei die sieben Sakramente der katholischen Kirche übernommen wurden. (Zander, Die Anthroposophie, S. 61.) Die Waldorf-Zeitschrift “Erziehungskunst” über Religionsunterricht an der Waldorfschule: https://www.erziehungskunst.de/artikel/religion-ist-so-alt Die pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen über den freien (auch: freichristlichen) Religionsunterricht an Waldorfschulen https://www.forschung-waldorf.de/service/downloadbereich/detail/lehrplan-fuer-den-freien-religionsunterricht-an-waldorfschulen/ Novalis war laut Steiner eine Inkarnation von Raffael, Johannes des Täufers, des Propheten Elias und von Pinchas ben Eleasar: https://anthrowiki.at/Johannes_der_T%C3%A4ufer#Fr%C3%BChere_und_sp%C3%A4tere_Inkarnationen Die Christengemeinschaft ist nicht Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK). (Zander, Die Anthroposophie, S. 68.) Die Taufe der CG, die als Inkarnationshilfe verstanden wird, wird von der EKD und der katholischen Kirche nicht anerkannt: https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/anthroposophie-und-christengemeinschaft/ Selbstbild der Christengemeinschaft: https://christengemeinschaft.de/hintergruende/die-christengemeinschaft Die Christengemeinschaft fühlt sich als Teil der Ökumene: https://christengemeinschaft-international.org/wer-wir-sind/faq Annika erwähnt R. J. Rushdoony (Rshtuni), einen Vordenker der amerikanischen religiösen Rechten: https://en.wikipedia.org/wiki/R._J._Rushdoony https://en.wikipedia.org/wiki/The_Institutes_of_Biblical_Law Theonomie: https://de.wikipedia.org/wiki/Theonomie Waldorfpädagogische Sicht auf “zu frühes Lesenlernen”: “Frühes Lesenlernen schadet der Gesundheit”, Steinerzitate über “Sklerotiker” durch angeblich zu frühes Lesenlernen und das optimale Alter zum Schreiben- und Lesenlernen: “Lesen und Schreiben, so wie wir es heute haben, ist eigentlich erst etwas für den Menschen … im 11., 12. Lebensjahre. Und je mehr man damit begnadigt ist, kein Lesen und Schreiben vorher fertig zu können, desto besser ist es für die späteren Lebensjahre.” https://www.waldorfkindergarten.de/en/paedagogik/erziehungskunst-fruehe-kindheit/artikel/wenn-kinder-spaeter-lesen-lernen/ GA 302, 8. Vortrag vom 19. Juni 1921: Rudolf Steiner über das Lesen- und Schreibenlernen: “Wir können nicht sagen: Seid froh, daß euer Junge mit 9 Jahren noch nicht lesen und schreiben kann. Er wird um so besser lesen und schreiben, wenn er es mit 9 Jahren nicht gekonnt hat; denn wenn er mit 9 Jahren wunderschön schreiben und lesen kann, dann wird er später ein Automat, weil dem Menschen etwas Fremdes eingeimpft worden ist. Er wird ein Automat. Diejenigen werden aber Vollmenschen, die noch etwas entgegengestellt haben in ihrer Kindheit dem Lesen und Schreiben.” (S. 130f.) https://steiner.wiki/GA_302#ACHTER_VORTRAG_Stuttgart,_19._Juni_1921 Anthroposophische Evolutionsleugnung mit eigenem Institut in Witten-Herdecke: https://www.uni-wh.de/gesundheit/department-fuer-humanmedizin/lehrstuehle-institute-und-zentren/institut-fuer-evolutionsbiologie/ Studie: Anthroposophic Climate Science Denial https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20503032221075382 Oliver Nachtwey, Nadine Frei u. a.: Quellen des “Querdenkertums”. Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg. https://www.boell-bw.de/de/2021/11/19/quellen-des-querdenkertums-eine-politische-soziologie-der-corona-proteste-baden Rudolf Steiner in “Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände“ (GA 347, S.123ff.) über Ichthyosaurier (auch Fischsaurier genannt) https://anthroposophie.blog/2015/08/30/fliegende-fischsaurier-frassen-selige-elektrische/ Rudolf Steiner über ausgeschiedene Tiere: “Der Mensch hatte noch alle anderen Wesen in sich. Nachher entwickelte sich der Mensch höher hinauf und ließ die Fischform zurück, die er in sich hatte. [...] Wieder entwickelte sich der Mensch höher hinauf und sonderte die Vögel aus sich heraus. Dann gingen die Reptilien und Amphibien aus dem Menschen heraus, groteske Wesen wie die Saurier, Fischeidechsen, die eigentlich nur Nachzügler der früher zurückgebliebenen, noch menschenunähnlicheren Wesen waren. Dann noch später setzte der Mensch die Säugetiere heraus. Zuletzt stieß er die Affen ab und ging selbst höher hinauf.” (GA 95, S. S. 76: https://steiner.wiki/GA_95#Achter_Vortrag,_Stuttgart,_29._August_1906) auch S. 157 (mit Abbildung) Das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat Quelle: Erziehung zum Leben. Selbsterziehung und pädagogische Praxis, GA 297a, S.81f https://steiner.wiki/GA_297a#FRAGENBEANTWORTUNG_AM_P%C3%84DAGOGISCHEN_ABEND_Darmstadt,_28._Juli_1921
Folge 40 - Ziemlich sonderbare Freunde Teil II - Polygamie, Testosteron und neue Netzwerke
Was ist der Unterschied zwischen einer polygamen und einer monogamen Gesellschaft? - Jede Menge Testosteron. Denn sobald die ranghöchsten 10 Prozent der Männer mehrere Ehefrauen haben, gehen 30 bis 40 Prozent der Männer leer aus, sind frustriert und bleiben stets im Wettbewerb. Aber auch für alle anderen läuft der Wettbewerb weiter: man könnte ja durch eine weitere Ehefrau den Status verbessern. Kein "Ende einer langen Reise". Das Testosteronlevel bleibt hoch und damit das Konkurrenzdenken. In einer monogamen Gesellschaft hingegen sind die Chancen gleicher verteilt. Sobald man verheiratet ist, ist der Wettbewerb vorbei: man kann die Ressourcen in die Kinder stecken. Das ist gut für die Gesellschaft als Ganze. Wie die Demografie das Denken und Handeln historisch geprägt hat, als die europäischen Gesellschaften monogam wurden, erfahrt ihr im zweiten Teil der Folge. Die Familienbande wurden schwächer, dafür taten sich die Menschen in Städten, Universitäten, Klöstern und Zünften zusammen. Sie wurden mobiler und fanden sich in großen, unpersönlichen Netzwerken, in denen im Guten wie im Schlechten neue Ideen sehr schnell heranwachsen konnten. Übrigens: es gibt auch polyandrische Gesellschaften, also solche, in denen eine Ehefrau mehrere Ehemänner hat. In welcher spezifischen Konstellation das üblicherweise funktioniert, erfahrt ihr im Funfact. Diese Folge ist Teil 2 der Zusammenfassung von "Die seltsamsten Menschen der Welt - Wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde" von Joseph Henrich. Viel Spaß beim Zuhören :-) (0:00) Einleitung (3:02) Die Veränderung unserer Psyche durch die Monogamie (10:01) Die natürliche Zusammenlebensform: Monogamie oder Polygamie? (15:32) Die Herausforderung einer polygamen Gesellschaft (18:20) Testosteron und seine Auswirkungen (20:51) Die Vorteile einer monogamen Gesellschaft (23:14) Polyandrie: Eine alternative Form der Vielehe (26:46) Mobilität und Strukturwandel in Europa (28:42) Wachstum und Herausforderungen in Städten (32:38) Städtische Selbstverwaltung und politische Macht (34:47) Städte als Zentren des Vertrauens und Wohlstands (37:21) Aufstieg des Westens: Innovation und Vernetzung (39:53) Lehrlingsausbildung und Wissenstransfer in Europa (43:00) Protestantismus und Bildungsförderung (45:45) Veränderungen in Südkorea und weltweite Adoption westlicher Familienstrukturen (47:47) Zusammenfassung und Ausblick: Einfluss des Ehe- und Familienprogramms
Serra Tavsanli: Johann Sebastian Bach und seine «Welt-Musik»
Er galt als der fünfte Evangelist des deutschen Protestantismus und ist doch längst ein universaler Komponist. Die Musik von Bach fasziniert heute Menschen in allen Teilen der Erde – egal, ob und wie sie religiös geprägt sind. Ein Beispiel dafür ist die aus der Türkei stammende und heute in Deutschland lebende Pianistin Serra Tavsanli. Schon als Kind begegnete sie in Istanbul Bachs Musik – dies sollte ihrem Leben eine unvorhergesehene Richtung geben. Ein Gespräch über die grenzüberschreitende Kraft geistlicher Musik. Als sie fünf Jahre alt war, schenkten ihr die (armenischen) Nachbarn ein Klavier, und ihre westlich eingestellten Eltern förderten sie bei ihren ersten Schritten in die klassische Musik. Eine Welt öffnete sich. Von entscheidendem Einfluss war Johann Sebastian Bach und ist es bis heute geblieben. Als Serra Tavsanli mit 19 Jahren an die Musikhochschule Hannover kam, lernte sie das weite Repertoire klassischer Klaviermusik kennen, aber Bach blieb für sie die Leitfigur. Inzwischen hat sie ihm drei Alben gewidmet. Das neue trägt den Titel «Inner Spaces». Denn es sind innere Räume, die seine Musik ihr geöffnet hat. So regelgeleitet seine Kompositionen erscheinen mögen, lassen sie der Interpretin doch sehr viel Freiheit, aus ihr etwas unverwechselbar Eigenes zu machen. Vielleicht ist dies das Geheimnis seiner weltweiten Wirkung. Denn so sehr Bach selbst Teil einer bestimmten, nationalen und konfessionellen Geschichte – eben des deutschen Protestantismus des 18. Jahrhunderts – gewesen war, ist er längst ein Welt-Komponist, der heute in Japan, Malaysia, Südafrika oder Südamerika Menschen verzaubert und dazu bringt, seine Werke aufzuführen. Das liegt sicherlich an der unsterblichen Qualität seiner Musik, aber auch an der Freiheit, die sie eröffnet. Das gilt auch für ihren religiösen Gehalt. Bachs geistliche Musik ist nicht auf den engen Bereich eines alten Luthertums beschränkt, sondern kann heute auch Menschen mit ganz anderen religiösen Prägungen. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist Serra Tavsanli.
Warum nicht alle Christen dieselben Feiertage haben
Wie erkläre ich’s meinem Kind? (Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ)
Gerade hatten die Menschen in manchen Teilen Deutschlands einen Tag frei, andere müssen einfach weiter in die Schule und zur Arbeit, als wäre nichts. Das hat mit Unterschieden zu tun, die am Fronleichnamsfest gut zu sehen sind.
Fromm und fleißig. Protestantismus, Pietismus und Kapitalismus
TO Artikel von Dr. Matthias Deuschle aus der Ausgabe 204 zum Thema Arbeit.
#163 Im Niedergang begriffen? Die Kirche in Schweden
Noch Anfang der 1970er Jahre waren 95% aller Schwedinnen und Schweden Mitglied der Svenska Kyrkan, der schwedisch-lutherischen Kirche. Heute sind es nur noch knapp über die Hälfte. Wie in vielen anderen Ländern Europas auch, hat die Kirche in Schweden schon bessere Zeiten gesehen. Bis 2000 war sie noch Staatskirche, jetzt wird sie eher als kulturelles Erbe oder als soziale Einrichtung angesehen. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass die Kirche in Schweden eine Staatskirche wurde? Wie viele Menschen besuchen heute noch regelmäßig den Gottesdienst? Und: Ist der Katholizismus in Schweden tatsächlich so abgeschrieben, wie es auf den ersten Blick scheint? Das sind nur einige Fragen, auf die wir in dieser Episode Antworten suchen. Hör gerne rein! Du willst Elchkuss unterstützen? Dann besuche uns bei Steady: https://steadyhq.com/de/elchkuss-schweden-entdecken/about Falls bei dir die Shownotes nicht angezeigt werden, dann findest du sie auf jeden Fall bei Podigee: https://elchkuss.podigee.io/
"Obwohl ich evangelisch lutherischer Christ bin, finde ich Ihre Sendung ausgezeichnet gut. Auch wenn ich nicht immer Ihre Meinung teilen kann, so habe ich doch häufig geistlichen Gewinn dabei" (Zuschrift).Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Kanäle von K-TV: Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ Mediathek: https://kathtv.org/Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktv.app&hl=de iOS App: https://apps.apple.com/de/app/k-tv-katholisches-fernsehen/id1289140993
Gefährdet Ökumene die eigene kirchliche Identität?
"Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt: Wer nur England kennt, kennt England nicht (...): Man kennt die eigene Kirche so lange nicht, als man nur die eigene Kirche kennt" (Kurt Kardinal Koch).Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Kanäle von K-TV: Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ Mediathek: https://kathtv.org/Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktv.app&hl=de iOS App: https://apps.apple.com/de/app/k-tv-katholisches-fernsehen/id1289140993
"Die große Schwierigkeit besteht heute darin, dass wir uns in vielen Fragen einig geworden sind, aber keine gemeinsame Vorstellung haben, was eigentlich das Ziel der Ökumene sein soll" (Kurt Kardinal Koch). Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Kanäle von K-TV: Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ Mediathek: https://kathtv.org/Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktv.app&hl=de iOS App: https://apps.apple.com/de/app/k-tv-katholisches-fernsehen/id1289140993
Ungeschönte Erinnerungskultur – "Das protestantische Berlin im Dritten Reich" von Manfred Gailus – Gespräch mit Uwe Kullnick – Hörbahn on Stage
Im Bann des Nationalsozialismus: Das protestantische Berlin im Dritten Reich von Manfred Gailus – Gespräch mit Uwe Kullnick – Hörbahn on Stage Lesung Manfred Gailus (Hördauer 11 Minuten) Gespräch zwischen Manfred Gailus und Uwe Kullnick (Hördauer 69 Minuten) Loblieder über Bonhoeffer und Niemöller sind zur Genüge gesungen worden. Hier wird die Geschichte des ganzen Protestantismus im Dritten Reich am Beispiel der Hauptstadtkirche erzählt. Das war keine Erfolgsgeschichte. Mittäterschaft mit dem NS-Regime in Gestalt der antisemitischen Deutschen Christen, Kollaboration mit NSDAP und NS-Staat, viel Anpassung und wenig Widerstand – so stellt sich das Gesamtbild dar. Der heftige Kirchenkampf zerriss den Großstadtprotestantismus in zwei feindliche Lager – Deutsche Christen und Bekennende Kirche –, die sich einen verbissenen »Bruderkampf im eigenen Haus« lieferten. Dabei drangen NS-Ideen tief in die alte Kirche ein und formten sie im völkischen Sinn um. Nur wenige Männer und Frauen opponierten. Nicht wenige Pfarrer bejubelten schließlich Hitlers Eroberungskrieg. Das Schlusskapitel beschreibt den hilflosen Umgang der Nachkriegskirche mit einer weithin beschwiegenen und verdrängten Vergangenheit. Kurz: ein schweres protestantisches Erbe, dessen Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen ist. Manfred Gailus, Prof. Dr., geb. 1949, studierte Bildende Künste in Nürnberg und Düsseldorf und Geschichte und Politische Wissenschaften an der FU Berlin. 1988 promovierte er über sozialen Protest in der Revolution von 1848/49, 1999 folgte die Habilitation an der TU Berlin über Protestantismus und Nationalsozialismus am Beispiel Berlins. Seit 2006 ist Gailus apl. Professor für Neuere Geschichte an der TU Berlin, zuletzt am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Tontechnik Jupp Stepprath Moderation, Redaktion und Realisation Uwe Kullnick Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch diesen. Hörbahn on Stage - live im Pixel am Gasteig - Literatur und Ihre Autor*innen im Gespräch - besuchen Sie uns! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hoerbahn/message
«Protestantismus» hatte von Beginn an auch mit «Protest» zu tun. Das gilt auch für die Gegenwart der ökologischen Krisen und Konflikte. Wie soll die evangelische Kirche hier Stellung beziehen? Was kann sie für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tun? Was wäre ihr unverwechselbarer Beitrag? Ein Gespräch mit Anna-Nicole Heinrich, der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Zwischen Bibeltreue und Kritik – Was Pietisten in Württemberg bewegt
Sie sind tiefgläubig und engagiert: Pietistinnen und Pietisten haben im württembergischen Protestantismus eine lange Tradition. Dabei stoßen sie nicht immer auf Verständnis.
Sternengeschichten Folge 547: Michael Stifel und der Weltuntergang
Den Weltuntergang vorhersagen und trotzdem ein bedeutsamer Wissenschaftler werden? Das geht, zumindest dann, wenn man der mittelalterliche Mathematiker Michael Stifel ist! Alles dazu erfahrt ihr in der neuen Folge der Sternengeschichten. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das hier tun: Mit PayPal (https://www.paypal.me/florianfreistetter), Patreon (https://www.patreon.com/sternengeschichten) oder Steady (https://steadyhq.com/sternengeschichten)
Rivalinnen bis in den Tod: Elisabeth I. vs. Maria Stuart
Zum Ende des 16. Jahrhunderts befindet sich Europa in einer Zeit des Umbruchs. Auf dem Kontinent kämpfen Spanien und Frankreich um die Vorherrschaft, und auf der britischen Insel kämpfen England und Schottland nicht nur um die Krone, sondern auch um die wahre Religion: Katholizismus oder Protestantismus? Im Zentrum stehen dabei zwei Frauen: die englische Königin Elisabeth I. und die schottische Königin Maria Stuart. Ihr Streit wird ein grausames Ende finden.
Sie war eine unangepasste Frau mit einem großen Herzen. Dorothee Sölle war eine der ersten Frauen in der protestantischen Kirche Deutschlands, die sich offensiv zum Feminismus bekannte und Ökologie zum Thema machte. Autorin: Heide soltau Von Heide Soltau.
Verhaftung des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer (am 05.04.1943)
Nach ihren größten Idolen befragt, nannte vor wenigen Jahren noch mehr als jeder zehnte Deutsche Dietrich Bonhoeffer. Kein anderer Theologe des 20. Jahrhunderts ist heute noch so vielen Menschen ein Begriff, weil er seinen christlichen Glauben konsequent durchdacht und gelebt hat - bis zum Tod im Konzentrationslager. Autor: Uwe Schulz Von Uwe Schulz.
Ein Leben nach der Bergpredigt - Die Hutterer
Als täuferische Bewegung waren die Hutterer immer wieder Verfolgungen ausgesetzt und mussten fliehen. In Kanada fanden die Tiroler, die die Erwachsenentaufe und Gütergemeinschaft praktizieren, eine neue Heimat. Ohne Einschränkungen führen sie dort ein einfaches und gottgefälliges Leben – mit wenigen Zugeständnissen an den technischen Fortschritt.
Tausende Soldaten standen vor der Stadt, starteten immer neue Angriffe - doch La Rochelle gab nicht auf. Eine der letzten protestantischen Städte Frankreichs überstand die spektakuläre Belagerung von 1573 - und musste sich erst beim nächsten Versuch über 50 Jahre später ergeben. Autor: Herwig Katzer Von Herwig Katzer.
Rettung als Christenpflicht? Die evangelische Kirche und eine ewige Debatte
Die evangelische Kirche beteiligt sich seit zwei Jahren an Missionen zur Seenotrettung und stellte kürzlich einen Millionenbetrag für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Sie will eine flüchtlingsfreundliche Kirche sein – denn die Rettung und Aufnahme Geflüchteter sei eine Christenpflicht. Doch ein Blick in die Flüchtlingsdebatten vergangener Jahrzehnte zeigt, der Protestantismus war sich hier nie einig. Und die Gegenwart stellt die evangelische Kirche zudem vor eine große Herausforderung: Wie können Christen ihrer Pflicht angesichts der vielfältigen Krisen in der Welt noch gerecht werden?
Max Weber und der Geist des Kapitalismus (2012)
Unser Staffelfinale. Wieso ist unser Lebenslauf so stark von Arbeit und Beruf geprägt? Der große Soziologe Max Weber weiß es. (2012) Wieso ist unser Lebenslauf so stark von Arbeit und Beruf geprägt? Führten die frühen Jäger- und Sammlerkulturen vielleicht ein angenehmeres Dasein als der moderne Berufsmensch? Warum werden arbeitslose Hartz 4 Empfänger und Obdachlose eines geringeren sozialen Status bedacht als mancher Kriminelle? Wieso befinden sich viele Menschen der Moderne und Postmoderne in einer Sinnkrise? Welche Rolle spielt dabei die Religion? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute den Max-Weber-Experten Diego Compagna eingeladen. Denn in Webers soziologischem Klassiker finden wir einige interessante Antworten. Der Soziologe, Jurist und Ökonom Max Weber (1864 -- 1929), wurde mit seiner Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" zum Star weit über seine Fachgrenzen hinaus. Weber gehört zu den Gründungsvätern der Soziologie und seine Theorie zur Entstehungsgeschichte des modernen Kapitalismus zu jeder ordentlichen Allgemeinbildung auch von Nicht-Soziologen. In seinem Werk stellt Weber die These auf, dass die Eigenheit des Protestantismus, seine Schäfchen zu fleißiger und lustfeindlicher Arbeit anzuspornen, dem modernen Kapitalismus erst zur Blüte getrieben und den Typus des modernen Berufsmenschen herausgebildet hat. Musik: https://www.youtube.com/watch?v=fHbzB43hggo&ab_channel=AudioLibrary%E2%80%94Musicforcontentcreators