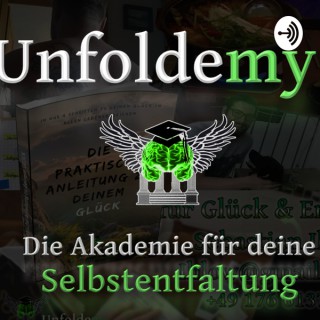Podcasts about therapieoption
- 38PODCASTS
- 42EPISODES
- 32mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jun 17, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about therapieoption
Latest podcast episodes about therapieoption
Journal Club Folge 48 (KW 25): Joint-Statement zur prähospitalen Periarrest-Thorakotomie nach Trauma
Send us a textDie prähospitale Periarrest-Thorakotomie beim traumatisch bedingten Kreislaufstillstand ist seit einiger Zeit als eine weitere Therapieoption in den Fokus der interprofessionellen Diskussion gerückt - die inhaltlichen Positionen in der Diskussion sind dabei kontrovers. In dieser Woche diskutieren Prof. Erik Popp, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie am UKHD und Leiter der Sektion Notfallmedizin, und ich das Joint-Statement 8 verschiedener Fachgesellschaften plus die zugehörige Stellungnahme der DIVI zur prähospitalen Periarrest-Thorakotomie nach Trauma, erschienen in Notfall & Rettungsmedizin: Störmann P. Joint-Statement zur prähospitalen Periarrest-Thorakotomie nach Trauma. Notfall Rettungsmed (2025), published online 06.05.2025 https://doi.org/10.1007/s10049-025-01550-3
In dieser Episode des Podcasts "Der Schmerzcode" besprechen Jan-Peer und Marco die facettenreiche Anwendung von medizinischem Cannabis und beleuchten dabei verschiedene therapeutische Ansätze, die aus der Kombination von THC und CBD resultieren. In einem umfassenden Dialog reflektieren sie die Entwicklungen im Umgang mit Cannabis als Therapieoption zur Behandlung chronischer Schmerzen und anderer spezifischer Erkrankungen. Sie erörterten die aktuellen Anwendungsgebiete für Cannabinoide, darunter chronische Schmerzen, neuropathische Schmerzen, Multiple Sklerose und deren spastische Begleiterscheinungen. Jan-Peer diskutiert eingehend, wie Cannabis bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wie PTSD und Angsterkrankungen helfen kann. Gemeinsam untersuchen sie auch die Rolle von CBD in der Selbstbehandlung von Schlafstörungen und die variierenden Wirkungsweisen in Bezug auf die Schlafarchitektur. Im Gespräch mit Dr. Richard Pecka, einem erfahrenen Schmerztherapeuten, wird das Thema Cannabistherapie weiter vertieft. Richard bringt den Zuhörern praxisnahe Einblicke und erläutert das komplexe Wechselspiel zwischen Cannabinoiden und den endogenen Rezeptoren im menschlichen Körper. Er gibt wertvolle Ratschläge zur Schmerzlinderung, betont jedoch die Notwendigkeit kontrollierter Dosierung und individueller Anpassung, um unerwünschte Nebenwirkungen zu minimieren. Steffen, ein Patient mit jahrelanger Erfahrung in der Anwendung von THC zur Schmerzbehandlung, teilt seine persönliche Geschichte und die Herausforderungen, die er bei der Integration von Cannabis in seine Behandlung erlebt hat. Er spricht offen über Nebenwirkungen, die die kognitiven Fähigkeiten betreffen, und die Bedeutung einer fundierten ärztlichen Begleitung in der Therapie. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Podcast nicht nur die wissenschaftlichen Aspekte medizinischer Cannabinoide thematisiert, sondern auch einen tieferen Einblick in die praktischen Herausforderungen und ethischen Fragestellungen bietet, die mit der Verschreibung und Anwendung von Cannabinoiden verbunden sind. Die Episode fordert dazu auf, über die bisherigen Grenzen der Schmerztherapie hinauszudenken und Potenziale der Cannabistherapie zu erkunden.
#33 - Die Wahrheit über Omega-3 und eine neue Therapieoption bei Neurodermitis
Sie haben sicherlich schon öfters gehört oder gelesen, dass der menschliche Organismus aus pflanzlichen Omega-3 Säuren kein Fischöl – auch EPA und DHA genannt – herstellen kann. Das INUMED Science Team konnte das bereits im Jahr 2019 mit einer Studie widerlegen. Doch was nützt uns diese neue Erkenntnis? Eine Folgestudie, durchgeführt von einer renommierten Dermatologin, konnte kürzlich daraus eine innovative und signifikant wirksame Therapie für Neurodermitis, Atopische Dermatitis und hochwahrscheinlich auch noch einige andere Erkrankungen ableiten. Erfahren Sie in dieser Folge der INUMED-Sprechstunde alles über dieses Thema. _ DAS MILIEU IST DER SCHLÜSSEL ZUR GESUNDHEIT _ www.INUMED.at www.NUTRIBIOTICUM.com _ Die Empfehlungen in diesem Podcast sind auf dem neuesten Stand der ernährungs- und sportmedizinischen Wissenschaft sie ersetzen jedoch im Krankheitsfall nicht die ärztliche Konsultation. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte einen erfahrenen Ernährungs- oder Ganzheitsmediziner.
Episode #20 / Biosimilars als Therapieoption bei CED
DarmTalk - Dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
Diesmal ist der DarmTalk erneut in Linz, am Kepler Universitätsklinikum zu Gast. Unser Gesprächspartner ist Univ.-Prof. Dr. Alexander Moschen. Alexander Moschen ist seit dem Jahr 2020 Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Seine Spezialgebiete sind die Gastroenterologie und Hepatologie – die Behandlung von Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen nimmt dabei einen wesentlichen Platz in seiner beruflichen Praxis ein. Übrigens: Zuletzt haben wir mit Alexander Moschen in unserer 3. Podcast-Episode, also gleich zum Beginn des DarmTalks, über die aktuellen, medizinischen Erkenntnisse in der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gesprochen. Hört doch gerne mal rein! In der aktuellen Episode gehen wir ein bisschen tiefer ins Thema und wollen das Augenmerk auf den Einsatz von sogenannten Biosimilars - in der Therapie von CED-PatientInnen - legen. Biosimilars sind Nachahmerpräparate von Biopharmazeutika, also von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. Was das nun genau für Betroffene von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bedeutet und welche Fragen sich hierzu in der Therapieentscheidung stellen können, wollen wir im heutigen Gespräch mit Prof. Alexander Moschen klären. Wir wünschen euch gute Unterhaltung!
Krebs - Verstehen, vermeiden und ganzheitlich behandeln - Dr. Rainer Klement
Evolution Radio Show - Alles was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst
Folge ansehen oder anhören auf YouTube I Apple Podcasts I SpotifyDanke an die WerbepartnerProdotti Amano - Gesichtspflege aus 9 hochwertigen Bio-Ölen - ohne jegliche Zusatzstoffe. Mit dem Code JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf die Bestellung deines Bio-Gesichtsöls.http://www.prodottiamano.com KapitelDie Einführung (00:00:00) Julia und Dr. Klement diskutieren die Bedeutung der Ernährung, Krafttraining und die evolutionäre Perspektive auf Gesundheit. Vorstellung von Prodotti Amano (00:01:32) Begrüßung von Dr. Klement (00:03:01) Dr. Klements Hintergrund und Forschung (00:04:15) Dr. Klement erzählt über seine Arbeit als Medizinphysiker und seine Forschung zum Thema Krebs. Krebs aus evolutionärer Sicht (00:07:41) Persönliche Erfahrungen mit Krebs (00:10:37) Dr. Klement teilt persönliche Erfahrungen mit dem Verlust seines Vaters an Krebs und wie dies sein Interesse an Krebs und Ernährung beeinflusst hat. Therapieerfolg und Herausforderungen (00:14:09) Ursachen und langfristige Behandlung von Krebs (00:16:32) Dr. Klement betont die Bedeutung des Patienten in der langfristigen Behandlung von Krebs und die Rolle des Lebensstils. Revolutionäre Hypothese von Thomas Seyfried (00:19:24) Julia und Dr. Klement diskutieren die revolutionäre Hypothese von Thomas Seyfried zur Stoffwechseltheorie des Krebses. Warburg-Hypothese und genetische Krebstheorie (00:19:49) Paradigmenwechsel zur metabolischen Krebstheorie (00:20:43) Ketogene Ernährung als Therapieoption (00:26:24) Wirkmechanismen der ketogenen Ernährung (00:31:32) Lebensqualität und soziale Aspekte (00:35:10) Tierische Produkte in der ketogenen Ernährung (00:37:53) Die Bedeutung der Mitochondrien (00:38:46) Tierische Lebensmittel und ihre Nährstoffe (00:39:54) Die ideologische Debatte um pflanzliche Ernährung (00:42:08) Die Bedeutung von Krafttraining (00:46:27) Der Verein für evolutionäre Medizin und Gesundheit (00:53:14)Wir sprechen überDie drei wichtigsten Takeaways, die du aus unserem Gespräch mitnehmen wirst, sind:Die Bedeutung der Ernährung: Erfahre, wie eine ketogene Diät und Fasten das Tumorwachstum beeinflussen können und warum tierische Produkte in deiner Ernährung unverzichtbar sind.Krafttraining als Schlüssel: Entdecke, warum Muskelaufbau und körperliche Aktivität nicht nur für die allgemeine Gesundheit, sondern insbesondere für Krebspatienten von entscheidender Bedeutung sind.Evolutionäre Perspektive auf Gesundheit: Verstehe, wie ein Blick durch die evolutionäre Linse uns hilft, die Ursachen von Krebs besser zu verstehen und effektivere Präventionsstrategien zu entwickeln.Dr. Klement bringt eine Fülle von Wissen und Einblicken mit, die deine Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit grundlegend verändern können. Mach dich bereit für eine Episode, die nicht nur informativ, sondern auch inspirierend ist und dir praktische Tipps für deinen Alltag bietet. Schalte ein, um dein Wissen zu erweitern und dein Leben zum Besseren zu verändern.Alles über Dr. Rainer KlementDr. Rainer Klement ist Medizinphysik mit einer beeindruckenden akademischen und beruflichen Laufbahn, die durch seine Leidenschaft für Gesundheit, Fitness und kritische wissenschaftliche Analyse geprägt ist.Mit einem soliden Fundament in der Physik, das durch sein Diplom an der renommierten Universität Heidelberg und eine anschließende Promotion in Astronomie, spezialisiert auf die Erforschung von Sternenströmen, gefestigt wurde, zeichnet sich Dr. Klement durch seine multidisziplinäre Expertise und seinen einzigartigen Ansatz in seiner beruflichen Praxis aus.Dr. Klement erweiterte sein Fachwissen durch ein Aufbaustudium in medizinischer Physik am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Diese Spezialisierung führte ihn zurück in seine unterfränkische Heimat, wo er seine praktische Ausbildung am Universitätsklinikum Würzburg begann und sich in Forschungsthemen wie der ketogenen Diät bei Krebs und dem Tumorstoffwechsel vertiefte.Seine Rückkehr nach Schweinfurt, um im Leopoldina Krankenhaus als Medizinphysiker tätig zu werden, markierte einen neuen Abschnitt in der wissenschaftlichen Laufbahn von Dr. Klement. Seine kritische Sicht auf gängige Gesundheits- und Ernährungsnarrative, geprägt durch eine naturwissenschaftliche Perspektive und den Mut, etablierte Denkmuster in Frage zu stellen, inspiriert seine Forschung und Arbeit.Neben seiner Tätigkeit als Privatdozent an der Universität Zürich hat Dr. Klement sich auch im Bereich der Gesundheitsförderung selbstständig gemacht, was seine umfassende Expertise und seinen Einsatz für das Wohlergehen der Gesellschaft unterstreicht. Sein beeindruckender Werdegang und seine fortwährende Leidenschaft für die Wissenschaft und Gesundheit machen ihn zu einer führenden Figur in seinem Fachgebiet.Website: https://rainerklement.com/Publikationen: https://rainerklement.com/publications/peer-reviewed-publicationsBuch auf Amazon: Krebs. Weckruf des Körpers: Krebs verstehen, vermeiden, ganzheitlich behandelnhttps://amzn.to/3I5VoEa Relevante ArtikelEffect of Ketogenic Diets on Cardio-Metabolic Outcomes in Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Clinical TrialsAmanollahi A, Khazdouz M, Malekahmadi M, Klement RJ, Lee D, Khodabakhshi A. Nutrition and Cancer. 2022 Sep Anti-tumor effects of ketogenic diets and their synergism with other treatments in mice: Bayesian evidence synthesis of 1755 individual mouse survival data.Klement RJ. Biomedical Journal. 2023 May. Online ahead of print.Effect of Ketogenic Diets on Cardio-Metabolic Outcomes in Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Clinical TrialsAmanollahi A, Khazdouz M, Malekahmadi M, Klement RJ, Lee D, Khodabakhshi A. Nutrition and Cancer. 2022 SepDanke an die Werbepartner, ohne deren Unterstützung dieser Podcast nicht möglich wäre.Prodotti Amano - Gesichtspflege aus 9 hochwertigen Bio-Ölen - ohne jegliche Zusatzstoffe. Prodotti Amano ist ein kleines, feines Startup, das nicht nur Labor-zertifiziertes TOP Extra Vergine Bio-Olivenöl produziert, nein – sie haben jetzt auch ein wirklich einzigartiges Bio-Gesichtsöl entwickelt.Neben Olivenöl aus eigenem regenerativem Anbau, sind unter anderem kostbare Öle wie BIO-Kaktusfeigenkernöl, BIO-Granatapfelkernöl, BIO-Traubenkernöl und BIO- Sanddornfruchtfleischöl enthalten.Das geniale Bio-Gesichtsöl findest du auf prodottiamano.com.Mit dem Code JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf die Bestellung deines Bio-Gesichtsöls.http://www.prodottiamano.com Bitte beachten Sie auch immer den aktuellen "Haftungsausschluss (Disclaimer) und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen" auf https://juliatulipan.com/haftungsausschluss/
Leberzirrhose: TIP(P)s für alle!(?)
Heiner Wedemeyer plaudert mit Dominik Bettinger, Leiter der Sektion TIPS an der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie der Universität Freiburg. Herr Bettinger erläutert, für welche Patienten mit Leberzirrhose ein TIPS eine gute Therapieoption ist und wie mit einfachen Parametern, Patienten mit einem niedrigen versus hohem Risiko für Komplikationen nach TIPS-Anlage unterschieden werden können. Die Kurzbotschaft ist: Es sollte viel häufiger eine TIPS-Anlage bei Patienten mit therapierefraktärem Aszites und bei Ösophagusvarizenblutungen erwogen werden!
Staffel 2 - Folge 5: Die Abnehmspritze - Endlich Schlank ohne Diät?
Die neue "Abnehmspritze" ist in aller Munde - Super Ergebnisse und kein Hungergefühl?! Auf Instagram scheint der Hype nicht abzubrechen und das ursprünglich für Diabetiker zugelassene Medikament ist häufig "Sold out"! Nun ist mit einer Neuzulassung für den Bereich Adipositas-Therapie das Produkt endlich indikationsbezogen salonfähig. Der häufig sehr unkritisch und gehypte Umgang mit diesem Produkt kann Risiken bedeuten. Wir sprechen mit Dr. Sixtus Allert über Standortbestimmung, Therapiemöglichkeiten und Risiken dieser neuen Therapieoption.
Mutmacher Gespräch Folge 147 mit Nils und Sara von Krebs was nun Podcast
Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Folge, heute freue ich mich so sehr, denn ich habe ein so schönes Gespräch mit zwei Podcastern geführt. Nils beakm die Diagnose Lungenkrebs und an seiner Seite stand und steht Sara, so gründeten Sie diesen Podcast um anderen Menschen zu helfen. Nils und Sara traf im Oktober 2022 der Schlag, als Nils im Alter von 39 Jahren die niederschmetternde Diagnose auf die Pleura metastasieter Lungenkrebs erhalten hat. Die Einstufung in das palliative Stadium IVa, gefolgt von der Aussage, man könne noch drei Mal in den Urlaub fahren, aber eine Therapieoption gäbe es nicht, hat die Beiden zum Glück nicht eingeschüchtert. Mittlerweile sind fast ein einviertel Jahre vergangen, Nils ist in Behandlung bei einer Onkologin in einem zertifizierten Lungenkrebszentrum und wird zusätzlich deutschlandweit von weiteren Ärzten unterstützt. Es sollte sich herausstellen, dass Nils einen durch eine EGFR Mutation getriebenen Lungenkrebs hat, welcher sich durch Einnahme eines sog. TKI (Tyrosin-Kinase-Inhibitor) idealerweise blockieren lässt. Aktuell scheint das Tumorwachstum gestoppt, dennoch bereitet sich Nils auf einen möglichen Progress vor und bringt bereits alle "Waffen in Stellung". Während der Zeit der Ungewissheit bis heute, durfte Nils feststellen wie wichtig der Austausch zu anderen Betroffenen ist. Nun bieten sich Nils und Sara selbst als direkte Ansprechpartner an, im Mai 2023 veröffentlichen die Beiden die ersten Folgen Ihres Podcasts "Krebs! Was nun?". Sie beleuchten im zweiwöchigen Rhythmus diverse Themen betreffend Nils persönlicher Geschichte, sowie allgemeine Themen einer Krebserkrankung und diskutieren mit Gästen beispielsweise über Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung und Vorsorgevollmacht. Podcast: https://Krebs-was-nun.podigee.io Instagram: @KrebsWasnun_podcast Mail: Post@krebswasnunpodcast.de Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest. Schreib mir von Herzen gern, eine positive Bewertung oder wenn du magst, abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich würde mich riesig über deine Gedanken zu dieser Folge freuen, schau gern bei Instagram vorbei unter der aktuellen Podcast Folge und kommentiere dort deine Gefühle und Gedanken. Was konntest du für dich mitnehmen? Denk immer daran, DU bist nicht allein. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bleib gesund! Danke, dass es dich gibt. Teile den Podcast mit den Menschen, die genau jetzt Mut, Kraft und Hoffnung brauchen. Hast du deine eigene Krebs Erfahrung, die du mit der Welt teilen möchtest? Oder hast du jemanden aus deiner Familie an Krebs verloren? Vielleicht möchtest du uns aber auch über deinen Verein erzählen, den du gegründet hast, für Betroffene und Angehörige?? Ich möchte jedem eine Chance geben, über das Thema Krebs zu sprechen. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Kendra ❤ Hier findest du mich: https://www.instagram.com/kendrazwiefka/ „Krebs als zweite Chance- Der Mutmacher Podcast“ auf Apple Podcasts Krebs als zweite Chance- Der Mutmacher Podcast | Podcast on Spotify
Der 103.Talk: Dany, die Diagnose kleinzelliger Lungenkrebs
Dany, 54, erhielt 2019 die Diagnose „kleinzelliger Lungenkrebs“, der als sehr aggressiv gilt und für den es als Therapieoption kein zielgerichtetes Medikament gibt. Ihre Geschichte zeigt auf, was alles möglich ist, wenn man an sich selbst glaubt und eigenverantwortlich aus einer tiefen inneren Lebenskraft heraus handelt. Hört einfach nur zu was Dany unglaubliches geschafft hat. Danke, liebe Dany für das Teilen deiner Geschichte. Du kannst Dany auf Instagram erreichen: https://www.instagram.com/dany_well_healthylifestyle/ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kab4/message
Vaptane – wo sind sie geblieben? Wie ist der Stand?
In meinem Artikel zum Diabetes insipidus und SIADH letztes Mal hatte ich schon einmal kurz die Vaptane als Therapieoption angesprochen, die sich bisher scheinbar nicht so sehr durchgesetzt haben. Es schloss sich eine Suche nach aktuellen Publikationen an, und tatsächlich: Die Indikationen und der Einsatz und Nutzen scheinen nach wie vor sehr begrenzt zu … Weiterlesen
Täglich hundertmal die Hände waschen, stundenlang die Wohnung putzen oder ständig kontrollieren, ob die Wohnungstür geschlossen ist: Zwangsstörungen machen das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen zur Hölle. Den Teufelskreis zu durchbrechen, ist schwierig, aber möglich. Zwangsstörung – Wenn irrationale Gedanken die Realität bestimmen Maëva ist 19 Jahre alt und hat ständig Angst, dass sie sich mit Krankheiten infiziert, wenn sie Objekte berührt, die sie als schmutzig empfindet. Seit sechs Jahren leidet sie an dieser Zwangsstörung. «Puls» gewährt sie einen Einblick in ihren von Zwängen bestimmten Alltag. Kognitive Verhaltenstherapie – Genesung durch Konfrontation Je früher eine Zwangsstörung therapiert wird, desto grösser sind die Erfolgschancen. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie muss sich die betroffene Person unter Aufsicht den angstauslösenden Momenten stellen, ohne danach eine Kontrollhandlung auszuführen, wie beispielsweise die Hände zu waschen. Dadurch kann Schritt für Schritt die Selbstkontrolle zurückgewonnen werden. Tiefe Hirnstimulation – Elektroden im Gehirn als letzte Option Zeigen Psychotherapie und Medikamente keine Wirkung gegen eine Zwangsstörung, bleibt als letzte Therapieoption ein Eingriff im Gehirn. Bei der tiefen Hirnstimulation, die bereits bei der Parkinsonerkrankung erfolgreich eingesetzt wird, werden feinste Elektroden in einen bestimmten Bereich des Gehirns implantiert. Regelmässige elektrische Impulse können dann krankhafte Aktivitäten in der Hirnregion reduzieren und in einen normalen Zustand bringen. Eine Erfolgsgarantie gibt es jedoch nicht. «Puls»-Chat – Fragen und Antworten zum Thema «Zwangsstörungen» Wie erkennt man eine Zwangsstörung? Wie kann einem Angehörigen mit einer Zwangsstörung geholfen werden? Kann das Problem auch ohne Therapie wieder verschwinden? Die Fachrunde weiss Rat – live im Chat.
Fortschritte beim SCLC - Was hat sich in der Praxis getan?
20 Jahre lang gab es kaum Dynamik in der Therapieentwicklung beim klinisch herausfordernden fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinom (ES-SCLC) – doch dann gelang der Chemo-Immuntherapie der entscheidende Durchbruch. Mit der Zulassung kam die vielversprechende Therapieoption schnell in der Praxis an. Dr. Martin Sebastian, Onkologe am Universitätsklinikum Frankfurt, und Prof. Martin Wolf, Hämato-Onkologe am Klinikum Kassel, gehen der Frage nach, ob die Chemo-Immuntherapie auch in der Versorgung von Patient:innen in einem schlechteren Allgemeinzustand hält, was die Studien versprechen. Informationen dazu liefert das prospektive CRISP-Register.(00:00) Intro(00:30) Einführung: Herausforderung SCLC(02:26) Gamechanger Immuntherapie(04:28) Studienergebnisse und Real-World-Daten im Vergleich(05:05) Ergebnisse der CRISP-Registerstudie(07:12) Patient:innen mit schlechtem Allgemeinzustand oder Hirnmetastasen(08:00) Krebsimmuntherapie im Versorgungsalltag angekommen(09:50) Was sagt die aktualisierte Onkopedia-Leitlinie?*(11:02) Fazit: Langzeitüberleben unter Immuntherapie möglich* Die Autoren der Leitlinie empfehlen den Einsatz der Krebsimmuntherapie bei Betroffenen mit oder ohne Hirnmetastasen.1 Patient:innen mit symptomatischen ZNS-Metastasen waren in den Zulassungsstudien ausgeschlossen. Das jeweilige Anwendungsgebiet sowie die in den Zulassungsstudien untersuchten Patientenkollektive entnehmen Sie bitte den Fachinformationen.Referenzen1. Wolf M et al.: Lungenkarzinom, kleinzellig (SCLC); Onkopedia Leitlinie Stand Januar 2023
#172: Interview mit PD Dr. med. Klarissa Hanja Stürner zu Weihrauch als Therapieoption bei MS
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Dr. Klarissa Stürner forscht seit einigen Jahren zu Weihrauch als Therapieoption bei MS. Wir sprechen über die bisherigen Erkenntnisse. Hier geht es zum Blogbeitrag inklusive transkribiertem Text: https://ms-perspektive.de/weihrauch-als-therapieoption-bei-ms Heute begrüße ich Privatdozentin Dr. med. Klarissa Hanja Stürner als Interviewgast zum Thema Weihrauch als Therapieoption bei Multipler Sklerose. Dr. Stürner ist Leiterin der neurologischen Tagesklinik sowie Leiterin der neuroimmunologischen Ambulanz am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Sie erforscht schon seit längerem die medizinische Wirksamkeit der im Weihrauch enthaltenen Säuren auf die Entzündungsaktivität der MS, sprich für den schubförmigen Verlauf. Ihr bisherigen Ergebnisse waren sehr vielversprechend, müssten jedoch als nächstes in einer größeren Studie überprüft werden. Von Selbstmedikation mit Nahrungsergänzungsprodukten, die Weihrauch-Säuren enthalten, rät sie ab. Das Problem bei den frei verkäuflichen Produkten auf dem Markt ist, dass bei der Gewinnung zum Teil krebserregende Stoffe verwendet werden. Für die bisherige kleine Studie wurden extra sehr strenge Auflagen eingehalten. Inhaltsverzeichnis Vorstellung Geschichte des Weihrauch Weihrauch als Therapieoption bei MS Studienlage zur Wirkung von Weihrauch bei MS Empfehlungen für MS-Patienten bezüglich Weihrauch Zukunft Blitzlicht-Runde Verabschiedung Dr. Stürner Wo man mich findet? Wir haben tatsächlich eine Seite speziell für den MS-Bereich. Die findet man unter www.ms-forschunginkiel.de --- Vielen Dank an Dr. Klarissa Hanja Stürner für die spannenden Einblicke in die therapeutischen Möglichkeiten des Weihrauch für Menschen mit MS und weiterhin viel Erfolg beim Forschen. Bis bald und mach das Beste aus Deinem Leben, Nele Mehr Informationen und positive Gedanken erhältst Du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest Du eine Übersicht zu allen bisherigen Podcastfolgen.
Wer mit Lungenkrebs konfrontiert ist, hat auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Viel zu oft glaubt das Gegenüber gleich den Grund der Diagnose zu kennen, und ein "selber schuld" schwingt dann in der Kommunikation unterschwellig mit. Doch das molekulare Profil des Tumors gibt umfassende Einsicht in die zelluläre Zusammensetzung und Biologie jedes Tumors (sehr wichtiger Hinweis: Tumor Profiling kann unabhängig von der Krebsart durchgeführt werden). Durch eine genetische Tumortestung können genomische Daten in klinisch relevante Informationen übersetzt werden und als Grundlage für weiterführende Therapieoptionen dienen. So die Theorie, in unserem Podcast ein Beispiel aus der Praxis. Sabine Hatzfeld von zielgenau e.v. ist Lungenkrebspatientin. Ihr Tumor wurde getestet und sie lernte, dass ihr Krebs nicht durch rauchen entstanden ist und dass es für ihr konkretes Profil neue Behandlungsperspektiven gibt. Hör mal rein! PS: Wir finden rauchen immer noch nicht gut, nur weil es diese Testung gibt :-) PPS: Solltest du mit dem Rauchen aufhören wollen, dann wende dich doch an dein ärztliches Personal oder an die Apotheke - die helfen gerne weiter! Der Verein zielgenau e.v. fordert eine flächendeckende, umfassende molekulare Diagnostik bei jedem Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Hier geht es zu mehr Information: https://www.zielgenau.org/ Wir? Wir sind InfluCancer. Und wir sind der Meinung: Egal wie du über Krebs sprichst. Hauptsache du tust es.
Anett Schrumpf über das Leben mit der celebralen Tetraparese
Anett Schrumpf sitzt auf Grund einer celebralen Tetraparese im Rollstuhl und kann Bewegungsabläufe nur mit höchster Anstrengung durchführen. Dennoch sagt sie, mein Leben ist schön und das zeigt sie auch, wenn sie vor der Kamera steht und modelt. Derzeit spart sie für eine neue Therapieoption ohne Op und ohne Medikamente: Triggertherapie und dafür rufen wir gerne zum Spendenaufruf auf. Was für ein tolles Interview. MAZZ AB mal anders!
Folge 8 - Besser leben mit THS, Smoothie und Seide mit Ernst Hillenkamp
Die Tiefe Hirnstimulation (THS) ist eine Therapieoption, die in der Regel bei Menschen in Betracht kommt, welche bereits länger an Parkinson erkrankt sind. Doch wie läuft so eine Operation ab, welche Erwartungen sind damit verknüpft und wie sieht das Leben danach aus? Darüber spreche ich mit Ernst Hillenkamp, der seine Erfahrungen mit der THS teilt. Aber es geht auch um die Vorzüge von Smoothies und Seidenschlafanzügen. Hier folgen weiterführende Informationen zu dieser Podcastfolge: Ernst empfiehlt die Homepage der Arbeitsgemeinschaft Tiefe Hirnstimulation e.V. http://www.tiefehirnstimulation.deWer Kontakt mit Ernst aufnehmen möchte kann dies über diese Mailadresse tun: ernstgh52@outlook.comAußerdem folgt hier sein bewährtes Smoothie-Rezept für 2 Personen zur Hilfe bei Verdauungsproblemen (schmeckt auch ohne Parkinsonerkrankung):eine kl. Bananeeine viertel GurkeeineHandvoll Grünkohlzwei Brokkoli-Rösscheneine Stange Staudensellerieein halber Apfel oder Birneeine Zitroneetwas Ingwerca. 100 ml Kefir/JoghurtEinfach alles pürieren und genießen! Ich freue mich über deine Rückmeldung zu dieser Podcastfolge. Viele weitere Infos findest du auch auf meiner Homepage www.jetzt-erst-recht.info. Schreibe mir gerne über das Kontaktformular oder direkt an: kontakt@jetzt-erst-recht.info Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören!
Infektiopod#51 Covid-19: Stopp der Impfung mit AstraZeneca Vakzine?!
In der 51. Folge des Infektiopods dreht sich wieder alles um COVID-19. Neben einer kleinen guten Neuigkeit über eine mögliche Therapieoption, sprechen wir vor allem über den (vorübergehenden) Stopp der Impfungen mit der AstraZeneca-Vakzine. Links: Anstieg der neuen Variante B117 in Deutschland – RKI Pressemitteilung von Merck über Molnupiravir Klinische Studien (Phase 2) zu Molnupiravir … „Infektiopod#51 Covid-19: Stopp der Impfung mit AstraZeneca Vakzine?!“ weiterlesen
Einige Adipositaspatienten berichten nach einer Schlauchmagenoperation (Sleeve) über Reflux Probleme. Typische Reflux-Symptome sind Sodbrennen, sowie Druckschmerz hinter dem Brustbein. Als Reflux bezeichnet man den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre – dies kann die Speiseröhre reizen oder auch langfristig schädigen. Mit PD Dr. med. Andreas Thalheimer sprach Professor Dr. med. Marco Bueter über die Ursachen und Folgen dieses Krankheitsbildes und warum sich dieses Krankheitsbild nach einer Magenverkleinerung verschlimmern kann. Auch informieren die beiden Mediziner darüber, welche Therapieoption hier sinnvoll sind. PD Dr. med. Andreas Thalheimer gilt bei Adipositas Zürich als unser Experte zu diesem Thema und leitet das Refluxzentrum am Standort des Spitals Männedorf. Mehr Informationen über die Refluxkrankheit:https://www.sodbrennen.de/reflux/ Mehr über Adipositas Zürich:www.adipositas-zuerich.ch Weitere Infos über unseren Gast:https://www.spitalmaennedorf.ch/fachgebiete-fachpersonen/fachpersonen/thalheimer-andreas/ Wir freuen uns über Dein Feedback oder Kommentare auf unserer Facebookseite „Adipositas Zürich“
Herr Prof. Sven Gläser (Vivantes Kliniken Berlin) und Frau Dr. Katrin Pilz (Pneumologie am Mexikoplatz, Berlin) diskutieren die Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und deren Relevanz für Praxis und Klinik. Auch unter aktuellen Bedingungen wie der COVID-Pandemie. Folgende Themen werden im Verlauf des Podcasts zwischen Herr Prof. Sven Gläser (Vivantes Kliniken Berlin) und Frau Dr. Katrin Pilz (Pneumologie am Mexikoplatz, Berlin) besprochen:(00:00) Intro(00:16) Einführung & Vorstellung des Themas aktuelle Leitlinien zu IPF(00:43) Kurze Vorstellung von Dr. Katrin Pilz & Prof. Dr. Sven Gläser(01:57) Welche Bedeutung hat die IPF-Leitlinie Diagnostik, Update 2020, in der Praxis?(03:12) Veränderungen der Diagnostik durch die COVID19-Pandemie?(05:32) Welche Bedeutung hat die neue Leitlinie von 2017 (medikamentöse Therapie) in der Praxis?(07:12) Veränderungen der Therapie in der Pandemie?(09:15) Post-COVID Pneumonien und mögliche Therapieoption in der Zukunft?(11:30) Ausblick - Was können wir in der nächsten Zeit an therapeutischen Optionen erwarten?(12:35) Fazit(13:44) OutroMelden Sie sich für E-Mail-Benachrichtigungen an, um keine neue Folge zu verpassen. Klicken Sie hier und gelangen Sie zum Roche-Podcast-Portal. Das Fachportal von Roche finden Sie hier.
DocPod - Der Podcast, der Leben retten Kann: Folge 110 - Sommerdepressionen
Die Sonne lacht, die Freibäder machen nach und nach wieder auf und es könnte doch so schön sein... Wenn, ja wenn sich doch das Gefühl des Glücks endlich einstellen würde. Es gibt allerdings Menschen, bei denen genau das nicht funktioniert. Sie leiden unter Depressionen. Gerade im Sommer ist dieses Thema ein oft kaum wahrgenommenes. Unsere beiden Docs reden darüber und stellen sich auch die Frage welche Therapieoption besser ist - die Gesprächs- oder die Pharmakotherapie...
Die Covid-19 Pandemie ist weltweit weiter in vollem Gange, in Deutschland ist es fast eher wieder etwas ruhiger geworden. Till Koch und Annette Hennigs diskutieren im neuen Format Journal Club* die neusten wissenschaftlichen Artikel über SARS-CoV-2, u.a. zu Remdesivir als Therapieoption, der sog. „Heinsberg“ (oder „Gangelt“?) Studie und zum Sampling von Spucke. *[Wiki]: „Treffen von … „Infektiopod#23 Covid-19: Remdesivir, Epidemiologie und Spucke“ weiterlesen
Beatmungstherapie bei COVID-19 - Einheitliche Empfehlungen für Ärzte
Die Beatmung gilt als die Therapieoption bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Weil die Krankheit neu ist, kann die Behandlung von Klinik zu Klinik unterschiedlich sein. Doch jetzt hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ihre Empfehlungen vorgestellt.
Podcast-Episode #45: Interview mit Lisa Glockner über Lip- & Lymphödem
Podcast- Episode #45: Interview mit @lisag140500 (Lisa Glockner) über #Lip- & #Lymphödem Wir unterhalten uns über ihre #Krankheiten, die Möglichkeiten einer Behandlung und wie sie damit in ihrem Leben umgeht. Einen kleinen Überblick über die Krankheiten, von denen speziell Frauen betroffen sind, sind hier zu finden (Mit Links zu den entsprechenden Wikipedia-Einträgen): Das Lipödem ist eine voranschreitende Erkrankung, die besonders bei Frauen auftritt und mit der Schwellungen aufgrund der Einlagerung von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem (Ödem) einhergehen können. Diese können Schmerzen und Druckempfindlichkeit sowie der Neigung zu blauen Flecken bewirken. Es liegt dabei keine Schädigung des Lymphsystems vor. Das #Lipödem ist NICHT die Folge von #Übergewicht. Es ist im Bereich seitlich an den Hüften und Oberschenkeln angesiedelt, wo eine Gewichtsreduktion generell wenig erfolgversprechend ist. Eine chirurgische Behandlung ist sehr kostspielig und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Da die Ursachen von Lipödemen nicht bekannt sind, ist eine vollständige Heilung ausgeschlossen. Das Lymphödem ist eine sicht- und tastbare Flüssigkeitsansammlung im Interstitium, d.h. Zwischenzellraum. Die interstituelle Flüssigkeit kann hier nicht mehr ausreichend über die Lymphgefäße abtransportiert werden weil eine mechanische Insuffizienz des Lymphgefäßsystems vorliegt. Der dadurch verursachte Rückstau führt zu einer Ansammlung von Flüssigkeit in den Zellzwischenräumen. Neben den Extremitäten können auch das Gesicht, der Hals, der Rumpf und die Genitalien betroffen sein. Als Therapiemaßnahmen werden Lymphdrainagen und Kompressionsbandagen & - strümpfe angelegt. Keine alleinige Therapieoption sind Diuretika (entwässernde Medikamente). Lymphödeme benötigen jahrelange Behandlung und sind somit nicht heilbar. ************** WEBINAR ZUR PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 2.0 ************ In unserem ersten Webinar mit Kirill von @mindupdate am 1.3.2020 packen wir so extrem viel wertvollen Inhalt über deine 4 wichtigsten Lebenssäulen wie Finanzen, Berufung & Selbstbestimmung, Beziehungen und Fitness rein, dass es alles bisherige sprengen wird! Ebenso stellen wir in diesem GRATIS Webinar unser Konzept von Persönlichkeitsentwicklung 2.0 vor - wie du in allen Lebensbereichen triumphierst und zu der Persönlichkeit wirst, die du schon immer sein wolltest! Unter ⏩ https://ziele-auf-dein-glueck.de/webinar_anmeldung kannst du dich zum Webinar über Persönlichkeitsentwicklung 2.0 anmelden. ************** ERSTELLE NOCH HEUTE DEIN EIGENES ONLINE BUSINESS ************ Erstelle jetzt GRATIS deine eigene unschlagbar schnellen und einfach zu erstellenden Webseiten: ⏩ https://covl.io/builderalltester Ich bin absoluter Fan von Builderall und werde mein Leben lang dieses einzigartige geile Online Marketing Tool benutzen um Webseiten aufzubauen, Emails Funnels zu erstellen, Online Produkte zu vermarkten und Builderall weltweit mit auszubauen! Da ich felsenfest davon überzeugt bin - durch meine eigene Erfahrungen und Erkenntnisse geprägt -, dass dieses revolutionäre Werkzeugtool fast alle Wünsche im Online Marketing Segment abdecken kann und wird, will ich dir die Chance geben jetzt den SCHNELLSTEN und EINFACHSTEN Webseiten Builder aller Zeiten für deinen Erfolg zu benutzen: Klicke jetzt hier um deine eigene Webseite aufzubauen - ein lebenlang kostenlos! ⏩ https://covl.io/builderalltester ************** GRATIS GESCHENKE ********************* Unter ⏩ https://unfoldemy.de findest du alles KOSTENLOS über: - Die praktische Kurzanleitung zum Glücklich sein - Mein geheimes Erfolgstagebuch für 100x mehr Erfolg im Leben - Your first € - die praktische 1:1 Anleitung zu deinem ersten € im Internet - Der 10 Schritte Plan alle deine Ängste zu überwinden
Molekulare Analyse der Funktion des TRPC6-Kanals in primären Podozyten der Maus
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Bisher wurden sieben verschiedene TRPC-Kanäle (für „classical (oder canonical) transient receptor potential“) beschrieben, die in der Plasmamembran tierischer Zellen lokalisiert sind. Diese Kanäle gehören zu einer von sieben Familien der TRP-Ionenkanäle, deren Mitglieder an einer Vielzahl von physiologischen Funktionen im Körper beteiligt sind. Im Jahr 2005 konnten in Patienten, die an einer autosomal dominant vererbten Form der fokalen segmentalen Glomerulosklerose (FSGS) leiden, Mutationen der TRPC6-Kanäle identifiziert werden, die zu einer Überaktivität dieser Kanäle führen ( sog. “gain-of-function”-Mutationen). Etwas später (2006) wurden aber auch einige FSGS Patienten entdeckt, die keine „gain-of-function“-Mutationen im TRPC6 sondern funktionslose, sog. „loss of function“-Mutationen der Phospholipase Cɛ (PLCɛ) exprimierten. Diese Daten deuten auf eine funktionelle Interaktion zwischen TRPC6 und PLCɛ in Zellen der Niere hin, die bisher noch nicht näher untersucht worden ist. Beide Proteine könnten sich auch als Zielstrukturen für eine Pharmakotherapie der FSGS eignen. Die FSGS äußert sich durch eine Störung des glomerulären Filtrationsprozesses in der Niere, wodurch es unter anderem zu einer Proteinurie kommt. In vielen Fällen führt die FSGS terminal zur ESRD („end stage renal disease“), also zu einem akuten Nierenversagen. Glomeruli bilden die filtrierende Einheit der Niere, wobei der eigentliche Filter, welcher im Inneren des Glomerulus lokalisiert ist, aus Podozyten, Endothelzellen und der dazwischen befindlichen Basalmembran besteht. Da TRPC-Kanäle unter anderem in Podozyten exprimiert werden, liegt die Annahme nahe, dass diese Zellen durch den vermehrten Ca2+-Einstrom mutierter Kanäle bei der FSGS krankhaft verändert sein könnten. Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit Podozyten aus Wildtyp (WT)-Mäusen sowie TRPC6 (TRPC6-/-)- und PLCε (PLCε-/-)-gendefizienten Tieren isoliert und umfangreich durch den Nachweis podozytenspezifischer Markerproteine charakterisiert. Zellfunktionen wie Proliferation, Aktinstressfaserbildung, RhoA- und TRPC6-Aktivität wurden vergleichend in den Zellen der verschiedenen Genotypen analysiert. Es zeigte sich, dass PLCε zwar mit TRPC6 in Zellen des Nierenkortex interagieren kann, aber PLCε-/--Podozyten funktionell in ihrer Angiotensin II-induzierten Aktinstressfiberbildung und GTPγS-induzierten TRPC6-Aktivierung nicht von Wildtyp-Podozyten unterschieden werden konnten, was auf eine redundante Funktion der PLCε-vermittelten TRPC6-Aktivierung hindeutet. Eine Aktivierung von TRPC6 durch PLCε wird wahrscheinlich durch die Stimulation der wesentlich stärker exprimierten anderen PLC-Isoform PLCβ1, zumindest in Podozyten, überdeckt. Eine Expression der klonierten murinen TRPC6-FSGS-Mutanten in primär isolierten Wildtyp- und TRPC6-defizienten Podozyten war für die Zellen lethal, wodurch die Pathogenität eines erhöhten TRPC6-induzierten Ca2+-Einstroms für diese Zellen und damit den gesamten Nierenglomerulus in FSGS-Patienten noch einmal nachgewiesen werden konnte. In Zukunft könnten deswegen spezifische TRPC6-Inhibitoren eine Therapieoption zur Linderung der Symptome bei FSGS-Patienten sein.
Mikrovaskuläre Mechanismen der hyperakuten und akut humoralen Abstoßungsreaktion nach experimenteller Herz-Xenotransplantation im Hamster-Ratte-Modell
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Die Herztransplantation stellt, trotz der großen Fortschritte in der Therapie terminaler Herzerkrankungen, häufig noch immer die letzte Therapieoption dieser Erkrankungen dar. Aufgrund des enormen Spendermangels sind geeignete Organe allerdings sehr knapp. Die xenogene Herztransplantation, im Speziellen die Transplantation von Schweineherzen an den Menschen, könnte dieses Problem lösen. Allerdings ist die Xenotransplantation noch weit von der klinischen Implementierung entfernt. Das Hauptproblem dabei stellt die Beherrschung der xenogenen Abstoßungsreaktion dar. Zwar kann die hyperakute Abstoßungsreaktion durch gentechnisch veränderte Spenderschweine inzwischen relativ gut beherrscht werden, bei der akut vaskulären (humoralen) Abstoßung hingegen ist dies noch nicht der Fall. Die pathophysiologischen Vorgänge während der xenogenen Abstoßungsreaktion sind noch nicht vollständig verstanden. Vorliegende Daten deuten aber auf eine ausgeprägte Koagulopathie mit einer Störung der Mikrozirkulation und Thrombosen im Rahmen der hyperakuten und akut humoralen Abstoßungsreaktion hin. Es ist unabdingbar notwendig die Mechanismen der xenogenen Abstoßungsreaktion genau zu kennen, damit man gezielt eingreifen kann. Um die zugrundeliegenden Mechanismen dieser Abstoßungsreaktion besser zu verstehen, war das Ziel dieser Arbeit ein neues Kleintiermodell zu etablieren, anhand dessen die Mikrozirkulation in vivo mittels Intravitalmikroskopie direkt am schlagenden Herzen sowohl quantitativ als auch qualitativ untersucht werden kann. Um dies zu erreichen wurden Herzen von Syrischen Goldhamstern heterotop an die Halsgefäße von Lewis-Ratten transplantiert. In drei Versuchsgruppen wurde nun die xenogene Abstoßungsreaktion untersucht. In Gruppe 1 wurde mittels Intravitalmikroskopie die subepikardiale Mikrozirkulation nach Reperfusion über dem rechten Ventrikel des Hamsterherzens untersucht. Die Ratten in Versuchsgruppe 2 wurden sieben Tage vor der xenogenen Herztransplantation mit Hamsterblut sensibilisiert, um die Bildung von xenoreaktiven Antikörpern zu induzieren und so eine hyperakute Abstoßung zu provozieren. Bei den Tieren aus Versuchsgruppe 3 wurde ohne vorherige Sensibilisierung nach der Transplantation das Operationsgebiet wieder verschlossen, um die Dynamik und Kinetik bis zur vollständigen Transplantatabstoßung zu untersuchen. In allen Versuchsgruppen wurden außerdem histologischen Analysen sowie Analysen des Blutbildes, Gerinnungsstatus und der Myokardmarker durchgeführt. Die in dieser Arbeit vorliegenden Daten zeigen, dass die Herzen der ersten und dritten Versuchsgruppe akut vaskulär (humoral) abgestoßen werden, bei einer durchschnittlichen Zeit bis zur vollständigen Abstoßung von 3,2 ± 0,2 Tagen. Die Hamsterherzen aus der zweiten Versuchsgruppe wurden hingegen nach vorheriger Sensibilisierung hyperakut in 14,8 ± 2,8 Sekunden vollständig abgestoßen. Die Analyse der Mikrozirkulation mittels Intraviralmikroskopie zeigte einen Anstieg des Blutflusses in den Spenderherzen, welcher als reaktive Hyperämie nach Reperfusion zu deuten ist. Des Weiteren ist eine sehr hohe endotheliale Leakage auffällig, die für eine bereits sehr frühe Endothelaktivierung im Rahmen der akut humoralen Abstoßung spricht. Bezüglich der Zell-Endothel-Interaktion könnte weder bei den Leukozyten noch bei den Thrombozyten eine signifikante Veränderung zwischen 30 und 90 Minuten nach Reperfusion gefunden werden. Gleichwohl wurden aber ein Anstieg der Interaktion der Leukozyten mit dem Gefäßendothel sowie einen Abfall der Thrombozyten-Endothel-Interaktion gefunden, welche ebenfalls für eine Endothelzellaktivierung im Rahmen der ablaufenden akuten Abstoßungsreaktion sprechen. Auch die Blutwerte bestätigten die Annahmen über die ablaufende Abstoßungsreaktion. So waren in allen Gruppen die sog. Myokardmarker deutliche erhöht, was für einen myokardialen Schaden sowohl durch das operative Trauma, als auch durch die Abstoßungsreaktion spricht. Des Weiteren wurde in Versuchsgruppe 2, also der Gruppe die das Hamsterherz nach ca. 3 Tagen akut vaskulär (humoral) abgestoßen hat, ein deutlicher Anstieg des Leukozytenwertes sowie eine Verlängerung des Quick-Wertes gefunden, was unter anderem für eine starke Stimulation des Immunsystems und eine Koagulopathie im Rahmen der akut xenogenen Transplantatabstoßung spricht. Ebenso deckten sich die Histologien der drei Versuchsgruppen mit diesen Annahmen und den Ergebnissen anderer Forschungsgruppen zu diesem Thema. Die Herzen, die die akut vaskuläre (humorale) Abstoßungsreaktion unterliefen, zeigten bereits 90 Minuten nach Reperfusion (Versuchsgruppe 1) erste Anzeichen der Transplantatabstoßung, wie beginnende Nekrosen und Einblutungen. Nach vollständiger Transplantatabstoßung (Versuchsgruppe 3) waren hingegen flächenhafte Nekrosen sowie Hämorrhagien und perivaskulär Infiltrate mononuklearer Zellen vorhanden. Die hyperakut abgestoßenen Hamsterherzen (Versuchsgruppe 2) zeigten im Vergleich zu den akut abgestoßenen Herzen ein ähnliches, wenn auch weniger ausgeprägtes Bild der Transplantatzerstörung mit Nekrosen, Hämorrhagien und Infiltraten mononuklearer Zellen. Thrombotische Gefäßverschlüsse konnten sowohl bei den hyperakut als auch bei den akut vaskulär (humoral) abgestoßenen Herzen vereinzelt gefunden werden. Zusammenfassend konnte erstmals die mikrovaskulären Mechanismen und die Koagulopathie während der akut vaskulären (humoralen) Abstoßungsreaktion sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet werden. Hierbei deckten sich die Ergebnisse dieser Arbeit mit den Daten anderer Forschungsgruppen weitestgehend. Somit wurde dieses Kleintiermodell erfolgreich etabliert. Insbesondere eignet sich dieses Modell zur Erforschung verschiedenster Strategien zur Verhinderung der xenogenen Abstoßungsreaktion und deren mikrovaskulären Einflüsse.
Molekulargenetische Analyse bei Patienten mit kongenitalen myasthenen Syndromen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
Die kongenitalen myasthenen Syndrome (CMS) stellen eine Gruppe seltener hereditärer Erkrankungen dar, die auf einer Störung im Nerv-Muskel-Signalübertragungsweg beruhen. Hinsichtlich Pathogenese, Molekulargenetik und klinischer Symptomatik zeichnen sich diese Syndrome durch eine starke Heterogenität aus, die eine Einteilung in CMS-Unterformen erforderlich macht. Die bislang bekannt gewordenen krankheitsursächlichen CMS-Gene kodieren in vielen Fällen für Synapsen-assoziierte Proteine. Um so überaschender war die kürzliche Entdeckung, dass Mutationen im Gen GFPT1, kodierend für das Schlüsselenzym des Hexosamin-Stoffwechselwegs, und zwar der Glutamin-Fruktose-6-Phosphat-Amidotransferase 1 (GFAT1), krankheitsauslösend für ein CMS mit Gliedergürtelbetonung sind. Dies ließ vermuten, dass ein neuer Pathomechanismus – nämlich Glykosylierungsstörungen – dieser CMS-Untergruppe zugrunde liegen könnte. Damit rückten weitere Gene für Enzyme des Hexosamin-Stoffwechselweges als Kandidatengene für CMS in den Fokus. Hauptschwerpunkt dieser Promotionsarbeit war deshalb, eine Kohorte von CMS-Patienten auf krankheitsrelevante Mutationen in den Hexosamin-Biosynthese-Genen GNPNAT1, PGM3, UAP1 und OGT zu untersuchen. Die Kohorte bestand aus insgesamt 44 CMS-Patienten, größtenteils solchen mit dem besonderen Phänotyp der Gliedergürtelbeteiligung (38 Patienten), zum kleineren Teil solchen mit bisher ungeklärter genetischer Ursache (6 Patienten). Jedoch konnte in keinem dieser Fälle eine mutmaßlich pathogene Sequenzveränderung in den genannten vier Kandidatengenen detektiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit lag darin, die vorgestellte Gliedergürtel-Kohorte auf bereits bekannte, jedoch nur äußerst selten nachgewiesene, CMS-verursachende Mutationen zu analysieren. Hierzu zählen vor allem Mutationen in MUSK, einem essentiellen Gen für eine an der neuromuskulären Synapsenbildung beteiligten Kinase. Weltweit sind hier überhaupt nur 5 Fälle/Familien in der Literatur beschrieben. Erstmals konnten im Rahmen dieser Arbeit bei einem Patienten die Sequenzvariante MUSK p.Asp38Glu und eine größere Deletion im MUSK-Gen nachgewiesen werden. Funktionelle Studien auf Ebene der MUSK-mRNA-Transkripte im Patientenmuskel, bioinformatische Daten und die Segregationsanalyse in der Familie lassen den Schluss zu, dass diese beiden Mutationen sehr wahrscheinlich als pathogen einzustufen sind. Klinisch fiel ein ausgezeichnetes Ansprechen auf Salbutamol auf, welches bei MUSK-CMS-Patienten bisher noch nicht beschrieben war. Die Analyse weiterer bekannter CMS-Gene in Patienten beider Kohorten führte zum Nachweis bereits beschriebener Frameshift-Mutationen in CHRNE, die bekanntermaßen zu einer verminderten Expression des Acetylcholinrezeptors an der Oberfläche von Muskelzellen führen. Neben den häufigen Mutationen c.1327delG in homozygoter Form und c.1353dupG in homozygoter und compound heterozygoter Form - beides Founder-Mutationen in der Population der Roma bzw. der nordafrikanischen Bevölkerung - wurde die Mutation c.70insG in compound heterozygoter Form gefunden. Interessanterweise lag bei zwei der hier beschriebenen vier CHRNE-Patienten ein Phänotyp mit prominenter Gliedergürtelschwäche vor, was für CHRNE-CMS-Patienten mit typischerweise im Vordergrund stehender okulärer Beteiligung ungewöhnlich ist. Zusammengefasst zeigen die im Rahmen dieser Arbeit identifizierten Patienten mit CHRNE-Mutationen klinisch eine unerwartet große Heterogenität. Ein Patient mit distal betonter Muskelschwäche aus der Kohorte mit ungewöhnlichen Phänotypen wies die Sequenzvariante c.866C>A/p.Ser289Tyr in CHRND in heterozygoter Form auf. Diese bisher nicht funktionell untersuchte Variante stellt eine autosomal dominant vererbte Slow-Channel-Mutation dar und führt möglicherweise wie die an gleicher Position lokalisierte, jedoch schon funktionell charakterisierte Mutation p.Ser289Phe zu einer verlängerten Kanalöffnungszeit des Acetylcholinrezeptors. Im Unterschied zu anderen CHRND-Patienten war phänotypisch jedoch keine respiratorische Beteiligung erkennbar. Bei einem weiteren Patienten mit Gliedergürtelphänotyp konnten zwei Sequenzvarianten nachgewiesen werden, deren pathogenes Potential aufgrund der Ergebnisse der in silico- und Segregationsanalyse, wenn überhaupt, als sehr gering einzustufen ist. Zum einen fand sich in CHRNB1 die Sequenzveränderung p.Val113Met heterozygot. Daneben war der Patient Träger der Sequenzvariante c.1137-3del in OGT, die abschließend auf Grund der Ergebnisse der in silico- und Segregationsanalyse ebenfalls als nicht krankheitsverursachend einzuschätzen ist. Zusammenfassend konnte im untersuchten Patientenkollektiv zwar keine krankheitsursächliche Mutation der Kandidatengenene des Hexosamin-Biosynthesewegs, i.e. GNPNAT1, PGM3, UAP1 und OGT, nachgewiesen werden. Die grundsätzliche pathogene Relevanz von Genen, die eine Rolle bei Glykosylierungsvorgängen spielen, wurde jedoch zwischenzeitlich durch Identifikation von Mutationen in den Genen DPAGT1, ALG2 und ALG14 bei CMS gezeigt. Eine vergleichende Gegenüberstellung der Phänotypen der im Rahmen der Arbeit genetisch aufgeklärten CMS-Patienten bestätigte die große klinische Heterogenität innerhalb der Krankheitsgruppe und zum Teil auch unter Patienten mit identischen Genotypen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit ermöglichen eine Erweiterung des Phänotyps sowohl für häufig als auch für seltener ursächliche CMS-Gene und machen deutlich, welche klinische Relevanz die Analyse von seltenen CMS-Genen wie MUSK haben kann. Im Hinblick auf Salbutamol als eine Therapieoption bei MUSK-CMS wird ein neuartiger medikamentöser Behandlungsansatz aufgezeigt. Neben einem besseren Verständnis für die genetischen Hintergünde der Erkrankung leisten die Ergebnisse somit auch einen Beitrag für eine bessere Versorgung bzgl. Diagnostik und Therapie von Patienten mit dieser seltenen neuromuskulären Erkrankung.
Doxorubicin-beladene thermosensitive Phosphatidyldiglycerin-Liposomen mit simultaner regionaler Hyperthermie als Therapieoption des inoperaben felinen Fibrosarkoms
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Sat, 12 Jul 2014 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/17210/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/17210/1/Zimmermann_Katja.pdf Zimmermann, Katja
Einfluß hypobarer Hypoxie (Höhenaufenthalt) auf die nächtliche Atemregulation bei Patienten mit nächtlicher obstruktiver Schlafapnoe und Veränderungen durch intermittierende Sauerstoffapplikation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 16/19
HINTERGRUND Mit steigender Prävalenz obstruktiver Schlafapnoesyndrome (OSAS) verbringen immer mehr Patienten ihre Freizeit in Höhenlagen und bernachten auch dort. Eine Mitnahme des CPAP-Geräts ist nicht immer möglich, so dass die Frage einer adäquaten Therapieoption aufscheint. METHODEN 27 Patienten mit OSAS wurden in je einer Nacht ohne Therapie im Tal (München, 520 m ü NN) und auf dem Schneefernerhaus an der Zugspitze (2650 m ü NN) polysomnographisch untersucht. Bei 13 dieser Probanden folgte eine zweite Studiennacht, in der zuerst eine intermittierende Sauerstoffapplikation, dann eine CPAP-Therpie erfolgte. ERGEBNISSE Hypobare Hypoxie führte beim OSAS zu vermehrten zentralen Ereignissen, während obstruktive Ereignisse verringert wurden. Durch intermittierende Sauersto�ffapplikation kam es zu einem Shift von zentralen zu obstruktiven Ereignissen. Dieser Eff�ekt konnte auch in den Zwischenphasen ohne Sauersto�gabe nachgewiesen werden. SCHLUSSFOLGERUNGEN Intermittierende Sauerstoff�applikation unterdrückt wirkungsvoll durch hypobare Hypoxie ausgelöste zentrale respiratorische Störungen. Dabei scheint ein �Gedächtnis� fr die Sauerstoffgabe eine Wirkung in den Applikationspausen zu ermöglichen.
Ifosfamid, Carboplatin und Etoposid in Kombination mit regionaler Hyperthermie in der Therapie von Anthrazyklin-refraktären Weichteilsarkomen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Weichteilsarkome (STS) sind seltene maligne Neoplasien, die von bindegewebigen Strukturen wie Fett-, Muskel- oder Stützgewebe ausgehen und im gesamten Körper auftreten können. Goldstandard der Therapie ist die Resektion aller Manifestationen unter Mitnahme ausreichender Sicherheitsabstände. Da dies jedoch nicht in allen Patienten möglich ist, wird versucht, durch Verabreichung zytostatischer Substanzen eine Tumormassenreduktion zur erreichen. Dies gelingt mit den vorhandenen Chemotherapeutika mit erwiesener Wirksamkeit, insbesondere Doxorubicin, jedoch nur in etwa einem Drittel aller Patienten. Es konnte gezeigt werden, dass die Anwendung einer regionalen Hyperthermie (RHT) das Ansprechen der Patienten verbessert. Noch anspruchsvoller ist die Therapie von Patienten mit bereits metastasierter, rezidivierender oder Doxorubicin-refraktärer Erkrankung. Hier ist bislang keine Standardtherapie definiert. Die vorliegende Arbeit evaluiert eine in dieser Situation angewendete Polychemotherapie, bestehend aus Ifosfamid, Carboplatin und Etoposid (ICE) und appliziert in Kombination mit RHT, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit. Zudem wurde die Funktion natürlicher Killerzellen (NK-Zellen) als an der Kontrolle von Neoplasien beteiligte Effektoren des Immunsystems bei Patienten mit STS untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass ICE + RHT eine wirksame Therapieoption für Patienten mit Anthrazyklin-refraktärem STS darstellt, und zwar sowohl für Patienten mit als auch ohne Fernmetastasen. Remissionen waren in 13% der Patienten nachweisbar, überwiegend konnte eine Krankheitsstabilisierung erreicht werden. Die Therapie ist jedoch assoziiert mit einer höhergradigen hämatologischen Toxizität und febrilen Komplikationen in einem signifikanten Anteil der Patienten, so dass ICE + RHT nur ausgewählten Patienten in gutem Allgemeinzustand verabreicht werden sollte. Die lytische Funktion der NK-Zellen war noch vor Beginn einer Therapie bei Patienten mit Erstdiagnose eines STS sowie bei Patienten mit Anthrazyklin- refraktärem STS signifikant reduziert im Vergleich zu gesunden Probanden. Während der Therapie mit ICE + RHT zeigte sich keine Zunahme dieser Funktion. Durch Inkubation der Zellen mit Interleukin 2 und TKD, einem Hitzeschockprotein- Derivat mit NK-stimulierenden Eigenschaften, konnte die Funktion in vitro wiederhergestellt werden. Die Augmentation der NK-Zell-Funktion könnte in Zukunft von therapeutischem Nutzen für Patienten mit STS sein.
Das Tumorstroma als Angriffspunkt einer stammzellbasierten CCL5-Promoter/HSV-TK Suizidgentherapie in einem murinen Pankreastumormodell
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Maligne Zellen wachsen in einem komplexen zellulären und extrazellulären Umfeld, welches die Initiierung und Aufrechterhaltung des malignen Phänotyps bedeutend beeinflusst. Tumore bestehen zum einen aus den Tumorzellen, zum anderen aus dem unterstützenden Stroma, das Fibroblasten, Endothelien, Perizyten, Lymphgefäße, ein mononukleäres Infiltrat und die Extrazellulärmatrix einschließt. Dieses Tumor-Mikromilieu hat einen großen modulierenden Einfluss auf das Tumorwachstum, die Invasivität und das Metastasierungspotential. Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind pluripotente Vorläuferzellen, die an der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Gewebeintegrität beteiligt sind. Geschädigtes Gewebe führt zur Mobilisation von MSC und deren Rekrutierung an den Ort der Schädigung. Tumore werden vom Organismus als nicht-heilende Wunden angesehen, so dass MSC in das tumorassoziierte Stroma rekrutiert werden. Dort tragen die Zellen zu verschiedenen Aspekten des Tumorwachstums bei, indem sie als Progenitorzellen für die Tumorgefäße und stromale fibroblastenartige Zellen dienen. Im Rahmen dieses Ausdifferenzierungsprozesses werden gewebespezifische Gensets wie das CC-Chemokin CCL5 in den mesenchymalen Stammzellen aktiviert und zur Expression gebracht. Das Pankreasadenokarzinom ist eines der aggressivsten soliden Malignome des Menschen und ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Proliferation des Stromas. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zum einen die Rolle mesenchymaler Stammzellen im Stroma des Pankreaskarzinoms zu evaluieren und zum anderen eine gewebespezifische stammzellbasierte und promoterkontrollierte Suizidgentherapie mit dem Stroma als Angriffspunkt zu etablieren. Mesenchymale Stammzellen wurden aus dem Knochenmark von C57BL/6 p53-/- Mäusen isoliert und sowohl mit den Reportergenen des rot fluoreszierendem Proteins (RFP) und des grün fluoreszierenden Proteins (eGFP) als auch mit dem Suizidgen der Herpes Simplex I Thymidinkinase (HSV-TK) unter Kontrolle des CCL5-Promoters transfiziert. Die HSV-TK führt zu einer Phosphorylierung und Aktivierung der Prodrug Ganciclovir, welches zytotoxisch auf Thymidinkinase-positive (TK+) Zellen und über den sogenannten „Bystandereffect“ auf umgebende Thymidinkinase-negative (TK-) Zellen wirkt. Diese Stammzellen wurden C57BL/6 Mäusen intravenös injiziert, die orthotope und syngene panc02- Pankreastumore trugen. Die i.v. Applikation von nativen MSC führte zu einer Verdopplung der Tumormasse und einer gesteigerten lokalen Aggressivität im Sinne einer Peritonealkarzinose im Vergleich zur Kontrollgruppe. Dabei zeigten sich erhöhte Ccl5-Expressionsniveaus im Tumorgewebe von Tieren, die MSC erhalten hatten. In-vitro konnte gezeigt werden, dass MSC bei adäquater Stimulation zur Ccl5 Expression angeregt werden und somit als Quelle des beobachteten Ccl5-Anstiegs in Frage kommen. Die stromale Aktivierung des CCL5-Promoters in den mesenchymalen Stammzellen konnte durch Verwendung von CCL5-Promoter/Reportergen Stammzellen direkt nachgewiesen werden. Dabei zeigten sich spezifisch im Tumorgewebe Fluoreszenzsignale, die sich in der Immunhistochemie morphologisch genauer darstellen ließen. Eine Reportergenexpression war spezifisch im stromalen Kompartiment der panc02- Tumore nachweisbar, andere untersuchte Organe mit Ausnahme der Milz zeigten keine Reportergenexpression. Der Einsatz der therapeutischen CCL5-Promoter/HSV-TK MSC in Kombination mit der intraperitonealen Gabe von Ganciclovir führte zu einer Tumormassenreduktion um 50%. Darüberhinaus konnte die Therapie die Metastasierungsrate in Milz, Leber und Peritoneum signifikant senken. Es wurden keine systemischen Nebenwirkungen beobachtet. Bei der Untersuchung von humanen Pankreaskarzinomen und korrespondierenden Pankreasnormalgeweben aus den gleichen Patienten zeigte sich bei der Mehrheit eine Hochregulation von CCL5-mRNA. Im immunhistochemischen Nachweis konnte die CCL5 Expression auf Proteinebene im Tumorstroma gezeigt werden, entsprechendes Normalgewebe zeigte bis auf vereinzelte Zellen keine CCL5 Produktion. Das Tumorstroma stellt aufgrund seiner vitalen Bedeutung für die Tumorprogression einen vielversprechenden Ansatzpunkt künftiger therapeutischer Interventionen dar. Mesenchymale Stammzellen eigenen sich hierbei im Rahmen einer Suizidgentherapie als zellbasierte Vehikel. Dank der gezielten Migration und des Einsatzes gewebespezifischer Promoter kann dabei eine hohe Selektivität der Genexpression im Tumorgewebe mit Minimierung der systemischen Nebenwirkungen erreicht werden. Der CCL5-Promoter wird im stromalen Kompartiment des murinen pankreatischen Adenokarzinoms aktiviert und eignet sich daher für die selektive und spezifische Expression von therapeutischen Genen wie der HSV-TK. Dieser Ansatz kann eine mögliche Therapieoption des ansonsten therapieresistenten humanenPankreaskarzinoms darstellen.
Apoptose-Induktion ausgelöst durch Farnesyltransferase-Inhibitoren als Therapieoption für gastrointestinale Tumore
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirkung der Farnesyltransferase-Inhibitoren hinsichtlich der antitumorösen Wirkung auf gastrointestinale Tumore in verschiedenen in vitro Experimenten untersucht. Als Marker für die therapeutische Wirkung wurde die Induktion der Apoptose gewählt. Durchgeführt wurden unsere Versuche mit den Zelllinien HepG2, gewonnen aus einem hepatozellulären Karzinom, sowie HT29, einem kolorektalen Adenokarzinom, unter Verwendung von BMS-214662 und SCH66336 als Vertreter der Farnesyltransferase-Inhibitoren. Diese werden derzeit in klinischen Studien getestet. BMS-214662 befindet sich in Phase II, im Rahmen von SCH66336 sind bereits Phase III Studien abgeschlossen worden. Anhand von Apoptose-Assays waren wir in der Lage einen antitumorösen Effekt durch Induktion der Apoptose aufzuzeigen. Hierbei war die Apoptose-Auslösung dosisabhängig von dem verwendeten Farnesyltransferase-Inhibitor. Im Gegensatz zu SCH66336 induzierte BMS-214662 bereits unter Verwendung von 1µM in 24h die Apoptose, wohingegen eine Konzentration von 25µM SCH66336 notwendig war, eine signifikante Apoptose hervorzurufen. Die Induktion der Apoptose war dabei unabhängig von einer Ras-Mutation. Sowohl in den HT29-Zellen mit Mutation des Ras-Proteins, als auch in den mutationsfreien HepG2-Zellen erfolgte ein Anstieg der Apoptoserate. Zusätzlich zeigten wir einen möglichen synergistischen Effekt für den Antikörper anti-APO in Verbindung mit BMS-214662. Mit Hilfe des Western Blots konnte als ein möglicher Induktionsfaktor eine gesteigerte Rekrutierung der Caspase 8 dargestellt werden. Dies bestätigte sich durch eine messbare Erhöhung der Caspase 3, welche durch Caspase 8 aktiviert wird und den apoptotischen Tod der Zelle hervorruft. Insgesamt läuft der Mechanismus Rezeptor- bzw. Liganden-unabhängig ab, da in der durchgeführten rt-PCR weder vermehrt CD95-Rezeptor bzw. dessen Ligand nachgewiesen werden konnte.
Einfluss der transkraniellen Gleichstrombehandlung (transcranial direct current stimulation, tDCS) auf kognitive Leistungen und BDNF-Serumkonzentrationen bei Patienten mit therapieresistenter Depression
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 12/19
Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) stellt eine neue, nicht-invasive Methode zur Hirnstimulation dar. Mit Hilfe einer Konstantstromquelle und zweier Elektroden kann die Stimulation eines Hirnareals erfolgen. Vorläufige Studien weisen darauf hin, dass dieses Verfahren eine neue Therapieoption bei verschiedenen Hirnleistungsstörungen darstellen könnte. In einem randomisierten cross-over Design erhielten 22 therapieresistente depressive Patienten in unterschiedlicher Reihenfolge zwei Wochen eine Verum- und zwei Wochen eine Plazebo-tDCS-Behandlung des linken DLPFC. Es wurde jeweils fünf Tage pro Woche 20 Minuten lang stimuliert. Die ersten 10 Patienten erhielten eine Stimulation mit 1 mA, die 12 folgenden mit 2 mA. Zwei Patienten brachen die Studie im Verlauf ab. Die Anode wurde über dem linken DLPFC, die Kathode über dem rechten supraorbitalen Kortex fixiert. Zu Beginn und zum Abschluss jeder Stimulationsbedingung wurde eine Testbatterie durchgeführt, sowie Blut zur Messung des BDNF-Spiegels abgenommen. Als klinische Tests wurde die Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) und der Beck Depression Inventory (BDI) verwendet. Als neuropsychologische Tests wurden der formallexikalische Wortflüssigkeitstest (RWT), die Buchstaben-Zahlen-Folge (BZF) aus dem Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene und der verbale Lern- und Merkfähigkeitstest (VLMT) durchgeführt. Die Ergebnisse nach Verum-tDCS zeigten keinen signifikanten Unterschied zu den Ergebnissen nach Plazebo-Behandlung, weder in den klinischen- und neuropsychologischen Tests, wie auch in dem Verlauf des BDNF-Spiegels. Zwischen der Stimulation mit 1 mA und der mit 2 mA waren ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zu erkennen. Die vorliegende Pilotstudie stellt die Effekte der tDCS auf kognitive Faktoren und auf den BDNF-Spiegel bei therapieresistenten depressiven Patienten in Frage. Vermutlich sind bei schwerkranken, therapieresistenten Patienten andere Stimulationsparameter zu verwenden.
Eine randomisierte Phase-II-Studie mit Capecitabin/Oxaliplatin versus Gemcitabin/Capecitabin versus Gemcitabin/Oxaliplatin bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem Pankreaskarzinom
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Diese dreiarmige Phase-II-Studie ist die erste prospektive randomisierte Studie, die drei verschiedene Zweifach-Kombinations-Chemotherapien beim fortgeschrittenen duktalen Adenokarzinom des Pankreas vergleicht. Die Daten zum Zeitpunkt der Auswertung sind insbesondere bezüglich dem primären Zielkriterium Progressfreies Überleben (PFS) und dem sekundären Zielkriterium Gesamtüberleben (OS) und bezüglich der Auswertungen der Nebenwirkungen als reif anzusehen. Die Ausgangskriterien und die Strata sind relativ gut über die drei Arme verteilt. Im Median sind die Patienten 63 Jahre alt. Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten (82%) liegt ein metastasiertes Stadium vor, 68% hatten nachgewiesene Metastasen in der Leber. Ein Großteil der Patienten hat bei Einschluss einen ordentlichen KPS (84% mit KPS ≥80%) aufgewiesen. Keine der drei Kombinationen hat den primären Endpunkt einer Rate des PFS nach 3 Monaten von über 70% erreicht. Das PFS nach 3 Monaten lag aber für die randomisierten Patienten insgesamt mit 60% (95%-KI: 54% - 68%) über dem unter einer Gemcitabin- Therapie zu erwartenden PFS nach 3 Monaten von 50%. Hier schneidet im Trend der CAPGEM-Arm mit 64% (95%-KI: 53% - 77%) und der mGEMOX-Arm mit 60% (95%- KI: 49% - 74%) etwas besser ab als der CAPOX-Arm mit 51% (95%-KI 40% - 65%). Der Median des PFS als sekundäres Zielkriterium wurde im CAPGEM-Arm mit 5,7 Monaten geschätzt. Dies war im Trend besser als unter CAPOX (p=0,42) mit 4,2 Monaten und unter mGEMOX (p = 0,47) mit 3,9 Monaten. Die Gesamtansprechrate (ORR) als weiterer sekundärer Endpunkt war ebenfalls im CAPGEM-Arm mit 25% im Trend besser als die mit jeweils 13% identischen Ergebnisse im CAPOX-Arm und mGEMOX-Arm (jeweils p = 0,11). Beim sekundären Zielkriterium medianes Gesamt-Überleben (OS) besteht zwischen den Behandlungsarmen kein statistisch signifikanter Unterschied, es erreichte 8,1 Monate für CAPOX, 9,0 Monate für CAPGEM und 6,9 Monate für mGEMOX. Insgesamt ist die Effektivität der drei Therapiearme bezüglich der Zielkriterien PFS nach 3 Monaten und OS statistisch nicht signifikant unterschiedlich. Bei den paarweisen Vergleichen ergibt sich aber ein Trend im PFS, in der objektiven Remissionsrate und im medianen Gesamtüberleben (OS) zuungunsten des mGEMOX-Arms. Bei Betrachtung der Sicherheit sind die Häufigkeiten von Grad-3- oder Grad-4-Nebenwirkungen insgesamt mäßig. Alle drei Therapiemodalitäten konnten bei vertretbarer Verträglichkeit gegeben werden. Es konnten jedoch signifikante Unterschiede im Spektrum der Nebenwirkungen beobachtet werden. Die hämatologische Toxizität ist signifikant am geringsten im CAPOX-Arm (p
Früh- und Langzeitergebnisse nach Resektion von Lebermetastasen nicht-kolorektaler Tumoren
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Bereits in vorausgegangenen Studien konnte gezeigt werden, dass die Resektion von Lebermetastasen kolorektaler Primärtumoren das Überleben der Patienten in ausgesuchten Fällen signifikant verlängert, und ist somit in diesem Bereich seit Jahren etabliert. Aufgrund der Heterogenität der Primärtumoren gibt es bisher aber nur sehr wenige Studien, die auf das Überleben nach Resektion von Lebermetastasen nicht- kolorektalen Ursprungs eingehen. In einer retrospektiven Studie des Patientenkollektivs der chirurgischen Klinik Großhadern wurden die Kurz- und Langzeitergebnisse der Leberresektion nicht- kolorektaler Lebermetastasen an 85 Patienten im Zeitraum von 1990 bis 2002 untersucht. Patientendaten, Behandlungsmethoden und postoperative Ergebnisse im Bezug auf Komplikationen und Überleben wurden analysiert und prognoserelevante Faktoren untersucht. Es wurde eine Unterteilung in 2 Gruppen vorgenommen, zum einen das Gesamtkollektiv aller 85 Patienten und das Kollektiv der 57 R0- resezierten Patienten. Es wurde für das Gesamtkollektiv ein medianes Überleben von 21,9 Monaten nach Metastasenresektion mit einem 1 JÜ von 66 % und einem 5JÜ von 21,5% ermittelt. In den 57 Fällen, in denen eine R0- Resektion, also eine Entfernung im Gesunden erzielt werden konnte, wurde ein medianes Überleben von 24,8 Monaten, ein 1 JÜ von 72% und einer 5 JÜ von 19,3% festgestellt. Die perioperative Morbidität betrug 10,6%, die Mortalität 1,2%. Aufgrund der limitierten Fallzahlen konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Überlebenswahrscheinlichkeiten der einzelnen Primärtumorenentitäten festgelegt werden. Dennoch zeichnete sich ab, dass bestimmte Tumorarten, wie das Ovarial Carcinom ein beachtliches Überleben aufwiesen. Von den untersuchten Prognosefaktoren erwiesen sich neben der Radikalität des Eingriffs, auch ein tumorfreies Intervall von 12 bis 24 Monaten und die metachrone Metastasierung als günstige Prognosefaktoren für ein verlängertes Überleben. Die vorgelegte Studie zeigt, dass Patienten in ausgesuchten Fällen von einer Leberresektion aufgrund nicht- kolorektaler Metastasen durchaus profitieren können. Nach Ausschluss einer extrahepatischen Metastasierung und bei Ausblick auf Resektabilität der Lebermetastasen stellt daher die Metastasenresektion eine sinnvolle Therapieoption, insbesondere im Rahmen multimodaler Therapieregimes dar.
Die Verwendung eines Immunsuppressivums (Tacrolimus) als Rinse-Solution zur Reduktion von Ischämie-Reperfusionsschäden bei der experimentellen Lebertransplantation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 09/19
Seit Beginn der 1990er Jahre sind protektive Wirkungen von Tacrolimus auf Ischämie-Reperfusionsschäden der Leber bekannt. Die in bisherigen experimentellen Arbeiten beschriebene Spenderpräkonditionierung erscheint jedoch wegen potenzieller Nebenwirkungen klinisch nicht umsetzbar. Eine amerikanische Arbeitsgruppe konnte dabei in einer klinischen Pilot-Studie zeigen, dass die Spülung humaner Lebern mit Tacrolimus (20ng/ml) vor Implantation zu einer signifikanten Reduktion von Ischämie-Reperfusionsschäden nach Lebertransplantation führte. Unsere Arbeitsgruppe hat umfangreiche Untersuchungen mit Glutathion als Therapeutikum von Ischämie-Reperfusionsschäden nach warmer und kalter Ischämie durchgeführt. Gleichzeitig scheint, dass intrazelluläres Glutathion bei Anwesenheit hoher Konzentrationen von ROS über die Induktion von Radikalkettenreaktionen beziehungsweise die Thiolierung anderer Proteine selbst als Mediator von Ischämie-Reperfusionsschäden fungieren kann. In Vorarbeiten untersuchten wir die Wirkung von Tacrolimus im isoliert-perfundierten Modell der Rattenleber. Die Vorbehandlung mit Tacrolimus bewirkte bei Zufuhr von H2O2 eine Verringerung des ROS-induzierten zellulären Schadens, ausgedrückt in einer dosisabhängigen, signifikanten Verringerung des LDH-Efflux. Als Ursache hierfür wird eine verminderte intrazelluläre Akkumulation von zytotoxischem GSSG diskutiert, das nach Tacrolimus-Gabe vermehrt in Galle und Blut freigesetzt wurde, während die Aktivität der an Bildung und Abbau von GSH/GSSG beteiligten Enzyme Katalase, GSH-Peroxidase und GSSG-Reduktase unverändert war. Dieser Effekt konnte durch Gabe des p38 MAPK Inhibitors SB203580 imitiert werden. Wir übertrugen daraufhin das Konzept der Tacrolimus-Rinse in das Modell der arterialisierten, orthotopen Lebertransplantation an der Ratte. Die Spülung der Leber (20ml) mit Tacrolimus unmittelbar vor Implantation in den Empfängerorganismus führte zu einer signifikanten Reduktion des Ischämie-Reperfusionsschadens, gemessen in Transaminasen, LDH sowie Gallefluss. Das höchste Ausmass an Zytoprotektion wurde durch eine Tacrolimus-Konzentration von 10 ng/ml erreicht, wobei die protektive Wirkung der Tacrolimus-Rinse in der 10 ng-Gruppe stärker ausgeprägt war als in der 50 ng-Gruppe. Die Ursachen für diese inverse Dosis-Wirkungsbeziehung sind unklar, zumal keine statistische Signifikanz zwischen den beiden Gruppen besteht. Außerdem fehlen bislang systematische Untersuchungen zur optimalen Tacrolimus-Dosis in dieser Versuchsanordnung. Als Wirkmechanismus der Tacrolimus-Rinse postulieren wir - aufbauend auf Voruntersuchungen im isoliert perfundierten Modell und den erhobenen in-vivo-Daten - Veränderungen der zellulären Glutathionhomöostase: Hepatozyten setzten im Modell der Lebertransplantation nach Tacrolimus-Rinse vermehrt zytotoxisches GSSG in Blut und Galle frei, wodurch ROS-vermittelte Zellschäden während der Reperfusion minimiert werden. Zusammenfassend kann aufgrund der bisherigen Untersuchungen gezeigt werden, dass die Tacrolimus-Rinse eine neue und klinisch praktikable Therapieoption von Ischämie-Reperfusionsschäden der Leber darstellen könnte.
Klinische Sicherheit, Effektivität und Biokompatibilität der DALI Apherese mit modifizierter Antikoagulation im Vergleich zum Standardverfahren
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Die Anwendung eines Hämoperfusionsverfahrens zur Lipidadsorption hat spezielle Kriterien der Biokompatibilität zu erfüllen, hierzu gehören das Fehlen von Interaktionen mit Erythrocyten, Leukocyten und Thrombocyten; die Abwesenheit von Hämolyse und Aktivierung der Gerinnung und Thrombosierung sowie Ausbleiben einer Komplement- oder Kinin-Kallikrein-Reaktion. Die direkte Adsorption von Lipoproteinen durch das DALI-Verfahren ist eine etablierte, vollblutkompatible, sichere, effektive und biokompatible Therapieoption zur Behandlung der Hyperlipoproteinämie. Modifikationen des etablierten und zugelassenen DALI-Systems müssen vor Anwendung in der Routinebehandlung nachweislich vergleichbare Eigenschaften aufweisen. Im standardisierten Verfahren erfolgt die erforderliche Antikoagulation mittels kombinierter Gabe eines Heparin-Bolus (20 IE/ kg KG) und kontinuierlicher Citratzumischung im Verhältnis von 1:20. In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Modifikationen der standardisierten Antikoagulation getestet. Unter Reduktion der Citratdosis auf ein Verhältnis von 1:40 bei gleichzeitiger Erhöhung des initialen Heparinbolus (60 IE/kg KG) konnte im Vergleich zur etablierten DALI-Apherese eine vergleichbar gute Effektivität des Verfahrens nachgewiesen werden. Die gemäß NUB-Richtlinien geforderte Absenkungsrate für LDL-Cholesterin über 60% konnte sowohl mittels modifizierter als auch etablierter Apherese erreicht werden. Die diskreten Vorteile des etablierten Verfahrens in der Absenkung des LDL-Cholesterins (69% vs. 62%), Gesamt-Cholesterins (57% vs. 53%) und des Lipoprotein (a) (70% vs. 66%) erscheinen klinisch nicht relevant. Die klinische Sicherheit beider Verfahren zeigte sich unbedenklich und ergab im Vergleich keine Unterschiede. Der Verlust an ionisiertem Calcium war bei Anwendung der modifizierten Antikoagulation erwartungsgemäß geringer (5% vs. 18%), klinisch resultierten daraus jedoch keine Unterschiede bezüglich der Verträglichkeit der Apheresen. Die Antikoagulation war bei Anwendung beider Antikoagulationsregime sicher und ausreichend gut, eine Aktivierung der plasmatischen Gerinnung gemessen anhand der Thrombin-Antithrombin-Komplexe fand in beiden Untersuchungsarmen nicht statt. Die Biokompatibilität beider Verfahren zeigte sich in der beschriebenen Studie vergleichbar zufriedenstellend. Zeichen der Hämolyse waren nicht detektierbar, Erythrocyten-, Leukocyten- und Thrombocytenzahlen waren bei Anwendung beider Verfahren im Wesentlichen vergleichbar stabil. Eine Aktivierung des Komplementsystems fand weder bei Durchführung des Standardverfahrens noch bei Modifikation des Antikoagulationsregimes statt. Eine relevante Aktivierung von Thrombocyten, detektiert mittels -Thromboglobulin, der polymorphnukleären Granulocyten (Elastase) oder der Monocyten konnte jeweils ausgeschlossen werden. Die Modifikation der Gerinnungshemmung aktivierte im tolerablen und vorbekannten Umfang das Kinin-Kallikrein-System, entscheidende Unterschiede zum etablierten Verfahren waren nicht nachweisbar. Aufgrund dieses Phänomens ist eine gleichzeitige Therapie mit ACE-Inhibitoren und DALI kontraindiziert. Insgesamt kann die untersuchte Modifikation der Antikoagulation bei DALI bedenkenlos in der klinischen Routine eingesetzt werden. Auch die Untersuchungen zu DALI ohne Gabe des etablierten initialen Heparin-Bolus und kontinuierlicher ACD-A Gabe im Verhältnis 1:20 zeigte sich klinisch sicher und bedenkenlos. Bedingt durch das dauerhafte ACD-A-Verhältnis 1:20 wurde im Vergleich zur historischen Kontrollgruppe eine geringere Konzentration ionisierten Calciums reinfundiert. Diese Tatsache bedarf ein besonderes Augenmerk bei Patienten, die zur Hypocalciämie neigen. Patienten, die eine orale Antikoagulation mit Phenprocoumon erhielten, wiesen eine ausreichend gute Antikoagulation währen der heparinfreien DALI-Apherese auf, die Aktivierung der plasmatischen Gerinnung fiel gering und vergleichbar zum Kontrollkollektiv aus. Bei Patienten ohne orale Antikoagulation zeichnete sich eine mäßige Aktivierung der plasmatischen Gerinnung durch die heparinfreie DALI-Apherese ab, jedoch ohne offensichtliche Relevanz. Dennoch gebietet die Durchführung des Verfahrens ohne Heparin Vorsicht. Die Zellzahlen für Thrombocyten, Leukocyten und Erythrocyten blieben auch ohne Gabe von Heparin stabil, eine Hämolyse bei heparinfreier Antikoagulation fand nicht statt. Eine klinisch relevante Aktivierung der Thrombocyten oder PMN-Granulocyten konnte nicht nachgewiesen werden. Die durch die negativ geladene Oberfläche des DALI-Adsorbers bedingte Aktivierung des Kallikrein-Kinin-Systems (Bradykinin) wurde durch das heparinfreie Verfahren nicht nennenswert verändert und hatte keine klinischen Nebenwirkungen zur Folge. Das Komplementsystem erfuhr keine evidente Aktivierung durch Weglassen des Heparins bei DALI. Die Effektivität der DALI-Apherese ohne Heparin ist vergleichbar zum etablierten Verfahren, LDL-Cholesterin konnte im Mittel um 65% gesenkt werden, Lp(a) um 62%.
Eine retrospektive Verlaufsanalyse sowie prospektive Fallbeobachtung zur retrograd venösen Perfusion als Therapieoption der diabetischen Gangrän und anderer infizierter Läsionen der Extremitäten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Thu, 11 Oct 2007 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/7815/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/7815/1/Nour-El-Din_Andreas.pdf Nour-El-Din, Andrea
Untersuchungen über die Folgen des Verlustes von retinalem Pigmentepithel nach chirurgischer Extraktion von chorioidalen Neovaskularisationen aufgrund altersbedingter Makuladegeneration
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Einleitung: Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist der führende Grund für Blindheit im Sinne des Gesetzes in den westlichen Industrienationen mit stark steigender Inzidenz und Prävalenz. Es gibt verschiedene Formen der AMD. Besonders die so genannte „feuchte Form“, die durch die Entstehung von chorioidalen Neovaskularisationsmembranen (CNV) am Ort des schärfsten Sehens gekennzeichnet ist, führt oft zu einem rasch progredienten Abfall des Visus. Für die Diagnostik solcher Neovaskularisationsmembranen dient neben der klinischen Untersuchung vor allem die Darstellung mittels Fluoreszenzangiographie (FLA), anhand derer auch eine weitere Einteilung von CNVs in verschiedene Typen (z.B. „klassische“ oder „okkulte“ Membranen) vorgenommen wird. Auch Defekte im retinalen Pigmentepithel, das topographisch der Netzhaut benachbart liegt, lassen sich diagnostisch mittels der FLA darstellen und quantifizieren. Bis dato stand als einzige aktive Therapieoption für diese Membranen die Verödung mittels Argon-Laser zur Verfügung, die allerdings auch unweigerlich mit einer Zerstörung der darüber liegenden neurosensorischen Netzhaut einhergeht. Daher wurde an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität der Weg der chirurgischen Intervention beschritten, bei dem nach einer Pars-Plana-Vitrektomie und Retinotomie die entsprechende subfoveal gelegene Membran oder Blutung aus dem Subretinalraum extrahiert wird. Zwangsweise kommt es – wie sich herausstellte – dabei durch die Membranstruktur bedingt jedoch auch immer zu einer Mitentfernung von retinalem Pigmentepithel (RPE), das für die Netzhaut eine trophische Funktion besitzt. Methodik: Bei der Nachbeobachtung der Patienten fiel auf, dass es zu Rezidiven von CNVs kam. Ausgangspunkt dieser Studie war die Fragestellung, ob ein Zusammenhang zwischen Größe der RPE-Defekte und Rezidivwahrscheinlichkeit besteht. Hierzu wurden retrospektiv die Krankenakten und Fluoreszenzangiographien von 51 operierten Patienten ausgewertet, die Größe der RPE-Defekte auf postoperativ angefertigten Angiographien ausgemessen und zum Auftreten eines Rezidives bzw. zum Rezidivzeitpunkt in Relation gesetzt. Ergebnisse: Dabei konnte festgestellt werden, dass kleinere RPE-Defekte mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sowohl für ein Auftreten eines Rezidives, als auch mit der für einen früheren Rezidivzeitpunkt einhergehen. Des weiteren ergab sich eine negative Korrelation zwischen der Größe des RPE-Defektes und dem bestkorrigierten Visus zu verschiedenen postoperativen Zeitpunkten während des ersten Jahres nach der Operation (bei einer Nachbeobachtungszeit von bis zu vier Jahren). Dementsprechend ergab sich auch eine positive Korrelation mit dem benötigten Vergrößerungsfaktor einiger Patienten. Zudem lässt sich eine Funktionsdiagnostik der Netzhaut, v.a. der Makula, mit Hilfe der Mikroperimetrie betreiben. Bei den mit dieser Diagnostikmöglichkeit untersuchten Patienten zeigten sich statistisch signifikante positive Korrelationen zwischen den RPE-Defekten und den gemessenen absoluten und relativen Skotomen. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Größe des RPE-Defektes und einer Visusverbesserung oder –verschlechterung konnte dabei nicht festgestellt werden, jedoch eine positive Korrelation zwischen präoperativen und dem besten postoperativ erreichten Visus. Diskussion: Mit Hilfe der chirurgischen Membranektomie lässt sich zwar eine Stabilisierung der Sehschärfe erreichen, die entstandenen RPE-Defekte sind aber Ursache des fehlenden Anstiegs des Visus. Andere Faktoren wie Vorschädigungen der Strukturen von Aderhaut, Bruch’scher Membran, RPE und Netzhaut durch den Krankheitsprozess spielen eine zusätzliche Rolle. Auch Lokalisation und Wachstumsmuster von Neovaskularisationen können einen Einfluss auf die postoperativ erreichten Sehschärfen haben. Dies zeigt sich insbesondere im Vergleich mit in der Literatur angegebenen Ergebnissen nach subfovealer Membranektomie bei anderen Erkrankungen, die mit der Bildung chorioidaler Neovaskularisationen einherge-hen. Die Beobachtung, dass kleinere RPE-Defekte mit einer erhöhten Rezidivrate einhergehen, lässt Rückschlüsse auf die mögliche Rolle des RPE bei der primären Krankheitsentstehung zu. Insbesondere unterstützt sie die These, dass zwischen zentralem und mittelperipherem retina-len Pigmentepithel Unterschiede bestehen z.B. in Bezug auf die Synthese von Wachstumsfak-toren, die bei der Entstehung solcher Membranen eine entscheidende Rolle spielen oder al-tersbedingte Unterschiede bezüglich der regenerativen Kapazität der RPE-Zellen. Für künfti-ge Therapieoptionen mit dem Resultat einer verbesserten Sehschärfe müssten Wege gefunden werden, den geschädigten Komplex von Bruch’scher Membran und RPE wiederherzustellen.
Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran bei der experimentellen zerebralen Ischämie mit Reperfusion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Experimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass es beim Schlaganfall in der Reperfusionsphase zu einer Schädigung der Basalmembran und zu einem Zusammenbruch der mikrovaskulären Integrität kommt. Dies kann zu einer intrazerebralen Hämorrhagie mit zusätzlichen neurologischen Schäden führen. Die systemische Thrombolyse mit rekombinantem Gewebe-Plasminogen-Aktivator (rt-PA) zielt auf die Fibrinolyse des Thrombus, der das Hirngefäß verschließt, um den zerebralen Blutfluß wiederherzustellen und den Infarkt zu verkleinern. Jedoch haben klinische Studien gezeigt, dass die Thrombolyse die Gefahr einer intrazerebralen Blutung steigert. Klinische und experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass eine postischämische Hypothermie das Infarktvolumen verkleinern kann. Der postulierte Wirkungsmechanismus einer Hypothermie ist die Verminderung der Aktivität unspezifischer und spezifischer proteolytischer Systeme (z.B. endogene Plasminogenaktivatoren (u-PA und t-PA) oder die Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9). Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran der Hirngefäße nach einer zerebralen Ischämie mit Reperfusion zu untersuchen und mögliche Schädigungsmechanismen darzulegen. Hierzu wurde bei narkotisierten, beatmeten Ratten eine 3-stündige transiente fokale zerebrale Ischämie mit 24-stündiger Reperfusion erzeugt. Postischämisch wurde durch extrakorporale Kühlung eine 24-stündige milde bis moderate Hypothermie erzeugt und mittels Temperatursonde ständig gemessen und überwacht. Nach Beendigung des Versuches wurden die Hirne entnommen und einer volumetrischen, immunohistochemischen und biochemischen Aufarbeitung und Auswertung zugeführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine postischämische Hypothermie die Degradation der Basalmembran zum großen Teil verhindert und die Infarktgröße signifikant reduziert. Gleichzeitig kommt es durch diesen strukturellen Erhalt der Basalmembran zu einem funktionellen Erhalt der Integrität und zu einer Verminderung der Extravasation von korpuskulären und nichtkorpuskulären Blutbestandteilen. Zusätzlich konnte eine mögliche Ursache für die Degradation der Basalmembran und den Verlust der mikrovaskulären Integrität aufgezeigt werden. Die postischämische Hypothermiebehandlung verhinderte die Steigerung der Aktivität der Plasminogen-Aktivatoren u-PA und t-PA und der Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9. Wir schließen aus den vorliegenden Untersuchungen, dass eine postischämische Hypothermie das Risiko des Auftretens einer Hämorrhagie als gefürchtete Komplikation nach einer zerebralen Ischämie senken kann. Dies gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da die therapeutische Anwendung der systemischen Thrombolyse die Gefahr des Auftretens einer Hämorrhagie steigert. Eine systemische Thrombolyse in Kombination mit einer Hypothermie wäre eine mögliche Therapieoption, um die Gefahr des Auftretens einer intrazerebralen Blutung zu vermindern. Der genaue Pathomechanismus ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Deshalb sind vor der Anwendung beim Menschen noch weitere experimentelle und klinische Studien notwendig.
Auswirkungen der invasiv ausgestesteten medikamentösen antiarrhythmischen Therapie auf die Prognose von Patienten mit ventrikulären Tachyarrhythmien
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Ventrikuläre Tachykardien und Kammerflimmern gelten als Hauptursache des plötzlichen Herztodes, der ca. 50 % aller kardial bedingten Todesfälle ausmacht und somit eine häufige Todesursache darstellt. Bei Patienten, die diese ventrikulären Rhythmusstörungen überlebt haben, besteht innerhalb des folgenden Jahres ein 10 – 30 %iges Risiko des Wiederauftretens. Somit stellt nach der Akutbehandlung bei diesen Patienten vor allem die Prophylaxe bzw. die Therapie weiterer Ereignisse dieser potentiell lebensbedrohlichen ventrikulären Herzrhythmusstörungen ein wichtiges medizinisches Problem dar. Als Behandlungsmöglichkeit von Patienten mit ventrikulären Tachyarrhythmien hat in den letzten Jahren vor allem der implantierbare Kardioverter-Defibrillator an Bedeutung gewonnen. Dennoch ist auch die medikamentöse antiarrhythmische Therapie auf der Basis der seriellen Testung eine weiterhin bestehende Therapieoption. Studien, die den Verlauf von Patienten mit medikamentös supprimierbarer Rhythmusstörung mit dem Verlauf von Patienten vergleichen, bei denen eine Suppression der Induzierbarkeit in der elektrophysiologischen Untersuchung nicht gelingt, zeigen für die erstgenannte Patientengruppe eine Verbesserung der Prognose hinsichtlich des Arrhythmierezidivrisikos. Es gibt bisher jedoch keine Studie, die den Wert der als effektiv getesteten antiarrhythmischen Therapie gegenüber einer Kontrollgruppe überprüft hat. Daher sind zwei verschiedene Interpretationen dieser Ergebnisse möglich. 1. Der gezielte Einsatz des Antiarrhythmikums verhindert ein Rezidiv der Rhythmusstörung und verbessert damit die Prognose. 2. Die Methode der seriellen programmierten Ventrikelstimulation selektiert die Patienten in solche mit guter und schlechter Prognose, unabhängig davon, ob sie das als effektiv getestete Antiarrhythmikum erhalten oder nicht. In dieser Arbeit sollte im Rahmen der prospektiven kontrollierten multizentrischen Studie "ADIOS" (Antiarrhythmic Drugs Improve Outcome Study) geprüft werden, welche dieser beiden Interpretationsmöglichkeiten zutreffend ist.
Die Rolle der bakteriellen Darmflora in der Kolitis der Interleukin-2 defizienten Maus
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Charakterisierung der der Rolle von T-Zellen in der Kolitis der Interleukin-2 defizienten Maus (IL-2-/-) und der Beteiligung der physiologischen Darmflora an der Pathogenese. Die Untersuchungen der mRNA-Expression im Kolon ergaben, daß die Kolitis der IL-2-/- Maus durch die Zytokine TNF-α, IFN-γ und IL-1 gekennzeichnet war, was auf eine T-Zell vermittelte Immunreaktion vom TH1-Typ schließen läßt. Ausserdem konnte mit dieser sensitiven Methode gezeigt werden, daß die Abwesenheit einer bakteriellen Darmflora zu einer drastischen Minderung der Kolits führte. Daraus kann man ableiten, daß der Einfluss der Nahrungsantigene auf die Koilitis eher gering ist, wogegen die bakterielle Darmflora den massgeblichen Stimulus für die Entstehung der Kolitis der IL-2-/- Maus darstellt. Ausserdem ist die Identifizierung der am Entzündungsgeschehen beteiligten Zytokine Voraussetzung für die Entwicklung neuer Pharmaka zur Beeinflussung dieser Mediatoren. Die durchflusszytometrischen Untersuchungen und die Analyse des Migrationsverhaltens belegten die vermehrte Einwanderung von αβTCR+CD4+ T-Zellen in das Kolon erkrankter Tiere. Eine direkte Beeinflussung von CD4+ T-Zellen könnte daher ebenfalls eine neue Therapieoption sein. Die Studien der der pathologisch gesteigerten T-Zell Einwanderung zu Grunde liegenden Mechanismen ergaben, daß dem endothelialen Addressin MAdCAM-1 eine dominante Rolle in der Lymphozytenrekrutierung in der Kolitis der IL-2-/- Maus zukommt, wogegen das Addressin VCAM-1 keine nachweisbare Beteiligung an der Vermittlung der Inflammation hat. Ferner zeigte die vorliegende Studie auch, daß die Funktion von MAdCAM-1 bei der Rekrutierung von CD4+ T-Zellen auch während der Kolitis auf das Darmkompartiment beschränkt bleibt. Dies macht MAdCAM-1 zu einer sehr interessanten Zielstruktur für einen neuartigen therapeutischen Ansatz zur Behandlung von CED. Gleichzeitig belgen die präsentierten Daten, daß eine weitgehende funktionelle Blockade der Lymphozytenrekrutierung an den Ort der Entzündung mit monoklonalen Antikörpern möglich ist. Experimente mit einer längeren Anwendungsdauer der monoklonalen Antikörper werden über die therapeutische Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Anwendung Auskunft geben. Die Analyse der Reaktivität der interstinalen T-Zellen der IL-2-/- Maus gegenüber Antigenen der bakteriellen Darmflora ergab keinen Hinweis auf eine gesteigerte proinflammatorische Reaktivität. Durch die Etablierung von spezifischen T-Zellinien konnte im Gegenteil sogar gezeigt werden, daß trotz der massiven Inflammation des Kolons der IL-2-/- Maus T-Zellen mit potentiell antiinflammatorischem Zytokinmuster vorhanden waren. Dies widerlegte die Anfangshypothese einer pathologisch gesteigerten T-Zell Reaktivität gegenüber Antigenen der Darmflora und impliziert, daß T-Zellen nicht primär in die Krankheitsentstehung verwickelt sind, sondern sekundär aktiviert werden und daraufhin die klinische Manifestation der Kolitis vermitteln. Zukünftige Untersuchungen werden der Frage nachgehen, welche Zellen direkt von der Flora stimuliert werden und wie dies zu einer sekundären Beteiligung von T-Zellen führt. Die bedeutende Rolle der Darmflora für die Entstehung von CED kann als gesichert gelten. Für Bacteroides vulgatus lagen zu Beginn der vorliegenden Arbeit mehrere Berichte über eine Beteiligung an der Kolitis in CED-Modellen vor. Um die Beteiligung verschiedener apathogener Vertreter der physiologischen Darmflora an der Kolitisentstehung in der IL-2-/- Maus zu untersuchen, wurden Mäuse mit einem oder zwei apathogenen Keimen der Darmflora besiedelt. Diese Experimente zeigten, daß Escherichia coli alleine eine massive Kolitis auslöste, wogegen Bacteroides vulgatus keine Kolitis bewirkte und im Gegenteil sogar vor der E. coli-induzierten Kolitis schützte. Erste Arbeiten zu den hierbei beteiligten Mechanismen zeigten keine vermehrte Epitheladhärenz von E. coli in Mäusen mit Kolitis. Die Suche nach einigen bekannten E. coli-Virulenzfaktoren für den Menschen blieb negativ. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von E. coli und B. vulgatus kamen beide Keime in erhöhter Dichte im Stuhl vor, so daß eine Kompetition um Nahrungsangebot nicht für die Verhinderung der E. coli-induzierten Kolitis durch B. vulgatus verantwortlich war. Diese Daten zeigen, daß ein vermeindlich apathogener Vertreter der Darmflora im entsprechend prädisponierten Organismus eine schwere Kolitis auslösen kann. Da die hierfür verantwortlichen Mechanismen und Virulenzfaktoren noch nicht aufgeklärt sind, mahnen die gewonnenen Erkenntnisse zu großer Sorgfalt bei der Auswahl von E. coli-Stämmen zur probiotischen Therapie. Zukünftige Arbeiten werden sich mit der Aufklärung der für die Kolitisinduktion relevanten Virulenzfaktoren von E. coli beschäftigen.
Anthrazykline und Herceptin® als neue Therapieoption beim metastasierten Mammakarzinom
Single-agent treatment with the humanized monoclonal antibody trastuzumab (herceptin) has shown remarkable activity in patients with metastatic breast cancer overexpressing the HER-2/neu proto-oncogen. Further significant advances could be achieved with the combined use of herceptin and paclitaxel or doxorubicin/cyclophosphamide. However, cardiotoxicity remains a significant and thus far unresolved problem of the herceptin-doxo-rubicin combination. Thus, several studies have recently been initiated to identify equally effective but less toxic first-line regimens. Epirubicin, the taxanes paclitaxel and docetaxel, Navelbine(R), cisplatin, and Caelyx(R), a liposomal encapsulated formulation of doxorubicin, were selected for combination with herceptin in these studies because the appeared the most promising agents.