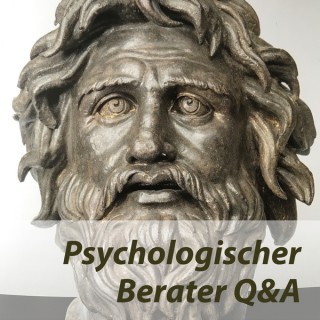Podcasts about behandlungserfolg
- 35PODCASTS
- 42EPISODES
- 34mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Apr 23, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about behandlungserfolg
Latest podcast episodes about behandlungserfolg
Untersuchung mehr als Therapiegrundlage | Kontrolle, Prognose und Patientenbindung (#52)
In dieser Folge vom Chiropraktik Campus spricht Jaan Peer mit Philipp über die oft unterschätzte Bedeutung von Untersuchungen in der chiropraktischen Praxis. Was zunächst wie Routine wirkt, entpuppt sich als Schlüssel für erfolgreiche Therapieprozesse. Die beiden geben tiefe Einblicke in Themen wie Patientenbindung, Messbarkeit, Kontrolle, Prognosen und nachhaltigen Behandlungserfolg. Wenn dir dieses Know-how noch fehlt oder du deine Perspektive erweitern möchtest – diese Folge ist ein absolutes Muss! ⬇️ MEHR VOM CHIROPRAKTIK CAMPUS HAMBURG ⬇️ ► Instagram: https://www.instagram.com/chiropraktikcampus/ ► Homepage: https://www.chiropraktik-campus.de ► Seminare: https://seminare.chiropraktik-campus.de/hamburg/ Impressum: https://www.chiropraktik-campus.de/impressum/ _______________ Inside Chiropraktiker, Chiropraktiker, Chiropraktik, Physiotherapie, Gesundheitspraxen, Gesundheitsbranche, Patientenbindung, Gesundheit, Medizin, Physiotherapeut, Orthopädie, Praxis, Beyond Chiropraktik, ChiroHype, Chiropraktik Campus Hamburg, Sandra Tille, Seminare Chiropraktik, Studium Chiropraktik, Jaan-Peer Landmann, Marco Djahanbaz, Philipp Petterich
"Sport bei Krebs" . Eine Palliativpatientin klärt auf & erzählt von ihrem Weg
Hat mir jemals eine Onkologe Bewegung empfohlen? Leider nicht. Das habe ich mir selbst angeeignet. Meine Erfahrung: Eigeninitiative ist oft der beste Weg.Unser Gesundheitssystem ist nicht das Schlechteste, sonst wäre ich nicht mehr am Leben. Aber es ist teuer und stark auf Medikamente ausgerichtet. Die Schulmedizin legt wenig Wert auf integrative Ansätze oder Prävention – mit Ausnahme von Brustkrebs.Viele politische Entscheidungen werden durch wirtschaftliche Interessen beeinflusst, denn hinter ihnen stehen oft finanzstarke Unternehmen.“Weitere Informationen & Links
#260: Gemeinsame Entscheidungsfindung für den Behandlungserfolg bei MS mit Prof. Christoph Heesen
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Prof. Heesen erklärt, was es für die gemeinsame Entscheidungsfindung bei MS braucht, die Vor- und Nachteile sowie Möglichkeiten und Grenzen. Das komplette Transkript vom übersetzten Interview gibt es auf meinem Blog zum Nachlesen: https://ms-perspektive.de/260-sdm-heesen Im heutigen Interview geht es um das Thema der gemeinsamen Entscheidungsfindung, dass auch im deutschen Sprachraum meist als Shared Decision Making, kurz SDM, bezeichnet wird. Natürlich bezogen auf die Behandlung von MS. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu ermöglichen? Wie intensiv wird sie bereits praktiziert? Was sind die Vor- und Nachteile, wenn Patienten gemeinsam mit ihrem Neurologen entscheiden, wie ihre persönliche MS behandelt werden soll? Über all diese Fragen und noch mehr habe ich mit Prof. Dr. Christoph Heesen auf dem englischen Podcast gesprochen. Ihm liegt das Thema sehr am Herzen und er hat eine Reihe von Informationsangeboten für die deutschsprachige Patientengemeinschaft entwickelt, um Patienten eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Die deutsche Übersetzung des Interviews wurde durch die freundliche Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Gesellschaft ermöglicht. Inhaltsverzeichnis Vorstellung - Wer ist Prof. Dr. Christoph Heesen? Grundsätze der gemeinsamen Entscheidungsfindung Umsetzung und Herausforderungen der gemeinsamen Entscheidungsfindung (SDM) Praktische Aspekte und Beispiele Erweiterte Aspekte der gemeinsamen Entscheidungsfindung Verabschiedung Vorstellung - Wer ist Prof. Dr. Christoph Heesen? Prof. Dr. Christoph Heesen ist Oberarzt, Leiter des MS-Zentrums und Neurologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Deutschland. Er war schon einige Male mein Gast für den deutschen MS-Perspektive-Podcast. Wir sprachen über die Stammzellentherapie und für wen diese Behandlung eine gute Option ist. Ein weiteres Interview konzentrierte sich auf die von seinem Team entwickelten deutschen Patienteninformationsplattformen, die Patienten mit Informationen über Behandlungsmöglichkeiten versorgen sollen. Die Plattformen enthalten Aussagen von PatientInnen, die sich positiv, neutral und negativ zu bestimmten Optionen äußern, um ein eigenes Meinungsbild zu ermöglichen. Wie und wo können interessierte Personen mehr Informationen über die gemeinsame Entscheidungsfindung bei MS oder sogar allgemeiner bei der medizinischen Behandlung finden? Prof. Christoph Heesen: Wir haben die International Society of Shared Decision-Making. Sie hat eine Website und veranstaltet alle zwei Jahre eine Konferenz, glaube ich. Die nächste wird in der Schweiz sein, wenn ich richtig informiert bin. Was krankheitsspezifisch ist, hängt natürlich sehr von dem jeweiligen Land und der Sprache ab. Um ehrlich zu sein, ist mir nicht bekannt, dass es auf internationaler Ebene ein Portal zur gemeinsamen Entscheidungsfindung für MS-Patienten gibt, das sich wirklich mit diesem Konzept befasst. Natürlich gibt es mehr oder weniger fortschrittliche Websites, z. B. von der britischen MS-Gesellschaft, die im Allgemeinen die Einstellung vertritt, dass die Patienten ihre Entscheidungen selbst treffen müssen und wie man die Patienten darüber informiert. Aber dieser Ansatz der gemeinsamen Entscheidungsfindung, ein gezielter Ansatz, ist nicht wirklich weit verbreitet. Es wird vielleicht anders verkauft, und ich denke, dass die allgemeine Einstellung in MS-Zentren in größeren, zumindest westlichen MS-Zentren in diese Richtung geht, aber es wird nicht in dieser Weise herausgeschrien. Ich muss also gestehen, dass ich nicht wirklich in der Lage bin, dies zu bieten. Als internationale Gruppe in Deutschland haben wir ein paar Werkzeuge, die man nutzen kann. Wir haben die meisten von unseren hinten reingestellt, aber es tut mir leid die meisten sind… Nele Handwerker: Nur auf Deutsch. Ja, aber ich denke, es lohnt sich auch, bei der Europäischen MS-Gesellschaft und der Internationalen MS-Gesellschaft nachzuschauen. Zumindest versuchen sie, ihren Teil zur Patientenaufklärung beizutragen, und das ist, wie wir definiert haben, natürlich eine Grundlage für die gemeinsame Entscheidungsfindung. Fantastisch. Christoph, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, mit dir auf Englisch zu sprechen, das nächste Mal wieder in Deutsch, denke ich. Und ich hoffe, du da draußen hast jetzt ein besseres Verständnis und weißt, was möglich ist, aber auch, wo die Vorteile, die Nachteile liegen, und vielleicht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Vielen Dank, Christoph. Bye bye. Prof. Christoph Heesen: Bye-bye. MS-Patientenerfahrung.de --- Bis bald und mach das Beste aus Deinem Leben, Nele Mehr Informationen und positive Gedanken erhältst Du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest Du eine Übersicht zu allen bisherigen Podcastfolgen.
#56 Top-Arzt gesucht und gefunden
Auf Herz und Nieren – Der Podcast für ein gutes Körpergefühl
Die Frage nach dem passenden Arzt lässt sich nicht so leicht beantworten. Jeder Patient hat eigene Erwartungen. Trotzdem gibt es wissenschaftlich untersuchte Kriterien, wann der Behandlungserfolg eines Arztes besonders hoch ausfällt. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Dr. Marcel Schorrlepp, hausärztlicher Internist aus Mainz und Sprecher der Arbeitsgruppe Hausärztliche Internisten der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr das Optimale aus dem Arztbesuch herausholt und wie ihr schneller einen Termin beim Facharzt bekommt.
Die Themen im heutigen Versicherungsfunk Update sind: Sparer änderten Geldanlage in der Inflation Jüngere und mittlere Altersgruppen haben sich während der stark gestiegenen Inflation in den Jahren 2022 und 2023 verstärkt Gedanken über ihre Geldanlage gemacht. Eine Änderung der Geldanlageform war die zweithäufigste Reaktion auf die Inflation in Finanzbelangen. Von allen Befragten hatten 32 Prozent dies schon umgesetzt oder planten einen solchen Schritt. Knapp die Hälfte von ihnen erklärte, nun langfristiger zu sparen. Allerdings nur ein gutes Drittel legt nun auch sicherer als bisher an. Das ergab die jüngste Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) mit dem Titel „Wenn der Euro an Wert verliert“. DFV erreicht Profitabilitätsziel Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat im Geschäftsjahr 2023 den Versicherungsumsatz um sieben Prozent auf 118 Millionen Euro gesteigert. Das Neu- und Mehrgeschäft in der Erstversicherung habe 19 Millionen Euro betragen und liege damit um fast 30 Prozent über Plan. Die gebuchten Bruttobeiträge wachsen um 4,8 Prozent auf 192 Millionen Euro, einschließlich des in 2021 aufgenommenen Rückversicherungsgeschäfts, das aber nicht gewachsen ist. Dadurch sei ein Konzernergebnis vor Steuern von fünf Millionen Euro erwirtschaftet worden. In der Konzernmutter konnte nach HGB ein Gewinn vor Steuern von 7,8 Millionen Euro erzielt werden. blau direkt bringt Aktivitäten-Feed ins MVP Das Maklerverwaltungsprogramm Ameise bekommt einen Aktivitäten Feed. Makler sollen in Echtzeit alle wichtigen Ereignisse zu ihren Vorgängen innerhalb des MVP in einer übersichtlichen Darstellung einzusehen können. Ein zentraler Bestandteil ist hierbei die Anzeige aller verarbeiteten Dokumente, die über die BiPRO-Schnittstellen von den Gesellschaften bereitgestellt werden. So können künftig beispielsweise Kunden-Aktivitäten innerhalb der Endkunden-App angezeigt werden. Auch Aktualisierungen bei der Meldung eines Schadenfalls sollen künftig integriert sein. Inter kooperiert mit Kliniknachsorge Vollversicherte der Inter mit psychischen Erkrankungen haben ab sofort die Möglichkeit, die Nachsorgeprogramme von mentalis für 12 Monate kostenfrei zu nutzen. Durch die Teilnahme soll der Behandlungserfolg aus (teil-)stationären Aufenthalten langfristig sichergestellt werden. Dabei wird eine therapeutische App mit psychologischen Telefongesprächen kombiniert – und das sofort zugänglich und ohne Wartezeit für die Patienten. Rating Risikolebensversicherung 2024 Auf der Suche nach den besten Risiko-Lebensversicherungen 2024 hat Franke und Bornberg 112 Tarife von 60 Gesellschaften nach 38 Kriterien analysiert. 26 Tarife und Tarifvarianten und damit fast ein Viertel der Angebote qualifizieren sich für die Bestnote FFF+ „hervorragend“. Die zweithöchste Bewertung FFF „sehr gut“ erreichen nur zehn Tarife. Ungefähr die Hälfte aller Produkte werden mit FF „gut“ bewertet. Die Gruppe der Minderleister (F+, F und F-) ist mit 4,46 % gegenüber dem Erstrating deutlich geschrumpft. LKH bietet Telemedizin an Durch eine Kooperation mit MD Medicus können Versicherte der LKH Landeskrankenhilfe V.V.a.G. in der Krankenvollversicherung und in einer Beihilferestkostenversicherung telemedizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Die telemedizinische Beratung erfolgt für die Versicherten ohne weitere Kosten. Kunden in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) können Telemedizin ebenfalls beanspruchen – ohne Anrechnung auf das Budget.
„Hilfe, mein Angebot kann ich nicht online ausliefern!“
Gehörst Du zu den Selbständigen, die so gerne wachsen und skalieren wollen, aber deren Angebot leider derzeit noch viele 1:1-Sitzungen, Vor-Ort-Termine oder Körperbehandlungen einschließt? Denkst Du oft: „Schade, ich hätte ja gerne ein Onlinebusiness, aber es geht ja nicht!“. Eine gute Nachricht: DOCH, es geht! Lass Dich nicht entmutigen. Wir wissen: Jedes Business hat Onlinechancen – man sieht sie nur nicht sofort. Im UP-Lift Coaching zeigen wir Dir, wie Du die Online-Chancenbrille aufsetzt und eine Möglichkeit findest, wie Dein offline-lastiges Business immer mehr „online geht“. Drei Lieblingsfragen haben wir Dir mitgebracht: 1. Was, wenn das, was ich denke, nicht stimmt? 2. Wie kann es dennoch gehen? 3. Wie hätte ich es gerne? Sobald Du tiefer in die Fragen eintauchst, wirst Du sehen: Es gibt Möglichkeiten außerhalb Deiner jetzigen Denkbox. Die „Wie ich es immer schon gemacht habe“-Denkbox ist viel zu klein. Die coolen, smarten Möglichkeiten sind außerhalb. Im Coaching gehen wir tiefer darauf ein. Für heute geben wir Dir 5 Impulse mit 1. Hybridmodelle offline/online 2. Offline-Erlebnisse online „simulieren“ 3. Leistung in Teilergebnisse aufteilen und dann entscheiden, welcher Teilschritt online und welcher offline. Vor- und Nachbereitung könnte auch online erfolgen und nur Hauptsession vor Ort. 4. Transformation erhöhen, Mehrwert steigern durch wertvolleres, größeres Ergebnis als das reine Offline-Event 5. Behandlungserfolg durch angeleitete Selbsthilfeübungsvideos erhöhen und somit mehr Umsatz pro investierter Patienten-Zeiteinheit Challenge mit uns Deine Onlinechancen: up-lift.de/strategiegespraech Abonniere unseren YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/c/erfolgreichimherzbusiness
Dr. Jürgen Fleischmann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin & Psychotherapeut, Sinzig/Rhein und PD Dr. Daniel Alvarez-Fischer, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Lübeck, sprechen im zweiten Teil der Podcast Folge „ADHS – Transition“ weiter über das Thema Transition bei ADHS-Patienten und wie diese gelingen kann. In der Medizin bezieht sich Transition auf den geplanten Übergang von einer kindzentrierten zu einer erwachsenenorientierten Gesundheitsversorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Eine gelungene Transition ist insofern von Bedeutung, da diese zu einem langfristigen Behandlungserfolg beiträgt.
Eine Prothese aus dem 3D-Drucker – Wie Innovationen die Nothilfe verändern
Der flüssige Kunststoff verlässt die Nadel: Schicht für Schicht wird er von der Maschine aufgetragen – das Objekt nimmt immer konkretere Formen an. “Dieser 3D-Drucker kann praktisch jede Prothese drucken, solange sie eine bestimmte Größe nicht überschreitet”, sagt David Treviño. Er berät Logistiker*innen bei bei Ärzte ohne Grenzen und berichtet in der 41. Episode der “Notaufnahme” über den Einsatz von 3D-Druckern und anderen innovativen Technologien in unseren Projekten. Die Co-Moderatoren Christian Conradi und Christian Katzer testen gemeinsam mit dem Logistikberater einen 3D-Drucker im Studio und sprechen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: von Ersatzteilen über Modifikationen bestehender Geräte bis hin zu medizinischen Gesichtsmasken für die Behandlung von schweren Verbrennungen. “3D-Drucker sind ein wichtiges Werkzeug mit enormem Potenzial für uns”, sagt David Treviño. Die Patientinnen Aisha und Fozza berichten zudem, wie von uns gedruckte Prothesen und Gesichtsmasken den Behandlungserfolg und damit auch ihre Lebensqualität verbessert haben. Der Einsatz moderner technischer Mittel erlaubt es uns, effizient zu arbeiten, Kosten zu senken und die Versorgung für unsere Patient*innen zu verbessern. Auch Oliver Schulz, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Schweden, nennt in der Folge Beispiele. Ein Team aus dem Land arbeitet mit Hochdruck an neuen Instrumenten - unter anderem sind eine App für Diabetes-Patient*innen und solarbetriebene Klimaanlagen entwickelt worden. Solche Entwicklungen sind aber nur möglich, wenn wir auch genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Wir freuen uns daher, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen: www.msf.de/spenden. Bei Fragen, Kritik oder Themenwünschen schreiben Sie uns gerne an notaufnahme@aerzte-ohne-grenzen.de. Dieser Podcast wurde von Ärzte ohne Grenzen e.V. in Zusammenarbeit mit Christian Conradi produziert. Redaktion und Projektleitung: Sebastian Bähr, Anna Hallmann und Nina Banspach. Moderation, Aufnahme, Schnitt und Produktion: Christian Conradi. V. i. S. d. P. Jannik Rust, Ärzte ohne Grenzen e. V., Schwedenstr. 9, 13359 Berlin. Bild: MSF
#53 Ist Hands on in der Physiotherapie tot? - mit Boris Zupa
Der DKKA Fitness- und Personal Trainer Podcast | Ausbildung | Karriere | Weiterentwicklung
Dr. Jürgen Fleischmann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin & Psychotherapeut, Sinzig/Rhein und PD Dr. Daniel Alvarez-Fischer, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Lübeck, sprechen über das Thema Transition bei ADHS-Patienten und wie diese gelingen kann. In der Medizin bezieht sich Transition auf den geplanten Übergang von einer kindzentrierten zu einer erwachsenenorientierten Gesundheitsversorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Eine gelungene Transition ist insofern von Bedeutung, da diese zu einem langfristigen Behandlungserfolg beiträgt.
Inwiefern unterscheiden sich die Substanzen Psilocybin, MDMA (Ecstasy) und Ketamin von klassischen Antidepressiva?Wie würden Sie den Erkenntnisstand zu deren therapeutischem Einsatz zusammenfassen?Für wen ist eine Behandlung mit Psychedelika, MDMA und Ketamin indiziert und wie läuft sie ab?Wovon hängt der Behandlungserfolg ab und ist der Trip ein integraler Bestandteil dessen? Wie ist die Wirksamkeit einer solchen Behandlung im Vergleich zu klassischen Antidepressiva? Diese und weitere Fragen beantwortet Prof. Dr. Andreas Reif (Uniklinik Frankfurt) im Interview anlässlich der Frankfurter Psychiatriewoche (https://www.psychiatrie-frankfurt-am-main.de/veranstaltungen/2023-09/).Website: https://www.miriamvanlijnden.deInstagram: freudundleidpodcast
Ayurveda und eine gesunde Haut – Interview mit Dr. Julia Lämmerhirt
Podcast #305 - Diese Episode ist eine Mischung aus einem thematischen Intro von mir und einem anschließenden Interview mit Dr. Julia Lämmerhirt. Da viele von euch immer wieder Fragen zu Ayurveda und der Haut gestellt haben, möchte ich euch diese Episode zur Verfügung stellen. Die Haut wird aus ayurvedischer Sicht ganzheitlich betrachtet, und wir können viel für die Haut tun. Umgekehrt kann die Haut aber auch als Spiegel des allgemeinen Gesundheitszustandes betrachtet werden. Dr. Julia Lämmerhirt ist Hautärztin und Ayurveda-Expertin mit einer eigenen Praxis in Wien. Nebenbei hat sie ein Online-Business mit dem Thema "Akne ganzheitlich loswerden" aufgebaut. Das Online-Programm kombiniert Wissenschaft und Ayurveda. Schon während ihrer medizinischen Ausbildung war es ihr wichtig, den Patientinnen praktische Tipps zur Ernährung und Lebensweise für zu Hause zu geben, um den Behandlungserfolg nachhaltig zu unterstützen. Du lernst in dieser Podcast Episode: wie der Ayurveda die Haut grundsätzlich betrachtet wie sich die Doshas auf die Haut auswirken können Welche ayurvedischen Maßnahmen du im Sommer ergreifen kannst, um deine Haut zu pflegen. Wie du die Haut durch zusätzliche Komponenten unterstützen kannst. Welche Pflegebedürfnisse unsere Haut hat. Unterschiedliche Hautdysbalancen, mit denen wir konfrontiert sein können. Weitere Informationen zu Dr. Julia Lämmerhirt:Website: www.drlaemmerhirt.comInstagram: https://www.instagram.com/drlaemmerhirt/ Facebook: https://www.facebook.com/drlaemmerhirt/ Die Türen zur neuen Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung sind wieder geöffnet!Wir starten in das 7. Ausbildungsjahr und es ist wirklich unglaublich, was sich in diesen Jahren alles getan hat. Es werden 12 Monate voll mit hochwertigem Ayurveda, Coaching und Business Inhalten sein. Für alle Frühbucher gibt es einen tollen Coaching & Business Bonus, mit dem wir bereits im Sommer starten können. Wir werden den Fokus noch mehr auf die Bereiche praktische Umsetzung beim Coaching und Aufbau deines Business legen. Alle Informationen und die Möglichkeit dich anzumelden, findest du hier: https://drjannascharfenberg.com/ayurvedaausbildung-2/ Info-Webinar zur Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung Das Webinar findet am Mittwoch, 21. Juni 2023 um 20:00 Uhr statt. Melde dich hier direkt für das Info-Webinar an: https://drjannascharfenberg.com/ausbildung-anmeldung-info-webinar-21-06-23/ In diesem Info-Webinar: kannst du mir alle deine Fragen rund um die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung stellen erfährst du für wen die Ausbildung geeignet ist und für wen eher nicht gebe ich dir tiefe Einblicke in die Ausbildung zeige ich dir, was du mit der Ausbildung machen kannst Hier gelangst du direkt zu meinem EINFACH GESUND LEBEN Podcast:Meine Podcast WebsiteSpotifyiTunes Hat dir der Podcast gefallen?Dann lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da! Ich würde mich riesig darüber freuen! Hast du einen Themenwunsch oder eine Frage für den Podcast?Dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail an mail@drjannascharfenberg.com Du findest mich hier:Website Institut Website Facebook Instagram YouTube
#195: Escape the Unknown. Erlebe spielerisch die Vorteile anonym geteilter Gesundheitsdaten. Interview mit Annika und Jakob
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Hilf dabei die Ursache einer neu aufgetretenen Krankheit zu verstehen, um sie zu behandeln. Digitaler Escape Room zum Thema Gesundheitsdaten. Hier geht es zum Blogbeitrag, wo Du die Inhalte bei Bedarf nachlesen kannst: https://ms-perspektive.de/195-escape-the-unknown Escape the Unknown – zu Deutsch dem Unbekannten entfliehen ist das Thema des heutigen Podcasts und Beitrags. Dabei geht es um das wichtige Thema Gesundheitsdaten und warum wir alle im Einzelnen und im großen Ganzen davon profitieren, wenn wir sie anonymisiert teilen. Was meist recht trocken daherkommt, wird mittels des digitalen Escape Room „Escape the Unknown“ in einem spannenden Spiel erlebbar gemacht. Im Jahr 2065 tritt plötzlich eine Erkrankung des Auges auf, die immer weiter voranschreitet und wenn man sie nicht behandelt zur Erblindung führt. Doch dank der Auswertung anonymer Gesundheitsdaten kann die Ursache gefunden werden und die Krankheit gestoppt werden. Im Interview spreche ich mit Annika Luczak und Dr. Jakob Schardt über die Entstehung und das Konzept von „Escape the Unknown“. Am konkreten Beispiel der Multiplen Sklerose zeigen sie auf, welche Bedeutung geteilte Gesundheitsdaten auf den Behandlungserfolg haben und wie Roche zur detaillierten Erfassung von Krankheitsgeschehen mithilfe von Floodlight MS beiträgt. Diese Podcastfolge sowie der dazugehörige Blogbeitrag wurden durch die freundliche Unterstützung der Roche Pharma AG ermöglicht. Inhaltsverzeichnis Vorstellung Hintergrund und Spielkonzept von Escape the Unknown Bedeutung von Gesundheitsdaten für den Behandlungserfolg am Beispiel Multiple Sklerose Floodlight MS - ein Medizinprodukt für Menschen mit MS Blitzlichtrunde Verabschiedung Vorstellung Annika Luczak Ich bin Medical und Produktmanagerin bei Roche für die Neuroimmunologie und habe im Rahmen meines Traineeprogramms das Projekt „Escape the Unknown“ gemeinsam mit Jakob und dem Team vorangetrieben. Private halte ich mich, wenn möglich, mehr unter Wasser auf, da ich sehr gern tauche. Dr. Jakob Schardt Ich bin Jakob, komme gebürtig aus München und wohne seit drei Jahren in Grenzach-Wyhlen, das in der Nähe von Basel auf deutscher Seite liegt. Bei Roche arbeite ich im Bereich Medical Affairs. In meiner Freizeit spiele ich sehr gern Gitarre, bin mit dem Rad unterwegs, lese und spiele sowohl Brettspiele als auch Escape Rooms oder auf der Playstation. Wo findet man Escape the Unknown? www.escape-the-unknown.de – funktioniert auch mit .at, .ch, .com für Hörerinnen und Hörer aus Österreich und der Schweiz. www.escape-the-unknown.at, www.escape-the-unknown.ch, www.escape-the-unknown.com Habt ihr noch Tipps, wo man sich mehr zum Thema Gesundheitsdaten und wie sie der Wissenschaft helfen, informieren kann? In unserem Escape Room haben wir so genannte “Wissenshappen” versteckt: klickbare Objekte in den Räumen, die in kurzen Textabschnitten weiterführend zu Themen wie Diagnostik, personalisierte Medizin oder elektronische Patientenakten informieren. Zusätzlich sind dort auch Links zu Websites wie dem Bundesgesundheitsministerium, der Friedrich-Eber-Stiftung und anderen Organisationen verlinkt. Eine sehr gute Kampagne ist auch die europäische “DataSavesLives”, eine Initiative mehrerer Interessengruppen, die bei Patient:innen und Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Gesundheitsdaten schaffen will. Inzwischen gibt es auch einen deutschen Ableger mit einer deutschen Internetseite. Verabschiedung Möchtet ihr den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf dem Weg geben? Beschäftigt euch mit euren Gesundheitsdaten, denn es ist eure Gesundheit! Auch wenn ihr jetzt im Moment noch jung und gesund seid, wir alle werden im Laufe unseres Lebens einmal an irgendeiner Krankheit erkranken. Deshalb ist es wichtig, sich jetzt schon, um die Gesundheit der Zukunft Gedanken zu machen. --- Vielen Dank an Annika und Jakob sowie das gesamte Team für diese spannende und kurzweilige Spiel. Im Rahmen von Escape the Unknown wird erlebbar, welches Potenzial im anonymisierten Teilen von Gesundheitsdaten steckt. Bis bald und mach das Beste aus Deinem Leben, Nele Mehr Informationen und positive Gedanken erhältst Du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest Du eine Übersicht zu allen bisherigen Podcastfolgen.
NLP-Podcast 65 - NLP in der Physioterapie und Osteopathie
Warum NLP für Physiotherapeuten und Osteopathen so wichtig für den Behandlungserfolg ist. Das erfährst Du in diesem Podcast!
Radio-Visite: Psychologische Unterstützung bei Herz-OPs
Ängste und Erwartungen vor einer Herz-OP beeinflussen den Behandlungserfolg. Erkenntnisse aus der Placeboforschung können die Therapie unterstützen, erklärt Psychotherapeut Prof. Bernd Löwe.
Spezial ECTRIMS 2022 - Tag 2 - Frühe Prognosefaktoren für Behandlungserfolg, Eskalieren und Deeskalieren von Therapien sowie Progrediente MS
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
In der 2. Folge vom ECTRIMS 2022 berichte ich von drei Themenblöcken: Early predictors of treatment outcome / Frühe Prädiktoren für den Behandlungserfolg von Xavier Montalban vom MS Centre of Catalonia Hot Topic 5: Escalating and de-escalating DMTs / Eskalieren und Deeskalieren von verlaufsmodifizierenden Medikamenten Treating active MS following induction therapies / Behandlung der aktiven MS nach Induktionstherapien von Gilles Edan der CHU Renne, Frankreich Long-term stable MS on high-efficacy therapies / Langfristig stabile MS unter hochwirksamen Therapien von Emmanuelle Wubant von der University of California, San Francisco, USA Long-term stable MS on platform therapies / Langfristig stabile MS unter Basistherapien von Eva Strijbis vom MS Center amsterdam, Niederlande Scientific Session 5: Progressive MS / Wissenschaftliche Session: Progrediente MS Outcome measures in progressive MS trials / Ergebnismessungen in Studien zur progredienten MS von Ruth Ann Marrie von der University of Manitoba, Kanada Clinical trial design in progressive MS / Gestaltung klinischer Studien bei progredienter MS von Maria Pia Sormani von der University of Genoa, Italien Influence of disease modifying therapies on Expanded Disability Status Scale scores trajectories in treated and not-treated patients with secondary progressive multiple sclerosis - analysis from nine registries / Einfluss verlaufsmodifizierender Therapien auf den EDSS-Wert bei behandelten und nicht behandelten Patienten mit sekundär progredienter Multipler Sklerose - Analyse von neun Registern von Luigi Pontieri, Danish Multiple Sclerosis Registry, Dänemark The demographics, clinical course and pathology of late-onset MS / Demografische Daten, klinischer Verlauf und Pathologie der spät auftretenden MS von Sarah Knowles von der Swansea University, United Kingdom Hier geht es zum Blogbeitrag: https://ms-perspektive.de/spezial-ectrims-2022/ Bis bald und lebe ein gehirngesundes und erfülltes Leben, Nele Mehr Informationen und positive Gedanken erhältst Du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest Du eine Übersicht zu allen bisherigen Podcastfolgen.
[19] "Stellen Sie sich nicht so an!" - Wenn das Behandlungsgespräch mehr krank macht als gesund
(Content note: Schilderung von Übergriffen) Was ist wichtig für eine machtsensible und förderliche Kommunikation in Medizin und Psychotherapie? Viele Menschen haben schonmal die Erfahrung gemacht, dass ein Satz lange verunsichernd oder schmerzhaft nachgeklungen hat. Gerade, wenn wir krank sind, Angst oder Schmerzen haben, sind wir besonders verletzlich. In herausfordernden medizinischen oder therapeutischen Situationen ist es umso wichtiger, hilfreich zu kommunizieren. Einerseits um nicht zu schaden. Andererseits um den Behandlungserfolg zu begünstigen. Welche Folgen kann missglückte Kommunikation haben? Was ist auch unter Zeitdruck bzw. in Notfällen möglich und ethisch akzeptabel? Welche Sätze können nachhaltig verletzen und warum? Wir haben viele tolle O-Töne zu diesem durchaus schwierigen Thema bekommen. Es kommen Behandler*innen aus Medizin und Psychotherapie, Patient*innen, sowie die Kommunikationspsychologin Laura Kutsch zu Wort. Offen, berührend und sehr lehrreich. Wir stellen uns darüber hinaus die Fragen: - Was kann empathische Kommunikation konkret bewirken? - Welche spezifischen Punkte sind für eine gelungene Kommunikation entscheidend? - Wie kommt es zu fehlgeschlagener Kommunikation? - Gibt es ein ausreichendes Bewusstsein bei den Heilberufler*innen, bzw. in der Ausbildung? Und gibt es die strukturellen Voraussetzungen im klnischen Alltag dafür? - Wann ist es gerade die fehlende Kommunikation die sich fatal auswirkt? - Was ist von Patient*innen-Seite aus zu beachten?
#160: Interview mit Dr. Michael Lang zur digitalen Arzt-Patienten-Beziehung
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Dr. Lang möchte gut informierte Patienten und eine effektive digitale Arzt-Patienten-Beziehung für den bestmöglichen Behandlungserfolg. Heute begrüße ich Dr. Michael Lang im Podcast und spreche mit ihm über eine Arzt-Patienten-Beziehung, die auf Augenhöhe stattfinden sollte und wie das gelingen kann. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten und Chancen die Behandlung von Patienten zu verbessern, kann die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung um eine digitale Komponente erweitert werden. Stichwort ist hier das Erfassen von vergleichbaren, strukturierten Daten, die eben deutlich aussagekräftiger sind, als die eigene Erinnerung, die ja auch immer emotional gefärbt ist. Denn ein Arzt, der beispielsweise eine schleichende Verschlechterung seines Patienten mittels App-Tracking sieht, kann entsprechend die Behandlung anpassen und schnell darauf reagieren. Dr. Michael Lang ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Gutachter bei Begumed Ulm, Geschäftsführer bei NeuroPoint Ulm GmbH und Head of Medical Affairs bei der NeuroSys GmbH. An Ruhestand ist also nicht zu denken und dank seines Engagements und seiner jahrzehntelangen Erfahrung, treibt er weiterhin Innovationen im Gesundheitswesen voran. Hier geht es zum Blogbeitrag mit komplettem Text zum Nachlesen: https://ms-perspektive.de/dr-lang-zur-digitalen-arzt-patientenbeziehung Inhaltsverzeichnis Vorstellung Digitale Arzt-Patienten-Beziehung Emendia MS App Wissensakademie NeuroPoint Zukunft Blitzlicht-Runde Verabschiedung Verabschiedung Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf dem Weg geben? Seien Sie aktiv in der Bewältigung ihrer Erkrankung; Patienten werden nicht gesund gemacht, wenn sie nicht selbst aktiv werden. Wo findet man sie und ihre Angebote im Internet? https://neurosys.de https://patienconcept.app https://neuropoint.de https://emendia.de Vielen Dank an Dr. Michael Lang für das interessante Gespräch und die motivierenden Worte selbst aktiv zu werden, um das bestmögliche Leben mit MS zu führen. Stetig kommen neue Möglichkeiten dazu. Es liegt an Dir sie zu nutzen. Bis bald und mach das beste aus Deinem Leben, Nele Mehr Informationen und positive Gedanken erhältst Du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest Du eine Übersicht zu allen bisherigen Podcastfolgen.
Therapie & Training Talk #72 - TWUP #174 - Trigeminusneuralgie
Thomas und Wolfgang sprechen über den Behandlungserfolg eines Patienten mit einer Trigeminusneuralgie, Thomas 1. Advanced Seminar, warum Sprinten die beste Übung für die Bauchmuskeln ist, das TNT-Summit 2023 und vieles mehr…
Wie viel darf Gesundheit kosten und was sind eigentlich IGeL-Leistungen? (Folge: 190)
Gesundheit kostet Geld. Es braucht auch Zeit und Energie, sie zu erhalten. Jedoch: Wenn Du heute kein Geld für Deine Gesundheit hast, wirst Du in Zukunft viel Geld benötigen, um Deine Krankheit loszuwerden und die Gesundheit wieder zu erlangen. Die Kassenmedizin ist eine “ausreichende Reparaturmedizin”, jedoch wünscht sich jeder Patient einen Arzt/Zahnarzt, der auf dem neuesten Stand der Medizin ist und verschiedene Verfahren anbietet. Auch ich verbinde moderne, innovative Verfahren mit naturheilkundlichen Methoden. Diese Leistungen sind jedoch nicht im Gebührenkatalog der gesetzlichen Krankenkassen enthalten und werden allgemein als IGeL-Leistungen bezeichnet. Die Abkürzung IGeL bedeutet: Individuelle-Gesundheits-Leistung. Es handelt sich dabei um Leistungen, die ein Arzt/Zahnarzt entweder selbst entwickelt oder übernommen hat und seinem Patienten anbietet. Diese Leistungen sind zwar in verschiedenen Listen, die im Internet zu finden sind, gesammelt, jedoch sind diese Listen unvollständig und unübersichtlich. Grundsätzlich können die IGeL-Leistungen in zwei Gruppen unterteilt werden: 1.) Leistungen, die die Gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlen, die jedoch sehr sinnvoll für den Behandlungserfolg sind. Es handelt sich in der Regel um Behandlungsverfahren, die mit modernen, innovativen Verfahren durchgeführt werden, die es noch nicht gab, als der Gebührenkatalog der Krankenkassen erstellt worden ist. In der Zahnarztpraxis wären das zum Beispiel: Professionelle Zahnreinigung, Sauerstoff- oder Ozontherapie bei Parodontitis, Spülungen von Wurzelkanälen. Auch Zahnimplantate sind keine Kassenleistungen, bringen dem Betroffenen jedoch eine sehr viel höhere Lebensqualität als Prothesen und sind daher im Einzelfall sehr sinnvoll. 2.) Leistungen, die auf Verlangen durchgeführt werden, medizinisch jedoch nicht notwendig sind. Dies sind zum Beispiel alle Maßnahmen, die aus ästhetischen Gründen durchgeführt werden. Auf den Zahnarzt bezogen wären das: Zahnbleaching, Zahnschmuck, Versorgung der Schneidezähne mit Veneers. Mein persönlicher Tipp: Lege jeden Monat einen bestimmten Betrag für Deine Gesundheit zurück. Dann hast Du immer genug, um diese zügig wieder zu erlangen. In diesem Sinne wünsche ich Dir beste Gesundheit! Deine Annette Hier findest Du mich: Praxis Dr. Jasper: https://drjasper.deMuskanadent: https://muskanadent.comYouTube: http://bit.ly/drjasper-youtube Podcast iTunes: https://bit.ly/drjasperFacebook Dr. Jasper: https://www.facebook.com/ZahnarztpraxisJasper/ Facebook Muskanadent: https://www.facebook.com/muskanadent/ Instagram Dr. Jasper: https://www.instagram.com/zahnarztpraxis_drannettejasper/ Instagram Muskanadent: https://www.instagram.com/drannettejasper_muskanadent/ Gratis Checkliste “So halten Deine Zähne ein Leben lang”: https://verzahnt.online Buche deine persönliche Sprechstunde mit mir: https://drannettejasper.de/online-sprechstunde/ Buch “Verzahnt”: https://www.m-vg.de/riva/shop/article/15075-verzahnt/?pl=3887e229-9ea5-4043 Buch "Yoga sei Dank" von Dr. Annette Jasper: https://www.komplett-media.de/de_yoga-sei-dank-_112788.html
Placeboeffekt in der Therapie: Placebo Domingo
Eine therapeutische Wirkung wird nicht nur durch die Gabe eines therapeutischen Wirkstoffes erzielt. Klaas und Dennis beleuchten die Power des Placeboeffekts und geben Tipps, wie man den Behandlungserfolg auch ohne therapeutische Intervention steigern kann. Klempner Klaas gibt Einblick in die Kanalisation seiner Praxis und wird im Anschluss von Quizmaster Dennis durch den medizinischen Rätselwald gescheucht. Dazu kommen die jeweils drei erfolgreichesten Gamechanger-Techniken der beiden Osteopathen. Wohl bekomm's!
#101 – Interview mit Prof. Christoph Heesen zur Stammzelltherapie
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Prof. Heesen erklärt, wie die Stammzelltherapie abläuft, welche Chancen und Risiken damit einhergehen und wer an der Studie teilnehmen kann. In Folge 101 vom Podcast steht die Stammzelltherapie für MS-Patienten im Fokus. Prof. Christoph Heesen vom UKE Hamburg hat bereits einige Erfahrungen mit der Therapieform gesammelt und gibt uns einen umfassenden Einblick in Ablauf, Chancen und Risiken der Behandlung. Er erläutert die Rahmenbedingungen der Studie, die frisch angelaufen ist und für wen sie in Frage kommt. Ich habe versucht die Antworten von Prof. Heesen auf meine Fragen in Textform bestmöglich wiederzugeben. Vorstellung Prof. Dr. med. Christoph Heesen ist Oberarzt & Leiter der MS-Ambulanz am UKE Hamburg und ausgebildeter Facharzt für Neurologie. Wichtigste Stationen bis zur jetzigen Position? Ich habe Medizin in Marburg und Kiel studiert. Anschließend war ich ein Jahr klinisch tätig in Bremen. Es folgte ein kurzer Ausflug nach London. In meiner Doktorarbeit ging es um Autoimmunerkrankungen. Zum Start in den Klinikalltag kamen gerade die ersten MS-Therapien auf den Markt. Seitdem beschäftige ich mich auch mit den kritischen Kommunikation um die Therapien herum und mit dem Therapieziel der Behandlung. Persönliche Motivation für Ihren Beruf? Faszination der Neurologie und Immunologie. Im Studium kam dann der Bereich der Psychoneuroimmunologie dazu. Bis heute ist das Interesse groß zu verstehen, wie psychischer Stress auf die Multiple Sklerose wirkt und wie man im Umkehrschluss Patienten dabei helfen kann, diesen negativen Einfluss auf die Erkrankung zu reduzieren. Stammzelltherapie Wann macht eine Stammzelltherapie bei MS-Patienten Sinn? Für wen kommt sie in Frage? Die Stammzelltherapie ist ein Verfahren, das für hoch-aggressive Verläufe geeignet ist. Also für eine hochaktive schubförmige MS mit vielen Schüben im Jahr, bleibenden Beeinträchtigungen, einem jungen Lebensalter und einer kurzen Krankheitsdauer der Patienten. Lebensalter idealerweise unter 40 Jahren. Krankheitsdauer unter zehn Jahren. Mit drei Schüben im Jahr. Mit einer Beeinträchtigung nach zwei bis drei Jahren, dass man nicht mehr unbegrenzt gehen kann. Auch progrediente Verläufe kommen in Fragen, falls sie noch nicht zu fortgeschritten sind. Wichtig: Die verabreichten Stammzellen sorgen für einen Neustart des Immunsystems. Sie können weder das Gehirn reparieren noch Nerven wieder aussprießen lassen. Man zerstört das komplette Immunsystem, um es anschließend wieder neu aufzubauen. Damit verschwindet auch das komplette immunologische Gedächtnis. Impfungen müssen neu gegeben werden. In späteren Stadien der Erkrankung, wo Entzündungen nicht mehr so wichtig sind, sondern es um Folgeschäden der zerstörten Nerven geht und Degeneration stellt diese Art der Behandlung nur noch ein Risiko dar und kann keinen Nutzen mehr bieten. Wie läuft eine Stammzellentherapie bei MS-Patienten ab? Es gibt eine autologe und eine allogene Stammzelltherapie. Bei der autologen Stammzelltherapie erhält man seine eigenen Stammzellen zurück, bei der allogenen Spenderstammzellen. Bei MS-Patienten werden die eigenen Stammzellen wieder verabreicht. Dadurch besteht zwar das Risiko die MS wieder zurückzubekommen, aber die Risiken und Komplikationen sind viel geringer. Zuerst werden die Stammzellen gesammelt. Das erfolgt durch eine sogenannte Mobilisation. Dafür werden die Stammzellen aus dem Knochenmark ausgeschwemmt. Man gibt eine Chemotherapie, typischerweise Cyclophosphamid oder Endoxan. Beide wurden bereits vor 30 Jahren als Therapie bei Multipler Sklerose ausprobiert. In einer geringen Dosis aktivieren sie die Stammzellen, diese wandern dann vom Knochenmark ins Blut. Mit einer Abfilterungsanlage werden die Stammzellen in der Apharese gesammelt, die ähnlich der Plasmapherese oder Plasmaspende funktioniert. Anschließend werden die Stammzellen aufbereitet, geprüft ob alle funktionieren, eingefroren und wieder aufgetaut. Denn es muss sichergestellt werden, dass der MS-Patient funktionierende Stammzellen zurückerhält, alles andere wäre hochgradig gefährlich, da vorher ja das komplette Immunsystem platt gemacht wurde. Sehr gute Standards reduzieren dieses Risiko gegen Null. Danach ist der Patient wieder zuhause. Sprich erst Zellen mobilisieren, herausfiltern, aufbereiten und einfrieren. Danach kommt der Patient wieder zur eigentlichen Therapie. Diese beginnt mit der sogenannten Konditionierung. Das heißt, der Patient bekommt eine ganz massive Immunsuppression oder Chemotherapie, die das Immunsystem kaputtmacht. Das ist derzeit ebenfalls Cyclophosphamid oder Endoxan. Zusätzlich gibt man einen bestimmten Antikörper. Nun hat der Patient kein Immunsystem mehr. Würde man dem Patienten nun keine Stammzellen geben, würde dieser Patient innerhalb weniger Wochen oder Monate an einer Infektion versterben. Deshalb bekommt man seine aufbereiteten Stammzellen nach ein paar Tagen wieder, nach ca. einer Woche. Die Stammzellen wachsen dann an. Das dauert ca. eine Woche bis zehn Tage. Das Immunsystem erholt sich wieder. Bei optimalem Verlauf dauert dieser Teil der Therapie drei Wochen. In Hamburg lag der Durchschnitt bei drei bis fünf Wochen. Anschließend geht der Patient nach Hause. Das Immunsystems muss wieder aufgebaut werden. In den ersten drei Monaten muss man sehr vorsichtig sein und jede Woche zum Blutbildcheck. Man muss verschiedene Virus- und Pilzmittel nehmen, die den Körper vor Infektionen schützen. Ein Jahr braucht das Immunsystems ungefähr, um sich wieder aufzubauen. Welche Chancen und Gefahren stehen im Zusammenhang mit einer Stammzellentherapie? Aus den bisherigen Daten kann man sehen, dass die Entzündungsaktivität deutlich reduziert werden kann. Mehr als bei allen anderen hochwirksamen Therapien. Angestrebt wird eine nicht mehr nachweisbare Krankheitsaktivität, also keine Schübe, keine neuen Läsionen im MRT, keine Progression. Dieses ambitionierte Ziel bekommt man mit den Standardtherapien bei 40% der Patienten hin. Bei der Stammzelltransplantation schafft man es bei 60-80%, vielleicht sogar 90% der Patienten. Die Therapie hat ein hohes Potenzial, allerdings gibt es für die Stammzelltherapie bisher nur wenige Daten, eine viel kleinere Studienlage. Zusätzlich bietet die Therapie bisher für ein Drittel der Patienten die Chance, anschließend sogar besser zu werden. Die Patienten konnten sich erholen, weil das Immunsystem nun nicht mehr ständig neue Angriffe von der MS erlebte und Zeit hatte, seine körpereigenen Reparaturmechanismen zu fahren. Deshalb sind jüngere Menschen ideale Kandidaten, weil sie dieses Partizipationspotenzial noch haben. Demgegenüber stehen die Risiken, weshalb es viele Vorbehalte in Deutschland gegen dieses Verfahren gibt. Früher starben 3-5% der Patienten, weil man noch toxischere Chemotherapien einsetzte und ältere Patienten einschloss, die noch andere Erkrankungen hatten. Heutzutage liegt das Risiko bei unter 1%. Aber wichtig bis zu 1% therapiebezogene Sterblichkeit bleibt als Risiko bestehen. Es ist eine risikoreiche Therapie. In Hamburg wurden bisher 20 Patienten behandelt, keiner ist gestorben. Eine neue englische Serie mit 120 Patienten hatte drei Todesfälle. Allerdings waren da auch Patienten Mitte 60 dabei und mit Vorerkrankungen. Alle drei verstorbenen Patienten hatten Vorerkrankungen. In Deutschland ist die Grenze bei 40 bis 50 Jahren. Man kann außerdem sekundäre Autoimmunerkrankungen bekommen (5-6%). Meistens sind diese aber gut beherrschbar. Zusätzlich können sekundäre Krebserkrankungen auftreten ca. 3-4%. Und es kann zu Unfruchtbarkeit kommen für Männer, wie Frauen. Man sollte Eizellen bzw. Spermazellen einfrieren, um sich den Kinderwunsch später dennoch erfüllen zu können. Wie ausführlich werden in Frage kommende MS-Patienten über die Behandlung informiert und wie lange dauert der Entscheidungsprozess üblicherweise? Die Patienten, die sich in Hamburg melden, sind in der Regel sehr gut informiert. Teilweise über die Facebook-Gruppe der MS-Transplantierten. Somit führen wir meist ein erstes Gespräch, geben dann Bedenkzeit. Und beim zweiten Gespräch, wenn die Patienten sich immer noch sicher sind. In der Regel ist es für die Patienten relevant, deren normales Leben nicht mehr funktioniert, die alles andere an MS-Therapien ausprobiert haben, mit nur geringem Erfolg. Dann stehen Risiko und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis. und es geht eher darum, wie man an das Verfahren kommt. Für diese Patienten ist es eine Befreiungsschlagchance mit einem gewissen Restrisiko. Wie lange dauert die eigentliche Behandlung? Ungefähr ein Jahr. Die Mobilisation dauert eine Woche. Die Stammzelltherapie selbst drei bis fünf Wochen stationär. Daran schließen sich drei Monate Nachbeobachtung an. Also vier Monate ernstere Behandlungsphase. Anschließend kann man in die Reha oder lieber erst ein Jahr später, um das Immunsystem noch ein bisschen zu schonen, da dort schließlich mehr Kontakt mit anderen Menschen stattfindet. Das ist eigener Ermessensspielraum. Welche Reha-Maßnahmen oder anderen regenerativen Behandlungen folgen im Anschluss an die Stammzellentherapie? Nichts Spezifisches. Viele Patienten sind dann erstmal richtig schlapp und fühlen sich schlechter. Schließlich ist die Behandlung sehr intensiv und anstrengend für den Körper. Andere erholen sich schneller und trainieren viel zuhause. Das hilft auf jeden Fall. Allgemeine MS-spezialisierte Reha macht Sinn. Wie ist es, wenn man kleinere Kinder hat? Zum Glück übertragen Kinder in der Regel keine massiv gefährlichen Krankheiten. Wenn man es schafft, in den ersten drei Monaten eine gewisse Distanz einzuhalten oder das Kind eventuell zuhause zu behalten, wird das Risiko reduziert. Allerdings sollte man die psychische Belastung der Trennung auch nicht unterschätzen. Also abklären, diskutieren und dann individuell entscheiden. Wer trägt die Kosten für eine Stammzelltherapie bei MS in Deutschland? Grundsätzlich übernehmen die Krankenkassen in Deutschland die Kosten nicht, weil es keine etablierte Therapie ist. Eventuell kann man seine Krankenkasse davon überzeugen, die Kosten zu übernehmen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit der Selbstfinanzierung. Das sind mindestens 35.000 bis 40.000 Euro in Deutschland. Man kann auch in die Schweiz, nach London, Mexiko oder Moskau gehen. In Hamburg wird nur die Behandlung über Studie angeboten bzw. bei Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse. Was ist der Unterschied für MS-Patienten, wenn sie an der Studie zur Stammzelltherapie teilnehmen? An der Studie können zunächst nur Patienten im schubförmigen Verlauf teilnehmen, die eine Therapieversagen mit den Standardtherapien haben, unter 50 Jahre sind und die MS nicht länger als 10 Jahre haben. In der Studie wird die Stammzelltherapie mit Lemtrada oder Ocrevus verglichen, um aufzuzeigen, dass die Kosten der Stammzelltransplantation geringer sind, als mit den Standard hochwirksamen Medikamenten, um letztendlich hoffentlich eine Kostenübernahme für alle Patienten zu bewirken nach erfolgreich abgeschlossener Studie. Das heißt, man hat 50% Chancen die Stammzelltherapie zu erhalten, man kann aber auch in der anderen Gruppe landen und entscheidet dann gemeinsam mit seinem Arzt, ob man Lemtrada oder Ocrevus nimmt. Es wäre sehr ungünstig, wenn zu viele Patienten abspringen, bloß weil sich nicht die Stammzelltransplantation erhalten haben. Wenn die Patienten allerdings unter Lemtrada oder Ocrevus schlechter werden würden und der Behandlungserfolg ausbleibt, würden sie ebenfalls transplantiert werden. Bei einer ähnlichen Studie aus den USA wurden ungefähr die Hälfte der Patienten letztendlich doch transplantiert, weil die anderen Therapien nicht ausgereicht haben. Generell muss man zu vielen Kontrolluntersuchungen kommen. Anfangs alle drei Monate, später zweimal jährlich bis einmal jährlich inklusive MRT und Gehirnleistungstest, um die Langzeiterfolge zu messen. 50 Patienten werden für die Studie benötigt, das ist in 5 Jahren möglich. Realistischerweise könnte es in fünf bis zehn Jahren zur Kassenleistung werden, wenn es so gut läuft, wie erwartet. Gibt es weitere MS-Zentren in Deutschland, wo eine Studienteilnahme möglich ist? Die Uniklinik Mannheim ist dabei, das MS-Zentrum Dresden ist frisch dazugekommen und Düsseldorf könnte mit hinzukommen. Patienten sollen auch aus einem größeren Radius zu den vier teilnehmenden Kliniken kommen. Was sollten interessierte MS-Patienten machen, um abzuklären, ob sie geeignete Kandidaten für die Studie sind? Sinnvollerweise sollten sich interessierte Patienten momentan in Hamburg melden unter . Gerne auch telefonisch. Zunächst würden wir die Kerninformationen klären, ob der Kandidat passt und alle wichtigen Informationen zur Aufklärung hat. Von den Patienten, die sich melden, sind 20-30% geeignet. Sobald, die ersten zwei drei Patienten in Hamburg in Behandlung sind, können bestimmt auch die anderen Zentren aktiv loslegen. Und falls es viele Anfragen zur generellen Therapie gibt, die dann aber größtenteils nicht in Hamburg durchgeführt werden, können hoffentlich auch die anderen Zentren mit bei der Aufklärung und Information der Patienten mithelfen. Blitzlicht-Runde Vervollständigen Sie den Satz: „Für mich ist die Multiple Sklerose… eine sehr unterschiedlich verlaufende Krankheit, die eine hochindustrialisierte Therapie braucht.“ Welche Internet-Seite können Sie zum Thema MS empfehlen? DMSG Hamburg und unsere MS-Ambulanz Seite am UKE Hamburg. Welchen Durchbruch in der Forschung und Behandlung zur MS wünschen Sie sich in den kommenden 5 Jahren? Die Etablierung der Stammzelltherapie. Das Sport- und Ausdauertraining mehr ins Bewusstsein rückt und sich für die Regeneration und Prävention etabliert. Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf dem Weg geben? Finden sie ihren eigenen Weg mit der MS. Und suchen sie sich Ärzte, die sie dabei unterstützen. Wie erreicht man die MS-Ambulanz am UKE in Hamburg? Am besten per E-Mail: multiplesklerose[at]uke.de oder telefonisch 040-7410-54076. +++++++++ Vielen Dank an Prof. Christoph Heesen für das geführte Interview und den umfassenden Ein- und Überblick zur Stammzelltransplantation bei Multipler Sklerose. Bestmögliche Gesundheit wünscht dir, Nele Mehr Informationen rund um das Thema MS erhältst du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest du eine Übersicht zu allen bisher veröffentlichten Podcastfolgen.
Geparden, Gewitter, erster Heilungserfolg bei Long Covid, Pandemie-Prävention
In den Profis reden wir über Gewitterjäger und wie man Gewitter am besten analysiert. Es geht auch um Long Covid und einem ersten Behandlungserfolg dank eines Zufalls. Der Ursprung von SARS-CoV-2 ist zwar noch immer nicht bekannt, aber Forscher haben einen neuen Ansatz entdeckt, wie man gefährliche Viren erkennen und Pandemien besser voraussagen kann. Außerdem sprechen wir über die schnellsten Katzen der Welt: die Geparden. Die wenigen, die es noch gibt, machen den Bauern in Afrika Probleme. Wie schafft man Frieden zwischen Geparden und Farmern?
#9 Kommunikation zwischen Arzt und Patient (Dr. Henning Kothe)
Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist nicht immer einfach - gehört aber zum Alltag eines jeden Mediziners und ist entscheidend für den Behandlungserfolg. Doch jedes Gespräch ist anders und bringt neue Herausforderungen mit sich. Worauf sollte man also als Ärztin oder Arzt für die eigene Zufriedenheit und die des Patienten achten? Darüber sprechen wir heute mit einem Experten, der sich schon viel mit diesen Fragen beschäftigt hat – Herrn Dr. Henning Kothe.
Welche Fragen könnten in der Prüfung zum kleinen Heilpraktier auftreten. Wir arbeiten das Ofenstein Lehrbuch parallel zum Fernstudienmaterial durch und versuchen auf Fragen zu antworten, die eventuell auch in der Prüfung auftreten könnten. Es geht hauptsächlich darum, mit der Begrifflichkeit zurecht zu kommen und eine, für den Laien verständliche Struktur der verschiedenen Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten zu ermitteln. Es handelt sich darum, die Komplexität auszuklammern und den Spezialisten zu überlassen und nur dort aktiv zu werden, wo es für den Heilpraktiker für Psychotherapie auch Sinn macht. Dies ist ein kleiner Bereich nur, aber gerade hier kozentrieren sich die Patienten, bzw. Klienten. Auch hier gilt, frühzeitig mögliche Störungen zu erkennen, und zu helfen, sie zu mildern. Interessant ist, daß es bei der Behandlung der Alzheimer Demenz darum geht, den Zustand beizubehalten, der bei der Diagnose beschrieben wurde. Da es sich um eine progrediente Erkrankung handelt, wäre dies schon ein Behandlungserfolg.
Sendet uns eure Fragen gerne via Instagram: https://www.instagram.com/janina.elarguioui.official Da standen wir also nun. Von Gynäkologen und Urologen überwiesen an eine Kinderwunsch-Klinik. Nie hätten wir damit gerechnet, dass wir eines Tages eine solche Einrichtung von innen sieht. Man fühlte sich ja all´ die Jahre gesund. "Sowas brauchen wir nicht, es wird schon funktionieren." Sätze, die uns noch heute zurückblicken lassen, mit welcher Naivität man gehandelt hatte. Wertvolle Zeit ist uns verloren gegangen und ein Behandlungserfolg lag auch noch in weiter Ferne. Angst, ohne Kinder leben zu müssen und wie unser Partner damit umgehen würde, zierte unseren Alltag.
#2 Warum Pferdebesitzer nicht wissen, wie gut du wirklich bist
In dieser Folge erfährst du, was du tun kannst, damit Pferdebesitzer besser nachvollziehen können, wie gut deine Behandlung ihrem Pferd tut. Damit zeigst du ihnen nicht nur, dass du kompetent, sondern eben auch kundenorientiert bist. Mit einfachen Schritten kannst du so deine Kunden binden und bestenfalls auch für besseren Behandlungserfolg und Weiterempfehlungen sorgen. Lies den dazugehörigen Beitrag unter
Der Rückfall gilt nach wie vor als eines der zentralen Merkmale, die über Behandlungserfolg oder –misserfolg entscheiden. Und sowohl auf der Seite der Betroffenen, ihrer Angehörigen und auch der Fachkräfte werden Rückfälle gefürchtet, da sie schließlich auch lebensbedrohend sein können. Einerseits gehören sie zum Suchthilfeprozess dazu, andererseits werden sie institutionell zum Gradmesser erklärt, ob und in welcher Form weiterhin Hilfe angeboten wird. Doch was ist ein Rückfall genau und wie läuft er ab? Kann man sich darauf vorbereiten, und wenn ja, wie? Welche Strategien gibt es zur Prävention und wie werden Rückfälle bearbeitet, wenn sie eingetreten sind? Marc berichtet viel aus seinen eigenen Erfahrungen mit Rückfällen, wie er diese erlebt hat und wie es sich bis heute vor neuen Rückfällen schützt. Dirk hat zu diesem Thema ein Interview mit Christiane Haag-Borchers geführt, Suchtmedizinerin und Leiterin der Fachklinik Villa Maria. Als ein zentrales Fazit der Episode kann man festhalten, dass es wichtig ist, seine Rückfallängste wahrzunehmen und darüber zu reden. Das ist der erste Schritt, etwas dagegen zu tun. Links zur Folge: https://www.drugcom.de/?id=topthema&sub=199 (Artikel zu Strategien gegen Rückfälle) https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Kritische_Situationen.pdf (DHS-Broschüre Kritische Situationen meistern – Rückfällen vorbeugen)
Wer krank ist, bekommt vom Arzt ein Medikament verschrieben. Besonders bei flüssigen Arzneien hängt der Behandlungserfolg von der genauen Dosierung ab. Warum der Haushaltslöffel hierbei so gefährlich ist erfahren Sie in Folge 18 von "Bankhofer´s 60 Sekunden Gesundheit". Hinweis: Hademar Bankhofer ist KEIN Arzt. Die Ratschläge in den Podcasts sind vom Autor sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors und dessen Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Darüber hinaus ersetzen diese Tipps KEINE ärztliche Untersuchung und Beratung – wenden Sie sich daher bitte an einen Arzt.
Auf-geht-s-der Reha-Podcast Folge 128 b_ Nach Unfall im Ausland gelandet, was nun?
Tue, 22 Aug 2017 21:48:45 +0000 https://auf-gehts-der-reha-podcast.podigee.io/b128-auf-geht-s-der-reha-podcast-folge-128-b_-nach-unfall-im-ausland-gelandet-was-nun 6f348945e16aacb26dd097a308cd9893 Oh je, dass kann sich kaum einer vorstellen, kann aber passieren. Wenn ihr an Ausland und Unfall denkt, kommt vielleicht für euch als erstes der letzte oder nächste Urlaub in den Sinn. Aber es geht auch anders und das kann fatale Folgen haben. Ich berichte euch heute, wie ihr in Deutschland verunfallen könnt, im Ausland landet und dann nicht mehr zur Behandlung zurückkommt. Konkret geht es um einen Klienten, der nach seinem Unfall in Holland landet und dann geht es los. Dabei ist die Behandlung von Querschnittslähmungen in geeigneten Zentren so wichtig. Gerade in der Anfangszeit kann es bei Querschnittsgelähmten die Chance geben, dass bei richtiger Reha, die Auswirkungen des sogenannten spinalen Schocks, langfristig zu besseren Funktionen führen können. Hört sich komisch und schwierig an. Ist aber bei einer Querschnittslähmung wichtig. Samuel Koch berichtet in seinem Buch „Rolle vorwärts“ selbst davon, was alleine ein Muskel alles an Freiheit bedeuten kann. Nur so nebenbei, beide Bücher von Samuel Koch sind sehr gut zu lesen. Sie lassen auch erahnen, was wichtig und unwichtig ist. Egal. In meinem Fall ging es darum die beste und schnellste Lösung zu finden. Nachdem die gesetzliche Krankenkasse noch lange prüfen wollte, was denn nun mit dem EU-Recht und dem zwischenstaatlichen Recht so möglich ist, ging es um pragmatische Lösungen. Für den Betroffenen und nicht um zwischenstaatliche Fragen. Ein toller Arzt aus dem Belegungsmanagement des BG-Klinikum Hamburg hatte schon eine genaue Idee wie es im Sinne des Betroffenen gut laufen kann. Fehlten nur noch ein Hubschrauberflug und eine Kostenzusage dafür und ein Bett im Querschnittsgelähmtenzentrum des BG-Klinikum Hamburg. Die Mitarbeiterin der Versicherung hat fantastisch reagiert und gleich gesagt: „Wir machen das, es geht hier darum zu helfen!“. Ein Schreiben über die Kostenzusage ging keine 15 Minuten später an das Belegungsmanagement des BG-Klinikum Hamburg. Glück im Unglück, das auch noch rasch ein Bett im Querschnittsgelähmtenzentrum des BG-Klinikum Hamburg frei wurde. Jetzt kann der Betroffene innerhalb weniger Tage die Behandlung erhalten, die er benötigt. Machen wir uns aber nichts vor. Hier ging es gut, in vielen anderen Fällen warten Menschen auf dringend benötigte Behandlungsplätze. Und auch ich musst in der Vergangenheit schon mitfiebern, dass ein Platz frei wird, um zum Behandlungserfolg zu kommen. Deswegen eine Bitte: Dieser Fall zeigt, dass ihr auch einmal unfreiwillig im Ausland behandelt werden könnt. Klärt euren (Zusatz-) Versicherungsstatus, damit eurer Rückkehr bürokratische Hürden nicht im Wege stehen. 128 bonus no Jörg Domm
Langzeitergebnisse nach Fundoplikatio bei Kindern
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
In der Arbeit "Langzeitergebnisse nach Fundoplikatio bei Kindern" wurden die Daten aller Kinder, die im Zeitraum von Januar 2001 bis Februar 2005 in der Dr. von Haunerschen Kinderklinik operiert wurden, ausgewertet. Dabei handelte es sich um 39 Patienten, davon 17 Mädchen und 22 Jungen, die eine Fundoplikatio nach Thal, Nissen oder Boix-Ochoa erhielten. Für die Arbeit wurden einerseits im Rahmen einer retrospektiven Fall-Kontroll-Studie die präoperativen Befunde der Kinder, die Operationsberichte und Akten des stationären Aufenthaltes sowie die postoperativen Nachsorgekontrollen ausgewertet. Andererseits gab es zur langfristigen Verlaufskontrolle ein Telefoninterview mit den Eltern der Kinder mit einem Fragebogen zur Symptomentwicklung und Lebensqualitätsverbesserung nach Fundoplikatio. Ziel unserer Arbeit war es, herauszufinden, ob mit der Fundoplikatio in unserer Patientenkohorte ein gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis erzielt werden konnte. Durch Vergleiche unterschiedlicher Patientengruppen versuchten wir, Tendenzen zu erkennen, welche Patienten in Bezug auf Vorerkrankung, Manschettenart und Operationstechnik in der Gegenüberstellung den größten Vorteil aus der Antirefluxchirurgie erzielen konnte. Auch wollten wir feststellen, welche Art von Symptomen einem operativen Behandlungserfolg am besten zugänglich war. Im Langzeitvergleich der Manschettenart zeigten sich bezüglich eines Rezidives (Rezidivösophagitis und radiologischer Rezidiv-GÖR) schlechtere Ergebnisse für die Thal-Operation als für die Nissen-Fundoplikatio (37,5% vs.7,7% und 25% vs. 15,4%). Nur der unmittelbar postoperative Rezidivreflux war bei Nissen-Operationen etwas häufiger (15,4% vs. 12,5%). Weiterhin war die Thal-Operation mit mehr Manschettenkomplikationen assoziiert (29,2% vs. 7,7%). Im Gesamtüberblick zeigte sich aber auch bei mehr Thal-operierten Kindern ein vollkommen komplikationsloser postoperativer Verlauf als bei Kindern nach Nissen-Operation (45,8% vs. 30,8%). Die Reoperationsrate war nach Nissen-Fundoplikatio höher (23,1% vs. 16,7%), ebenso geringfügig die direkt postoperative Dysphagie (23,1% vs. 20,8%). Weiterhin fällt ein häufigeres Auftreten von neu entstandener Dysphagie im Langzeitverlauf nach Nissen-Fundoplikatio auf (23,1% vs. 8,3%). Die laparoskopische Operationsform ist in unserer Studie mit mehr Refluxrezidiven in der ersten postoperativen Röntgenkontrolle verbunden (21,1% vs. 5,0%). Hier zeigte die offene Operation ein deutlich besseres Outcome, während es im Langzeitverlauf im Hinblick auf die Refluxrezidive keinen deutlichen Unterschied mehr gab zwischen offener und laparoskopischer Operationstechnik. Während die Rate an Ösophagitisrezidiven bei der offenen Operation etwas höher lag (30,0% vs. 26,3%), waren die laparoskopisch operierten Patienten mehr von Rezidivreflux in der Langzeit-Röntgenkontrolle betroffen (26,3% vs.20,0%). Die Häufigkeit des Auftretens von postoperativen Komplikationen (ohne Unterscheidung der Art der Komplikation) war bei laparoskopischer und offener Technik fast gleich (52,6% vs. 55,0%). Die Reoperationsrate war bei den offen operierten Kindern etwas höher (20,0% vs. 15,8%). Intraoperativ traten beim laparoskopischen Operationszugang mehr Blutungen auf (15,8% vs. 5,0%), bei offener Operation mehr Organläsionen (25,0% vs. 10,5%, bedingt vor allem durch die wesentlich höhere Zahl an Komplikationen durch Verwachsungen bei voroperierten Kindern). Alle drei Fälle mit postoperativem Ileus/Subileus waren offen operiert worden (15,0% vs. 0%). Die Ergebnisse des Gruppenvergleichs zwischen neurologisch retardierten Patienten (Gruppe A), gastrointestinal vorerkrankten Kindern (Gruppe B) und ansonsten gesunden Patienten (Gruppe C) zeigten im Vergleich ähnliche Erfolgs- und Komplikationsraten bei den vorerkrankten wie bei den gesunden Patienten. In der Symptombewertung im Langzeitverlauf schnitt Gruppe B sogar besonders gut ab. Die endoskopische Rezidivösophagitis in der Langzeitkontrolle war bei Gruppe C deutlich höher als bei Gruppe A (50,0% vs. 15,0%, allerdings war in der Gruppe C relativ häufig therapierefraktäre Ösophagitis bereits die Operationsindikation). Auch in der direkt postoperativen Magen-Darm-Passage war der Anteil der gesunden Patienten mit Reflux-Rezidiv relativ hoch (25,0%). Man kann also aus unserer Patientengesamtheit nicht den Schluss ziehen, vorerkrankte Patienten profitierten von der Fundoplikatio weniger als gesunde Patienten. Die Komplikations-, Rezidiv- und Reoperationsraten sind bei den geunden Kindern unserer Studie nicht besser als bei den vorerkrankten Kindern. Allerdings zeigten sich bei den Symptomen, die die Indikation für die Fundoplikatio darstellten, Unterschiede zwischen den Gruppen A bis C sowohl in der Art der Beschwerden als auch in deren Verlauf. Insgesamt waren gastrointestinale Beschwerden wie Erbrechen und Dysphagie mit der Fundoplikatio gut therapierbar ebenso wie Gedeihstörung, die am meisten bei Gruppe C als Hauptsymptom beschrieben war. Respiratorische Symptome konnten vor allem in der Gruppe der neurologisch retardierten Kinder nur zu einem geringen Prozentsatz behoben werden (23,1% beschwerdefrei). In Gruppe B war das Ergebnis nach Operation für die Kinder mit pulmonalen Komplikationen besser (60,0% beschwerdefrei), in Gruppe C waren Beschwerden im Respirationstrakt nur bei einem Kind ausschlaggebend für die Operation. Die medikamentös-therapierefraktäre Ösophagitis zeigte einen nur mäßigen bis keinen Erfolg nach der operativen Therapie (66,7% unverändert), wie man vor allem an den hohen Rezidivraten bei Patienten mit isolierter GERD sieht. Der Bedarf an Säureblockern konnte postoperativ erheblich gesenkt werden und weniger als ein Drittel der Kinder musste nach der Fundoplikatio noch kontinuierlich auf Protonenpumpenhemmer zurückgreifen. Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist eine große Elternzufriedenheit und deutliche Lebensqualitätsverbesserung der operierten Patienten, die sich aus der telefonischen Interview der Eltern ergab. Der Nachsorgezeitraum war seit OP bis zum Telefoninterview im Median 7,3 Jahre (+/-1,7). Die Komplikations-, Rezidiv- und Reoperationsraten der Fundoplikatios unserer Studie waren im Literaturvergleich relativ hoch, allerdings haben wir auch sehr detailliert alle Komplikationen aufgezeichnet, was sicher auch die hohen Prozentzahlen mit bedingt. Bei der Indikationsstellung zur Operation ist es wichtig, die häufigen Komplikationen und die relativ hohen Rezidiv- und Reoperationszahlen zu bedenken. Allerdings ist die Befragung zur Symptomentwicklung und Lebensqualitätsverbesserung im Langzeitverlauf ein ebenso wichtiger Erfolgsmaßstab. Das umfassend positive Ergebnis der Elternbefragung hat gezeigt, dass gerade auch die chronisch kranken Kinder von der Fundoplikatio deutlich profitieren können.
Patienten mit Anorexia nervosa in der Praxis – was tun?
0,3% aller jungen Frauen zwischen 14 und 18 Jahren in Deutschland sind nach Expertenschätzungen anorektisch. Bei älteren Erwachsenen und Männern ist die Anorexia nervosa zwar seltener, aber nicht minder lebensbedrohlich. Die Gefahr einer Chronifizierung ist sehr groß, gleichzeitig nimmt der Behandlungserfolg mit dem Grad der Chronifizierung ab. Deshalb sind eine frühe Diagnose und die rechtzeitige Einleitung einer Psychotherapie von entscheidender Bedeutung.
Patienten mit Anorexia nervosa in der Praxis – was tun?
0,3% aller jungen Frauen zwischen 14 und 18 Jahren in Deutschland sind nach Expertenschätzungen anorektisch. Bei älteren Erwachsenen und Männern ist die Anorexia nervosa zwar seltener, aber nicht minder lebensbedrohlich. Die Gefahr einer Chronifizierung ist sehr groß, gleichzeitig nimmt der Behandlungserfolg mit dem Grad der Chronifizierung ab. Deshalb sind eine frühe Diagnose und die rechtzeitige Einleitung einer Psychotherapie von entscheidender Bedeutung.
Prognose von Metakarpal- und Metatarsalfrakturen im Therapievergleich
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Ziel der Arbeit war es, einen Beitrag zur Optimierung der Behandlung von Metakarpal- und Metatarsalfrakturen bei Katzen und Hunden zu leisten. In der Literatur werden nach Behandlung von Mittelfußbrüchen des Hundes Lahmheitsfrequenzen von 18 bis 70 % angegeben und daher die in der Literatur genannten Behandlungsrichtlinien in Frage gestellt. Im ersten Teil dieser Arbeit sollte daher anhand einer retrospektiven Analyse von Spätkontrollen die Prognose dieser Verletzungen nochmals geprüft werden. Zur Auswertung gelangten Befunde von 100 Hunden mit vollständiger Dokumentation, deren Frakturheilung im Mittel 4 Jahre post Trauma dokumentiert werden konnte. Diese Patienten wurden der gewählten Therapie entsprechend drei Gruppen (1 = konservativ, 2 = operativ, 3 = gemischt) zugeordnet und Hunde mit gleichen Ausgangsvoraussetzungen nach den Verletzungsdetails auf Komplikationen im Heilungsverlauf sowie auf ihr röntgenologisches und funktionelles Endergebnis im Vergleich der Gruppen statistisch geprüft (exakter Test nach Fischer, exakter Wilcoxon-Mann-Whitney-Test). Des Weiteren wurden Risikofaktoren für jeden Knochen ermittelt (multiple, schrittweise, logistische Regression). Bei 15 Hunden wurden mit computerisierter Ganganalyse ferner die kinetischen Parameter Standphase (% Gesamtschritt), Impuls (% Gesamtimpuls) und Gewichtsverteilung (%) ermittelt. Komplikationen traten bei 11 von 67 (16 %) konservativ behandelten Hunden, 3 von 25 (12 %) operierten und 3 von 8 (37 %) teils konservativ, teils operativ versorgten Hunden auf. Im Endergebnis lag die Lahmheitsfrequenz insgesamt aber nur bei 3 %. Auch die Arthrose- und Pseudarthrosehäufigkeit war mit 3 % bzw.1 % niedrig, obgleich die Heilung röntgenologisch in 14 % der Fälle mit einem Achsenfehler meist einzelner Strahlen erfolgt war. Synostosen wurden bei 19 % der Patienten gefunden und waren signifikant häufiger bei chirurgisch behandelten Hunden. Ein statistisch gesicherter Unterschied im Behandlungserfolg zwischen den 3 Gruppen konnte nicht nachgewiesen werden. Es zeichnete sich jedoch ein höheres Komplikationsrisiko bei Metatarsalfrakturen ab und, auch am Metakarpus, bei Brüchen mit stärkerer Dislokation und Instabilität (Serienfrakturen). Nach den vorliegenden Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Prognose für Mittelfußbrüche des Hundes unter überwiegender Verwendung der in der Literatur genannten Behandlungsrichtlinien besser ist als bisher berichtet wurde. Unter dem Vorbehalt, dass in der Regel ungünstigere Frakturkonstellationen operativ versorgt werden, zeichnet sich abgesehen von der Inzidenz von Synostosen statistisch im Resultat zum wiederholten Male und trotz hoher Patientenzahlen kein Unterschied zwischen konservativer und operativer Therapie ab. Eine Power Analyse und gegebenenfalls eine multizentrische Untersuchung könnten zukünftig zur endgültigen Klärung dieser Fragestellung verhelfen. Für die Behandlung von Metakarpal- und Metatarsalfrakturen der Katze sind in der Literatur nur sehr wenige chirurgische Behandlungsoptionen berichtet. Im zweiten Teil dieser Arbeit sollte daher die Markraumbolzung (engl. ‚Dowel‘ pinning) beschrieben und mit der konservativen Behandlung von Mittelfußbrüchen bei Katzen verglichen werden. Von 351 Katzen konnten 63 mittel ‚Dowel‘ pinning, 35 konservative und 14 gemischt behandelte Patienten nach durchschnittlich 2,8 Jahren postoperativ klinisch und röngtenologisch nachuntersucht werden. Die Methode des ‚Dowel‘ pinning war der Verbandsbehandlung überlegen, wenn alle frakturierten Knochen versorgt werden konnten. War dies aufgrund von zu kurzen Frakturfragmenten oder Trümmerbrüchen nicht möglich, unterschied sich das Endergebnis nicht signifikant von konservativ behandelten Patienten. Achsenabweichungen wurden bei 16 % der mittels Verband behandelten und infolge Implantatbiegung bei 3 % der mittels ‚Dowel‘ pinning therapierten Katzen beobachtet. Letzteres bezieht sich auf nur eine operierte Katze mit 4 gebrochenen Metakarpalknochen derselben Gliedmaße. Zur Wanderung der Implantate innerhalb des Markraumes kam es bei zwei Katzen, wobei keine Anzeichen einer Pseudarthrose oder Lahmheit aufwiesen. Eine Pseudarthrose trat bei einer Katze mit gebrochenem 4. Metakarpalknochen auf, bei der die Fraktur mittels Kirschner-Bohrdraht nicht vollständig reponiert werden konnte. Osteomyelitiden wurden nicht beobachtet. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass unter Berücksichtigung der Risiken anderer intramedullärer Methoden, der sehr guten Ergebnisse und der geringen Komplikationsrate in dieser Untersuchung, die als ‚Dowel‘ pinning bezeichnete Markraumbolzung für die Behandlung von geschlossenen Metakarpal- und Metatarsalfrakturen der Katze eine einfache und kostengünstige Behandlungsmethode darstellt und empfohlen werden kann. Mit der vorliegenden Untersuchung konnte daher das operative Behandlungsspektrum von Mittelfußbrüchen bei der Katze um das ‚Dowel‘ pinning erweitert werden. Noch laufende Untersuchungen müssen zeigen, ob sich dieses Verfahren bei entsprechend dicken Pins auch für die Mittelfußbrüche des Hundes eignet.
Vergleich verschiedener Verhaltenstherapieformen bei aggressiven Hunden
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/07
Ziel der Studie war es, drei verschiedene Verhaltenstherapieformen bei aggressiven Hunden auf ihren Behandlungserfolg hin zu vergleichen.
Evaluation neuer medikamentöser Therapieansätze bei therapieresistenten akromegalen Patienten unter Verwendung des Wachstumshormon-Rezeptorantagonisten Pegvisomant
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Die durch einen Wachstumshormon-Exzess aufgrund eines Hypophysenadenoms ausgelöste, seltene Krankheit Akromegalie ist mit einer erhöhten Mortalität und Morbidität verbunden. Nur ein Teil der Patienten kann durch die bisherigen Therapieoptionen - Operation, Bestrahlung und medikamentöse Behandlung - geheilt werden. Die zur Verfügung stehenden Medikamente wurden seit 2003 durch das rekombinante Pegvisomant, einem GH-Rezeptor-Antagonisten, ergänzt. In dieser Arbeit wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Pegvisomant bei Patienten untersucht, die nach Operation, Bestrahlung und medikamentöser Therapie mit Dopaminagonisten und Somatostatinanaloga immer noch eine aktive Akromegalie aufwiesen. Durch die Behandlung mit Pegvisomant über 12 Monate wurde der Wachstumsfaktor IGF-I im Verlauf der Therapie bei allen Patienten signifikant gesenkt. Durch die Behandlung mit Pegvisomant kam es bei allen 7 Patienten zu subjektiven Verbesserungen und messbaren Veränderungen der klinischen Aktivität der Erkrankung. Des Weiteren konnte nach Umstellung von Somatostatinanaloga auf Pegvisomant eine deutliche Verbesserung der Blutglukosestoffwechsellage nachgewiesen werden. Bei 6 Patienten wurde des Weiteren eine Profil-Studie über je zweimal 6 Stunden durchgeführt, um kurzfristige Einflüsse von Pegvisomant, mit und ohne das Somatostatinanalogon Octreotid, auf das eGH und auf den Kohlenhydratstoffwechsel zu ermitteln. Hier zeigte sich ein deutlicher Unterschied in der Insulinverfügbarkeit und somit auch im Blutglukosespiegel mit, in Anwesenheit von Octreotid, deutlich höheren postprandialen Werten. Insgesamt konnte durch diese Arbeit gezeigt werden, dass die Anwendung von Pegvisomant bei bisher therapieresistenten Patienten sowie bei Patienten mit gestörter Glukosetoleranz zu einem guten Behandlungserfolg führen kann.
Lichtblicke: Fortschritte bei der Behandlung der feuchten AMD Diagnose altersbedingte Makuladegeneration - AMD. Noch vor wenigen Jahren konnte die Medizin kaum etwas gegen das Sehzellensterben im Auge ausrichten. Mittlerweile gibt es an der MHH eine medikamentöse Therapie, die die sich im Kampf gegen die aggressivere Variante, der feuchten AMD, bewährt hat. Entscheidend für einen Behandlungserfolg ist die Früherkennung.
Wirkmechanismen in der Behandlung und Prävention chronischer Rückenschmerzen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Ziel Rückenschmerzen verursachen hohe sozioökonomische Kosten. Dabei kommt der Gruppe mit chronischen Rückenschmerzen eine besondere Bedeutung zu, da 80% der Behandlungskosten durch diese Patienten verursacht werden. Dies macht Rückenschmerzen neben Erkältungskrankheiten zum teuersten medizinischen Problem, zur teuersten muskuloskeletalen Erkrankung und zur häufigsten Ursache von Arbeitsunfähigkeit unter 45 Jahren. Die Verhinderung der Chronifizierung ist deshalb aus sozioökonomischen, aber auch ethischen Gründen („burden of disease“), ein überaus wichtiges Ziel. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit Wirkmechanismen in der Behandlung von Rückenschmerzen, d.h. mit der Vorhersage des Behandlungserfolgs durch innerhalb eines Behandlungsprogramms erreichte Veränderungen. Zur Behandlung und Sekundärprävention von Rückenschmerzen existieren eine Reihe von Interventionen, deren Effektivität belegt ist. Weitgehend unklar sind jedoch die zugrunde liegenden Wirkmechanismen. Ein besseres Verständnis der Wirkmechanismen würde es ermöglichen, Interventionen effizienter und damit auch kostengünstiger zu gestalten. Teil 1 der Arbeit ist ein systematischer Review, welcher Wirkmechanismen nicht-operativer Behandlungen chronischer Rückenschmerzen analysiert. Teil 2 der Arbeit untersucht relevante Wirkmechanismen in einem trainingstherapeutischen und einem multimodalen Programm zur Sekundärprävention von Rückenschmerzen. Methoden Teil 1: Basierend auf einer systematischen Literatursuche in den Datenbanken Medline, Embase und PsycInfo wurde ein Review erstellt. Es wurden Studien ausgewählt, die u.a. die folgenden Einschlusskriterien erfüllen: (1) Behandlung chronischer Rückschmerzen mit Trainingstherapie, Verhaltenstherapie oder multimodalen Behandlungsansätzen, (2) Analyse von Veränderungen in Prädiktorvariablen und Anteil der aufgeklärten Varianz am Ergebnis mit multivariaten Verfahren, z.B. Regressionsanalysen. Aufgrund der Heterogenität der Daten hinsichtlich erhobener Variablen und eingesetzter statistischer Methoden wurden die Daten deskriptiv ausgewertet und zusammengefasst. Teil 2: Zur Identifizierung relevanter Wirkmechanismen in der Sekundärprävention von Rückenschmerzen wurden Daten einer randomisierten klinischen Studie zur Überprüfung der Effektivität eines Trainings- und eines multimodalen Programms mit multiplen Regressionsanalysen ausgewertet. Es sollten Prädiktorvariablen identifiziert werden, die das Erfolgskriterium „Reduzierung von Beeinträchtigung“ nach Beendigung des Präventionsprogramms am besten vorhersagen. Als potentielle Prädiktorvariablen wurden Veränderungen in psychologischen Variablen und körperlichen Leistungstests berücksichtigt, sowie Interaktionen zwischen dem jeweiligen Programm und den Prädiktorvariablen, um zu überprüfen, ob sich die Wirkmechanismen in beiden Programmen unterscheiden. Ergebnisse Teil 1: Es konnten 13 Studien in den Review eingeschlossen werden. Der Anteil der erklärten Varianz lag zwischen 5% und 71%. In den ausgewerteten Studien zeichnete sich - unabhängig von der Intervention - folgende Tendenz ab: Schmerzreduktion konnte am besten mit einer Abnahme von Beeinträchtigung und zu einem geringeren Teil mit der Verbesserung physischer Leistungsparameter erklärt werden. Abnahme von Beeinträchtigung wiederum wurde am besten sowohl mit Schmerzreduktion, als auch mit einer Zunahme aktiver Copingmechanismen und einer Reduzierung von Fear-avoidance Überzeugungen erklärt. Eine Rückkehr an den Arbeitplatz konnte vor allem durch eine Reduzierung der Beeinträchtigung und zu einem etwas geringeren Teil durch eine Zunahme aktiver Copingmechanismen sowie einer Reduzierung von Fear-avoidance Überzeugungen vorhergesagt werden. Teil 2: In beiden Programmen zur Sekundärprävention von Rückenschmerzen konnte Reduzierung von Beeinträchtigung am besten mit Reduzierung von Schmerzintensität und Katastrophisieren erklärt werden. Die Zunahme von Kraft und Ausdauer hatte keinen statistisch signifikanten Einfluss auf den Behandlungserfolg. Insgesamt konnte durch das finale Modell 68.7% der Varianz erklärt werden. Es wurden keine signifikanten Interaktionen zwischen Programm und Prozessvariablen gefunden. Diskussion und Schlussfolgerungen Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass zur Vorhersage des Behandlungserfolgs bei chronischen Rückenschmerzen, sowie in der Sekundärprävention Veränderungen psychologischer, sowie schmerz- und funktionsbezogener Variablen eine größere Relevanz besitzen, als Verbesserungen körperlicher Leistungsparameter. Diese Ergebnisse stimmen mit den Aussagen bisher publizierter Reviews und anderer Studien überein: Dass nämlich psychologische Faktoren - insbesondere Tendenzen zum Katastrophisieren und fear-avoidance Überzeugungen - sowie Schmerzparameter Chronifizierung und Beeinträchtigung wesentlich besser vorhersagen, als körperliche Parameter. Von besonderer Bedeutung bei den vorliegenden Ergebnissen ist zudem, dass der Behandlungserfolg trainingstherapeutischer und multimodaler Verfahren vorrangig durch psychologische Wirkmechanismen, nämlich Veränderungen psychologischer Faktoren wie dysfunktionalen Überzeugungen, vermittelt wird. Dies ist umso interessanter, als trainingstherapeutische Programme keine direkten psychologischen oder kognitiv-behavioralen Interventionen beinhalten. Der Wert trainingstherapeutischer Interventionen scheint deshalb darin zu liegen, die Erfahrung zu vermitteln, dass Bewegung nicht schädlich ist, und hierdurch dysfunktionale Einstellungen und Bewältigungsstrategien zu verändern. Ob zur Erreichung dieses Ziels die Durchführung aufwändiger Trainingskonzepte an speziellen Geräten notwendig ist, gilt es zu überdenken. In Bezug auf multimodale Programme könnten die Ergebnisse bedeuten, den Schwerpunkt auf verhaltens- und erfahrungsorientierte - im Gegensatz zu edukativen und kognitiven Inhalten - zu legen.
Langzeituntersuchung Bionator-behandelter Patienten 20 Jahre nach Behandlungsende. Modellanalyse
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Fragestellung: Wie stabil sind die erzielten Therapieergebnisse 20 Jahre nach der Behandlung mit dem funktionskieferorthopädischen Gerät Bionator? Material und Methode: 36 Patienten wurden in einer breit angelegten Langzeituntersuchung 20 Jahre nach erfolgter Bionator-Behandlung nachuntersucht. Die Patienten zeichneten sich durch Homogenität in Anfangsbefund (dentale Klasse II), Geschlechtsverteilung (52,8% ♀, 47,2% ♂), Alter bei Behandlungsbeginn und gewählter Therapieform (alle Bionator) aus. Im Zuge der vorliegenden Studie wurden die Ergebnisse der Modellanalyse und des PAR Index untersucht. Zu vier unterschiedlichen Untersuchungszeitpunkten (T1: Beginn der Bionator-Behandlung, T2: Ende der Bionator-Behandlung, T3: kieferorthopädisches Behandlungsende, T4: 20 Jahre nach der Bionator-Behandlung) wurden folgende Parameter erhoben und miteinander verglichen: Overjet, Overbite, Unterkiefer-Zahnbogenform (Zahnbogenlänge, anteriore und posteriore Zahnbogenbreite), Oberkiefer-Zahnbogenform (Zahnbogenlänge, anteriore und posteriore Zahnbogenbreite) und der PAR Index. Als statistische Methoden wurden der Friedman und der Wilcoxon Test angewandt. Die Fehleranalyse erfolgte anhand der Dahlberg-Formel. Ergebnisse: Der Overjet konnte durch den Bionator signifikant verringert werden. Dieses Ergebnis blieb auch im Langzeitintervall stabil. Die ursprünglich erzielte Verringerung des Overbite rezidivierte jedoch nach 20 Jahren teilweise. In Bezug auf die Oberkiefer- und Unterkiefer-Zahnbogenformen konnte keine wesentliche Beeinflussung durch den Bionator festgestellt werden. Lediglich die Oberkiefer-Zahbogenbreite wurde durch den Bionator leicht verbreitert. Mit Hilfe des PAR Index konnte nachgewiesen werden, dass der erzielte Therapieerfolg mit dem Bionator (PAR Index Reduktion T1-T2: 40,2%) auch im 20-Jahres-Intervall weitgehend stabil war (PAR Index Reduktion T1-T4: 37,4%). Schlussfolgerung: Anhand der Parameter Overjet und PAR Index konnte im Rahmen dieser Studie gezeigt werden, dass der erzielte Behandlungserfolg durch den Bionator auch 20 Jahre nach der Therapie stabil geblieben war.
Topische Immuntherapie mit Diphenylcyclopropenon bei verschiedenen Typen der Alpecia areata: Assoziation zu klinischen Parametern und einem funktionellen Genpolymorphismus des Interleukin-6-Promotors
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Alopecia areata ist die häufigste Form krankheitsbedingter Verminderung der Haardichte. Anhand von 97 Patienten wurden Patientenvariablen in Abhängigkeit des Typs der Alopecia areata untersucht. Eine Abhängigkeit der Typen Alopecia areata universalis und totalis besteht von einer positiven Familienanamnese und Nagelwachstumsstörungen. Ferner besteht ein Trend, daß der Universalis-Typ und der Totalis-Typ mit einem niedrigeren Erkrankungsalter einhergehen. Es besteht keine Abhängigkeit von Vorliegen von anamnestischer Spontanremission, anderen Autoimmunerkrankungen und Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis sowie Erkrankungsdauer. Die topische Immuntherapie mit Diphenylcyclopropenon gilt als derzeit wirkungsvollster Therapieansatz. 86 Patienten wurden abschließend damit therapiert. Ein Halbseitenerfolg, als unabdingbare Voraussetzung zur Unterscheidung von Spontanremission und Behandlungserfolg, stellte sich bei 55 Patienten (64%) ein. Vollständiges Wiederwachstum erzielten 43 Patienten (50,0%). Die mittlere Zeitdauer bis zum Erreichen des Vollseiteneffekts betrug 47,1 Wochen, zum Erreichen eines Halbseiteneffekts waren 20,7 Wochen nötig. Therapieerfolg ist wahrscheinlicher bei dem Multilocularis-Typ und dem Ophiasis-Typ, unwahrscheinlicher dagegen bei dem Universalis-Typ und dem Totalis-Typ. Ein Therapieerfolg ist weiterhin wahrscheinlicher, je kürzer die Erkrankungsdauer und je höher das Erkrankungsalter ist. Der Behandlungserfolg ist dagegen unabhängig von positiver Familienanamnese, anamnestischer Spontanremission, assoziierten Autoimmunerkrankungen und Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis sowie Nagelwachstumsstörungen. Die Alopecia areata wird über eine T-zelluläre Immunreaktion moduliert, in deren Verlauf Zytokine eine wesentliche Rolle spielen. Ein Einzelnukleotid-Polymorphismus an Position -174 bp der humanen IL-6-Promotor-Region wurde beschrieben, resultierend aus einer Substitution von Guanin zu Cytosin. Es zeigte sich eine Abhängigkeit des Universalis-Typs der Alopecia areata vom Genotyp CC, während der Multilokularis Typ abhängig von dem Genotyp GG war. Weitere Patienten müssen untersucht werden, damit diese Abhängigkeit als uneingeschränkt gilt. Die Abhängigkeit der Alopecia areata von diesem Gen-Polymorphismus ist erstmals beschrieben worden.
Multiple Sklerose: Systematische Analyse des T-Zell-Repertoires von Hirnläsionen, Liquor und peripherem Blut
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Mit CDR3-Spektratyping wurde das T-Zell Repertoire von Gehirn, Liquor und Blut systematische verglichen. Unsere Ergebnisse liefern zum allerersten Mal den experimentellen Beweis auf wissenschaftlicher Grundlage, dass die Zellen des Liquors teilweise das Immun-Repertoire des Gehirn in der Multiplen Sklerose repräsentieren. Diese Arbeit hat direkte Relevanz für zukünftige Arbeiten an der Immun-Pathogenese des MS, da Liquor –im Gegensatz zu Hirngewebe- für wissenschaftliche Studien leicht verfügbar ist. Unsere Ergebnisse zeigen weiter, dass ein Teil dieser CD8+ T-Zell Klone, die das Gehirn von MS-Patienten infiltrieren, auch im Blut nachweisbar sind. Diese T-Zell könnten in Zukunft hinsichtlich der Beurteilung von Krankheitaktivität und Behandlungserfolg nützlich sein. Sie können aus dem Blut in größere Zellzahlen isoliert werden. Dies bietet ein realistische Chance, die Antigen-Spezifität und die Krankheitsrelevanz dieser T-Zell Klone näher zu beleuchten und somit die Entwicklung antigenspezifischer Immuntherapeutika zu ermöglichen.
Therapieergebnisse in der Lese-/Rechtschreibübungsbehandlung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Zusammenfassend muß für die hier besprochenen Therapiestudien angenommen werden, daß der Grad der Lese-/Rechtschreibstörung in den verglichenen Studien weniger ausgeprägt war, als in der hier vorgestellten Studie. Nachdem die verwendeten Testmaterialien und Auswertungsmethoden nie identisch waren, konnte kein direkter Vergleich der Ergebnisse angestellt werden. c. Einfluß einer Sprachstörung und psychischer Störungen Zu den weiter durchgeführten statistischen Untersuchungen, wie der Prüfung des Einflusses einer Sprachstörung, eines Hyperkinetischen Syndroms und einer motorischen Störung, sowie Diskussion des Alters, Geschlechts und des Intelligenzquotienten ergaben sich folgende Ergebnisse. Einfluß einer Sprachstörung auf den Therapieerfolg: Bei der Untersuchung der fünften Hypothese wurde festgestellt, daß die sprachgestörte Gruppe keine signifikant schlechteren Therapieergebnisse erreichte. Im deutsche Sprachraum konnten keine anderen Untersuchungen gefunden werden, die sich mit dem Einfluß einer Sprachstörung auf den Lese-/Rechtschreiberfolg beschäftigen. Einzig Ensslen (1984) stellte fest, daß zusätzlich sprachgestörte Legastheniker, trotz adäquater Behandlung zumeist sehr geringe Leistungsfortschritte zeigen. Beim ersten Testzeitpunkt wiesen die 15 klinisch behandelten, sprachgestörten Kinder einen wesentlich schlechteren Lese-/Rechtschreibstatus auf und waren zusätzlich bei der Diagnosestellung im Mittel ein Jahr jünger als die Kinder der nicht sprachgestörten Vergleichsgruppe. Zur Darstellung des Therapieeinflusses mußten Differenzen zwischen beiden Testzeitpunkten gebildet werden. Also wurde nur ein Leistungsunterschied in Zahlenform ausgedrückt und für die beiden Gruppen sprachgestört/nicht sprachgestört verglichen. Möglicherweise könnte der dabei gemessene Unterschied annähernd gleich groß sein und so zu einem ähnlichen Ergebnis in der sprachgestörten Gruppe geführt haben. Das gleich große Ergebnis könnte jedoch auch auf die hier angewandte Übungstherapie zurückzuführen sein. Gezeigt werden konnte, daß sprachgestörten Legasthenikern mit psychiatrischer Begleitsymptomatik in diesem klinischen Setting zu einem ähnlichen Therapiefortschritt verholfen werden kann, wie er für einen Legastheniker ohne Sprachstörung ambulant zu erzielen ist.. Einfluß eines Hyperkinetischen Syndroms auf den Therapieerfolg: In dieser Untersuchung konnte kein Zusammenhang beobachtet werden. Die Rolle eines Hyperkinetischen Syndroms bei der Legastheniebehandlung wurde 1985 von Cantwell und Baker für den amerikanischen Sprachraum als möglicher Faktor, der die Therapieergebnisse beeinflussen kann, beschrieben. Weitere Angaben konnten nicht gefunden werden.Einfluß einer motorischen Störung auf den Therapieerfolg: Für diese Studie konnte aus statistischen Gründen nur eine Tendenz für den Einfluß einer Motorischen Störung beschrieben werden. Sie zeigt ebenfalls an, daß der Behandlungserfolg nicht durch eine motorische Störung beeinflußt wird. Warnke (1990) schreibt von dem untergeordneten Einfluß einer motorischen Störung auf die Behandlungsergebnisse, sonst waren keine weiteren Angaben verfügbar. Einfluß des Alters auf den Therapieerfolg: Das Alter der Kinder zum ersten Testzeitpunkt dieser Untersuchung hatte keinen erkennbaren Einfluß auf den bisher beobachtbaren Therapieerfolg. Dies entspricht nicht den Feststellungen von Scaborough (1991), der herausfand, daß ein möglichst früher Therapiebeginn von entscheidender Bedeutung für die Therapieeffizienz ist. Einfluß des Geschlechts auf den Therapieerfolg: Ebenso spielte das Geschlecht (siehe auch Studie von Lovett et al.,1989) keine erkennbare Rolle für den Therapieerfolg. Die Aussagemöglichkeiten dieser Untersuchung bezüglich des Geschlechtes war allerdings durch die geringe Anzahl der weiblichen Kinder (N = 4) deutlich eingeschränkt. Zusammenhang zwischen Intelligenzquotient, Alter und Therapieerfolg: Bei der Betrachtung von Alter und Intelligenzquotienten konnte ein Zusammenhang beobachtet werden. Je älter das Kind war, desto höher war der Intelligenzquotient. Wahrscheinlich ist dieser Zusammenhang durch das geringe Alter der sprachgestörten Kinder bedingt, die wegen mehrerer Teilleistungsstörungen möglicherweise nicht in der Lage waren, den Intelligenztest vollständig nach Vorschrift durchzuführen. Der durchschnittliche Unterschied bezüglich des Intelligenzquotienten zwischen sprachgestörten und nicht sprachgestörten Kindern lag - je nach Hypothese - bei 6 bis 17 IQ-Rangpunkten. Dabei zeigte die sprachgestörte Gruppe immer einen niedrigeren Durchschnitts-IQ. Ein Zusammenhang des Intelligenzquotienten mit der Leistungsänderung aller drei Untersuchungsmöglichkeiten der 1. Hypothese war jedoch nicht festzustellen.