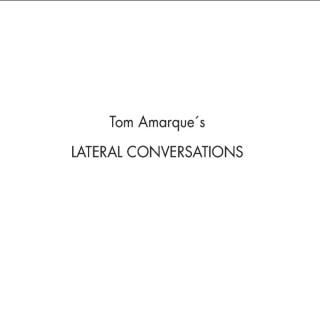Podcasts about performanz
- 38PODCASTS
- 43EPISODES
- 40mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 17, 2024LATEST
POPULARITY
Best podcasts about performanz
Latest news about performanz
- Weiblichkeit – Macht – Männlichkeit: Perspektiven für eine Geschlechtergeschichte der Antike AWOL - The Ancient World Online - Jan 20, 2025
Latest podcast episodes about performanz
Social-Media und die AfD, Medienkompetenz, Trusted Flagger
Social-Media-Partei AfD: Wird die digitale Performanz der AfD häufig überschätzt? |Medienkompetenz: „Fit for the News“ - Interview mit Prof. em. Dr. Michael Haller, Projektleiter. | OBS-Geschäftsführer Jupp Legrand. | "Trusted Flagger" und der Vorwurf der Zensur
Social-Media und die AfD, Medienkompetenz, Trusted Flagger
Social-Media-Partei AfD: Wird die digitale Performanz der AfD häufig überschätzt? |Medienkompetenz: „Fit for the News“ - Interview mit Prof. em. Dr. Michael Haller, Projektleiter. | OBS-Geschäftsführer Jupp Legrand. | "Trusted Flagger" und der Vorwurf der Zensur
Social-Media und die AfD, Medienkompetenz, Trusted Flagger
Social-Media-Partei AfD: Wird die digitale Performanz der AfD häufig überschätzt? |Medienkompetenz: „Fit for the News“ - Interview mit Prof. em. Dr. Michael Haller, Projektleiter. | OBS-Geschäftsführer Jupp Legrand. | "Trusted Flagger" und der Vorwurf der Zensur
Judith Butler – Das Unbehagen der Geschlechter (Lesekreis mit Christiane 20)
Wir setzen Kapitel 1.5 fort. Heute geht es das, was Butlerm den "naiven Diskurs" nennt. Wir fragen uns wo Trans herkommt und diskutieren, dass Butler mit their Theorie der Performanz das Gefühl nicht erklären kann, das trans Menschen empfinden. Es geht weiter um die heterosexuelle Matrix und damit verbunden, um den naturalistischen Fehlschluss. Wir besprechen Foucaults These vom Sexus als Machtinstrument der Fortpfanzung und streiten am Ende heftig über die Akzidens der Identität. Wollt ihr uns unterstützen? Dann gebt uns doch einen Kaffee aus! :) https://www.buymeacoffee.com/privatsprache Oder über PayPal: https://www.paypal.me/DanielBrockmeier ==== abonniert meinen Podcast ===== Philosophie-Videos: Aristoteles' Kritik an Platons Ideenlehre: https://youtu.be/Hjghct9d8yo?si=puV480EiYUFQdlFh Ethik und Ästhetik in Tár – Kann man die Kunst vom Künstler trennen? https://youtu.be/3oH9G19T04A 10 philosophische Lieblingsbücher: https://youtu.be/LfQ2CksAEB0 Alle Philosophie-Videos: https://www.youtube.com/watch?v=MhvEH9NjuPs&list=PL1L_CFjFbZ9aRfcEW6avxSgvxr9Q2jBrH Wie das mit der Philosophie angefangen hat: https://www.youtube.com/watch?v=MhvEH9NjuPs&t Zur weiteren Recherche über Judith Butler: Judith Butler – Das Unbehagen der Geschlechter: https://amzn.to/3ENUwBW * Lars Distelhorst – Judith Butler https://amzn.to/3H31oho * Riki Wilchins – Gender Theory. Eine Einführung: https://amzn.to/3AZFZSw * Ernst Ulrich von Weizsäcker über Konrad Lorenz: https://gegneranalyse.de/personen/konrad-lorenz/# Bundespsychotherapeutenkammer über die Entpathologisierung von Homosexualität: https://www.bptk.de/homosexualitaet-und-transgeschlechtlichkeit-sind-keine-krankheiten/ Olaf Hiort über biologisches Geschlecht als Spektrum https://www.spektrum.de/frage/geschlechtsidentitaet-gibt-es-mehr-als-zwei-geschlechter/1835662 Simone de Beauvoir – Das andere Geschlecht: https://amzn.to/3XtAXb3 * Eva Scheufler – Die feministische Philosophie und der Frauenkörper https://utheses.univie.ac.at/detail/913# Gödels Unvollständigkeitssätze https://www.spektrum.de/kolumne/goedels-unvollstaendigkeitssaetze-mathematik-ist-unvollstaendig/2019298 Die BPB zu Humanismus: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320496/humanismus/ Deutschlandfunk zu Butlers Dekonstruktion des Humanismus: https://www.deutschlandfunkkultur.de/humanismus-einer-dekonstruktivistin-100.html Und Produktive Differenzen zur Frage, warum Butler diese Dekonstruktion vornimmt: https://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=26 Wörterbuch der Philosophischen Begriffe https://amzn.to/3Qi5Ygk * Spektrum der Wissenschaft zur Herr-Knecht-Dialektik https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/herr-und-knecht/871 "Reach Everyone on the Planet" von Kimberleé Crenshaw https://www.boell.de/sites/default/files/crenshaw_-_reach_everyone_on_the_planet_de.pdf Habermas' Diskursethik https://philosophisch-ethische-rezensionen.de/rezension/Themen/Habermas1.html Jürgen Habermas: Erläuterungen zur Diskursethik https://amzn.to/3SuSwqA * Der Podcast Feminist Shelf Control: https://podcasts.apple.com/de/podcast/feminist-shelf-control/id1635137441 Die drei Paradigmen er Philosophie: https://perspektiefe.privatsprache.de/die-drei-paradigmen-der-philosophie/ Definition Identität: https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/identitaet/931 Foucault – Sexualität und Wahrheit: Erster Band: Der Wille zum Wissen: https://amzn.to/3z5C9JB * Kübra Gümüşay – Sprache und Sein: https://amzn.to/3dfJYBx * Podcast What's in your Pants: https://whats-in-your-pants.de/ Philosophy Tube zu Judith Butler: https://youtu.be/QVilpxowsUQ?si=6SvqY51IeYfT5kFy Mein kleines Philosophie-Lexikon: https://amzn.to/3LRTYyJ * *Das ist ein Affiliate-Link: Wenn ihr das Buch kauft, bekomme ich eine winzige Provision und freue mich. Oder in Amazons Formulierung: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Highlight aus Folge #12 Gefangen in der Komfortzone. Georgiy Michailov trifft Andreas Kuffner
Disziplin. Durchhaltevermögen. Dranbleiben. Kennt die aktuelle Generation nicht. Soweit das Vorurteil. Dabei kann man Kinder und Jugendliche durchaus dafür begeistern, weiß Andreas Kuffner, systemischer Coach und Ruder-Olympiasieger. Das funktioniert aber nur, wenn man Druck und Verbissenheit durch eine gewisse Disziplin und Sicherheit ersetzt.
#151 Servant Politics im Gespräch mit Jan Schoenmakers (Managing Partner at HASE & IGEL)
Zur Person: Managing Partner at HASE & IGEL Big-Data-driven AI Solutions for Better Decisions in the Marketplace "Ich nehme Politik als kopflos & überfordert wahr." "Wir müssen Partizipation neu denken." "Die Akzeptanz eines Systems hängt damit zusammen, wie seine Performanz ist." Einige Gedanken-Funken aus dem Podcast: - Politik als Rahmen für die Gesellschaft - Verwaltung der Allmende - Politik-Puzzle-Stücke - oft nicht passgenau - Vertrauen in Demokratie, Wirtschaftssysteme, Ämter und Ministerien - Ehrliche, offene Debatte "Wie wollen wir leben?" - Konflikte unter den Teppich kehren - Runde Tische (auch lokal) - Verstehen & einbeziehen der Generationen - Transparenz - was passiert in Gesellschaft, Wirtschaft, im Umfeld? - Daten nutzen => Digitalisierung & KI bieten Informationen - Zielkonflikte in der Politik => neue Prozesse für eine greifbare gesellschaftliche Vision - Ziele-System => Ziele klar definieren
Der Konflikt zwischen Ethik und Ästhetik in Tár und das Verhältnis von Kunst und Künstler*in
In einer Szene, die das Herzstück seines Films Tár darstellt, beschäftigt sich Regisseur und Drehbuchautor mit den Fragen, ob sich Kunst und Künstler*in trennen lassen und, was mehr Gewicht hat: Ethik oder Ästhetik. Nebenbei ist die Szene ein Meisterstück in sophistischer Gesprächsführung. Ich habe mir die Argumente detailliert angeguckt: Eine philosophische Szenenanalyse. Wollt ihr mich unterstützen? Dann gebt mir doch einen Kaffee aus! :) https://www.buymeacoffee.com/privatsprache Roland Barthes – Der Tod des Autors: https://www.youtube.com/watch?v=Gte9Y8x9OVM 10 philosophische Lieblingsbücher: https://youtu.be/LfQ2CksAEB0 Was vom Tag übrig blieb: https://youtu.be/NSYDxxjGPrA Alle Philosophie-Folgen: https://www.youtube.com/watch?v=MhvEH9NjuPs&list=PL1L_CFjFbZ9aRfcEW6avxSgvxr9Q2jBrH Wie das mit der Philosophie angefangen hat: https://www.youtube.com/watch?v=MhvEH9NjuPs&t Zur weiteren Recherche: Der Tod des Autors‘ findet ihr in Barthes Buch ‚Das Rauschen der Sprache‘: https://amzn.to/40VP7lx * Judith Butler – Das Unbehagen der Geschlechter: https://amzn.to/3ENUwBW * Albert Schweitzer – Johann Sebastian Bach: https://amzn.to/3TZU4Yz * Nelson Goodman – Sprachen der Kunst: https://amzn.to/40V8Ou4 * Christian Stetter – System und Performanz: https://amzn.to/3G5SDll * *Das ist ein Affiliate-Link: Wenn ihr das Buch kauft, bekomme ich eine winzige Provision und freue mich.
Zusammen mit Dr. Sven Herpig, Leiter für Internationale Cybersicherheitspolitik der Stiftung Neue Verantwortung redet Benjamin Hilbricht über die Cybersicherheitsagenda der Bundesregierung und erfährt, was Deutschland in Sachen Cybersicherheit noch von der Ukraine lernen kann. Außerdem haben wir recherchiert, wie Verwaltungen mit erhöhten Datenmengen umgeht und trotzdem den Spagat zwischen Performanz und Sicherheit, sowie Resilienz und Innovation schaffen wollen. Zu guter Letzt kommentieren wir, warum ein Wechsel von Video-Ident zu eID Sinn machen würde.
In unserer heutigen Episode trifft überlanger Kunstfilm auf humoristische Nudelsuppe. Wir schlagen Leos Carax' cineastisches Programmheft bühnenzentrierter Performanz auf, tauchen in die genrebeladene Ramen-Schüssel von Tampopo ein und bekommen mächtig Kohldampf bei Juzo Itamis genüsslichem Meisterwerk.
Dürfen Wissenschaftler:innen Quellen erfinden? – mit Thomas Etzemüller
Unser heutiger Gast ist Thomas Etzemüller, Professor an der Uni Oldenburg für Kulturgeschichte der Moderne unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas. Wie sein Studium der Geschichts-, Film- und empirische Kulturwissenschaft ihn in seinem Denken und Arbeiten beeinflusst hat erzählt er uns in dieser Folge. Seine Doku-Fiktion "Henning von Rittersdorf: Das Deutsche Schicksal. Erinnerungen eines Rassenanthropologen.", handelt von einem Rassenanthropolge, der unter dem Naziregime an die Uni kam und nach dem Krieg klar stellen will, dass er nur reine Wissenschaft betrieben hat. Wir sprechen in Bezug auf dieses Buch darüber wo die Grenzen zwischen Forschungsliteratur und Romanen sind, wie Wissenschaft schreiben sollte und warum es vielleicht einfacher ist über die Frühe Neuzeit zu schreiben. Außerdem sprechen wir nicht nur über die Rassenanthropologie unter dem Nazirregime sondern welche sie Rolle sie auch heute noch spielt. Wer Gast sein möchte, Fragen oder Feedback hat, kann dieses gerne an houseofmodernhistory@gmail.com oder auf Twitter an @houseofModHist richten. Literatur & Quellen: Alkemeyer, Thomas: Präsenz der stummen Macht symbolischer Gewalt. Zeitschrift für Qualitative Forschung, 8(1), 2007, S. 11-31. Darnton, Robert: Das große Katzenmassaker. Streifzüge durch die französische Kultur vor der Revolution. München: Carl Hanser, 1989. Davis, Natalie Zimon: Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des. Martin Guerre. München: Piper, 1984. Etzemüller, Thomas: Auf der Suche nach dem Nordischen Menschen. Die deutsche Rassenanthropologie in der modernen Welt, Bielefeld 2015. Etzemüller, Thomas: Biographien: Lesen - erforschen - erzählen. Campus Verlag, 2012. Etzemüller, Thomas (Hg.): Der Auftritt. Performanz in der Wissenschaft. transcript, 2019. Etzemüller, Thomas: Henning von Rittersdorf: Das Deutsche Schicksal. Erinnerungen eines Rassenanthropologen. transcript, 2021. Etzemüller, Projekte: Imagination und Intervention: https://uol.de/thomas-etzemueller/forschung/moderne Etzemüller, Thomas: Rezension zu von Richard J. Evans: Fakten und Fiktion. https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-3168 Etzemüller, Thomas: Romantischer Rhein - Eiserner Rhein. Ein Fluß als imaginary landscape der Moderne, in: Historische Zeitschrift 295, 2012, S. 390-424. Etzemüller, Thomas: Sozialgeschichte als politische Geschichte: Werner Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945. Oldenburg, 2001. Etzemüller, Thomas: Was wahr sein könnte. Plädoyer für eine fiktionale Empirie, in: Merkur 72, 2018, H. 835, S. 17-28. Harris, Robert: Fatherland, 1992. Mantel, Hilary: Trilogie: Wolf Hall, Bring Up the Bodies, The Mirror & the Light, 2009-2020. Medick, Hans: Der Dreißigjährige Krieg – Zeugnisse vom Leben mit Gewalt. Wallstein, 2018. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und Starker Staat. C.H. Beck, 2013. Schelsky, Helmut: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme. 2. Auflage. Ferdinand Enke, Stuttgart 1954. Schlumbohm, Jürgen: Lebendige Phantome. Ein Entbindungshospital und seine Patientinnen 1751–1830, Wallstein, Göttingen 2012. Sedlmayr, Hans: Verlust der Mitte. Salzburg-Wien, 1948. Suderland, Maja: Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Historical Social Research, 40(1), 2017, S. 323-350. Timm, Uwe: Ikarien. Kiepenheuer & Witsch, 2017. Wehler, Hans Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. München: C. H. Beck, 1987. Zola, Emil: Der Zyklus Die Rougon-Macquart, 1869-1893.
HCH290 Advi Weekly: 07.03.-13.03.2022 back to pandemic school
Erste Schulwoche, mit faserigem Gerede, während ich versuche meinen Sonntag zu strukturieren, der Frage nach der Performanz und dem überholten E-Bike.
Diese Folge als Video schauen Aus der Preshow: Baaaaaadges, kein Zweitdisplay, neue Macs, Performanz, von Pixeln und Auflösung Danksagung an Raffael für das Aufgabenscript inklusive Updates Spezial-DANKE: Spende UNO-Flüchtlingshilfe Skylum-Entwicklerteam sitzt in der Ukraine und bittet um Drohnen Fast immer dienstags, gerne mal um 18:00 Uhr: Happy Shooting Live. Täglich im Slack mitmachen – auch … „#752 – Radioactive Eggplant“ weiterlesen Der Beitrag #752 – Radioactive Eggplant ist ursprünglich hier erschienen: Happy Shooting - Der Foto-Podcast.
Diese Folge als Video schauen Aus der Preshow: Baaaaaadges, kein Zweitdisplay, neue Macs, Performanz, von Pixeln und Auflösung Danksagung an Raffael für das Aufgabenscript inklusive Updates Spezial-DANKE: Spende UNO-Flüchtlingshilfe Skylum-Entwicklerteam sitzt in der Ukraine und bittet um Drohnen Fast immer dienstags, gerne mal um 18:00 Uhr: Happy Shooting Live. Täglich im Slack mitmachen – auch … „#752 – Radioactive Eggplant“ weiterlesen Der Beitrag #752 – Radioactive Eggplant ist ursprünglich hier erschienen: Happy Shooting - Der Foto-Podcast.
Deep Dive 101 – Couchbase & CBL-Dart
Couchbase ist eine No-SQL-Datenbanktechnologie und dieser Tage begleitet uns der Release von Couchbase Lite 3.0 und CBL Dart 1.0. Weil wir Couchbase bei unserem Mobile Game 4 Bilder 1 Wort einsetzen, haben wir uns für einen Deep Dive in das Thema zwei Experten eingeladen – Gregor Bauer, PreSales Solutions Engineer bei Couchbase, und Gabriel Terwesten, Freelance-Webentwickler, der Open Source Couchbase Light für Dart und Flutter (CBL-Dart) entwickelt hat.Wir klären zunächst die Begriffe rund um Couchbase und erkunden dann gemeinsam mit Gregor und Gabriel die Eigenschaften der offline-first Datenbank, die man auch per Cloud verfügbar machen kann. Was Couchbase neben praktisch endloser Skalierbarkeit und super Performanz außerdem ausmacht, erzählen wir euch in dieser Folge.Picks of the Day: Gabriel: Explo - Render Tree in 3D für Flutter – Mit dem Tool unseres Gastes Gabriel Terwesten könnt ihr euch den Render Tree eurer Flutter-App in 3D darstellen lassen. Gregor: Hybride Datenbanken – In dem Artikel von unserem Gast Gregor Bauer lernt ihr wie man SQL und NoSQL verbinden kann. Jojo: Ocarina – Ein Flutter Package um Audio-Datein abzuspielen. Schreibt uns! Schickt uns eure Themenwünsche und euer Feedback: podcast@programmier.barFolgt uns! Bleibt auf dem Laufenden über zukünftige Folgen und virtuelle Meetups und beteiligt euch an Community-Diskussionen. TwitterInstagramFacebookMeetupYouTubeMusik: Hanimo
#30PostSovietYears | Wirtschaftspolitik und Regimestabilität: Einsichten aus Russland und Belarus
Nach 1991 schlugen Belarus und Russland unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungspfade ein: Während Privatisierung und Liberalisierung in Belarus bis heute nur ansatzweise vollzogen wurden, markiert Russlands Schocktherapie schon in den frühen 1990er Jahren die Einführung zentraler Elemente der Marktwirtschaft. Gleichwohl gelten Eigentumsrechte in beiden Ländern immer noch als unsicher und auch in Russland spielt der Staat in der Wirtschaft inzwischen wieder eine größere Rolle. Wie ist es zu erklären, dass sich beide Länder nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wirtschaftlich so unterschiedlich orientierten? Wie wirken die Erfahrungen der 1990er Jahre bis heute auf die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern? Wie hat sich das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft in Belarus und Russland inzwischen verändert und in welchem Zusammenhang steht die wirtschaftliche Performanz mit der Stabilität der autoritären Regime beider Länder? Diese Fragen diskutiert Julia Langbein vom ZOiS mit dem Wirtschaftswissenschaftler Michael Rochlitz und dem Politikwissenschaftler Fabian Burkhardt.
Nicht dass Sie denken, Brunner gönnte erfolgreichen Mitmenschen nicht ihre Top-Performance-Werte. Sollen Sie haben – aber ihm bitte nicht damit auf den Zeiger gehen... Die Glosse der Woche.
Piratensender Powerplay, Episode 24: "Chronik der 600 angekündigten Tode"
00:30: Der diskursive Glühweinstand öffnet wieder! 01:00: Das Menü ist schnell erklärt, es geht heute "nur" um Corona, Merkel, Klima. Also die generelle Lage, Merkels emotionale Worte, das Klima als noch viel größeres Problem, bei dem wir genau so versagen. Yeah! 01:30 Samira fasst Merkels Rede, Appell, Flehen zusammen. So emotional hat man die Kanzlerin kaum jemals gesehen, das kann man feststellen. Ein rhetorischer Ausschlag. Aber war das nun ein guter Auftritt? Wir sind unentschieden. 04:50 Friedemann mag nochmal die Wörter genauer anschauen, die sie benutzt hat. Die historische Dimension, die sie aufmacht; die Wissenschaft, die sie bemüht; die Symbole des Verzichts "Waffelbäckereien und Glühweinstände", für deren Ausfall sie sich entschuldigt. Was bedeutet das alles? 08:30 Ghostwriterin Samira hätte ihr genau dazu geraten, also Wortwahl, Emphase, Sprechhaltung. Und dass sie sich eine Subjektivität getraut hat. Und analysiert kurz, wie Merkel sonst gerne redet. Und wovon eher nicht. 09:10 Friedemann fand den Auftritt auch bemerkenswert, aber auf vielen Ebenen auch problematisch, fast unwürdig. Sich selbst erhebend, gleichzeitig aber pathetisch, ohne die eigene Verantwortung adäquat zu etablieren. Man könnte dabei fast vergessen, dass sie die Bundeskanzlerin ist, Chefin einer Regierung, die sehenden Auges in diese Katastrophe gesteuert ist. 12:40 Der Spin, dass die Bevölkerung eben nicht (mehr) mitgemacht hätte, ist falsch. Dass die Ministerpräsident*innen alles ausgebremst hätten? Schon eher. Aber hat Merkel alles getan, früh genug, was sie konnte? Wir sind unsicher. Sicherlich erlebt sie die Geister, die sie rief mit ihrer konsequent wirtschaftsorientierten Politik, auch bei Corona und lange vorher. 17:15 Diese Rede als Rückschau auf die eigene Performanz lässt wissentlich Lücken. Das System, was uns soweit in den Schlamassel führte, wird (natürlich) nicht kritisiert. Das "wegmerkeln" von Problemen funktioniert bei Corona katastrophal nicht, man kann das Virus nicht aussitzen. 21:05 Die Wissenschaft zu bemühen, auf die man doch unbedingt hören solle – das stößt bitte auf wegen weil Klimakrise. Corona ist das alles in klein, diese Art von Politik versagt angesichts der unbeugsamen Mathematik des Problems. Aber: Kann man versagen, ohne etwas falsch gemacht zu haben? Was hätte sie besser machen können? 28:10 Oder ist die Bevölkerung schuld? Das glaubt nicht mal Horst Seehofer. Dieses Narrativ als Ausdruck der Angst, zu viel an Maßnahmen durchzusetzen, ist irgendwas zwischen Schutzbehauptung und Angst vor einem neuerlichen Rechtsruck. Und ist letztlich ein halbes Eingeständnis der eigenen Überflüssigkeit. 31:05 Und auf der Grundlage kann man Klimaschutz absagen, denn der muss auch immer wieder gegen einen gewissen Unmut mancher durchgesetzt werden. Wo ist hier eigentlich die Dringlichkeit, die Emphase, das Flehen der Wissenschaft zu glauben? Und was heißen eigentlich "Vernunft" und "Verhältnismäßigkeit" in diesem Kontext? 37:00 Und weiter: was ist eine "konservative" Position angesichts dieser Bedrohungen wert, wenn sie Verantwortung in die Zukunft verschiebt? Was bewahrt sie – außer Privilegien, Wirtschaft und Macht? Wohin will sie, außer zurück zu einem alten Normal? 42:10 Und wir "christlich" ist sie, wenn sie zugunsten der Wirtschaft ihre Armen und Schwachen vergisst? Man argumentiert fast schon antiautoritär und links, die Menschen bloß zu nichts zwingen zu wollen, inkl. magisch-opportunistischem Hoffen, dass es schon nicht so schlimm wird. Die dringend anstehenden Transformationen schafft dieser Politikstil nicht, niemals. Und waren wir hinsichtlich Corona eigentlich "deutsch" im Sinne von erfinderisch, innovativ, clever, effizient? Haha. 45:10 Samira versucht trotzdem noch einmal, eine bessere Rede für Merkel zu entwerfen. Und hat eine Idee für Januar: vielleicht einfach kondulieren. Sich bei den Angehörigen der Toten entschuldigen. Was bleibt sonst von Merkels Kanzlerschaft?Und damit verabschieden wir
Der Weihnachtscountdown läuft Jeden Tag bis zum Fest geht auf meinem Podcastkanal ein Adventskalendertürchen auf. Jeden Tag eine kurze Folge mit einem kompakten Tipp für Kreative, Fleißige und diejenigen, die viel schaffen wollen. Die Folgen erschienen erstmals als Teil meines Projekts „Tägliche Tipps für Kreative“. Sie sollen euch ein bisschen die Zeit bis Weihnachten verkürzen und euch mit neuen Idee aufladen, damit ihr frisch und kreativ ins neue Jahr starten könnt. Mehr über mich findet ihr auf allen Social Media-Plattformen und unter www.denniseighteen.de
Kann man Literatur rauchen? - Theorien der Literatur, Episode 2
Sylvia Sasse studierte Slawistik und Germanistik an der Universität Konstanz und der Universität St. Petersburg. 1999 wurde sie in Konstanz mit einer Arbeit zur Sprachphilosophie des Moskauer Konzeptualismus promoviert, insbesondere der Gruppen Kollektive Aktionen und Medizinische Hermeneutik sowie über die Prosa Vladimir Sorokins. Sie war u.a. in Berlin und Berkeley tätig, habilitierte sich 2005 an der FU Berlin und wurde 2009 auf den Lehrstuhl für Slavistische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich berufen Wir sprechen über Michail Bachtin, von dem Sylvia Sasse diverse Schriften übersetzt und über den sie vielfach publiziert hat. Wir sprechen darüber, wie Bachtin Theorie als Performanz des Schreibens versteht, wie man in Texten mit anderen spricht und über Literatur als künstlerische Erkenntnis, über das "Mitsein", über eine Ethik der Theorie und wie man in Texten mit anderen spricht. Wir sprechen über Sprechgattungen, über Oberiu, über den Denk-Chronotopos, über innere und äußere Reflexivität, über Kollektive Aktionen und über die Frage, ob man Literatur eigentlich rauchen kann. Produktion: Guido Graf, Literaturinstitut Hildesheim 2020.
Piratensender Powerplay, Sonderepisode 5 (TEIL 1): "Männer – eines der besten Geschlechter der Welt
SHOWNOTES: 00:30: Thesen-Thusnelda und Männlichkeitsmann begrüßen sich und euch und alle, ganz egal welch Geschlechts inkl. non-binär. 1:00: Disclaimer, Disclaimer: wir geben unser Bestes und inkludieren blanko alle. 2:00: Speiseplan: Wie männlich oder weiblich fühlen wir beide uns, was für Geschlechterkonstruktionen sprechen zu uns, über welche Mythen der Monogamie und Popkultur wollen wir noch sprechen. SPOILER 1: es gab Unterschriften (juhu....) 7:25: Samira fragt Friedemann, wann er sich das letzte Mal unmännlich gefühlt hat. Friedemann fragt zurück, was eigentlich "männlich" heißt. Samira erzählt, dass sie nicht burschikos genannt werden will und dass ihr das zeigt, dass und warum Geschlecht für sie doch eine wichtige Kategorie ist. 14:40: Jetzt antwortet der Mann doch noch auf die Frage und lobt die Freiheit, als Mann auch "weibliche" Muster oder Eigenschaften leben zu können. Er mag deshalb den Charakter des Jungen, der keine Macht demonstrieren muss, sondern verspielter sein darf. 21:00: Samira erklärt Männlichkeitskonzepte von Trump und Biden und sagt tatsächlich "intellektueller Penis". Warum wird Männern immer noch weniger emotionale Reflexion abverlangt. 23:20: Einschub zu Hillary Clinton, die mit dieser toxischen aggressiven Männlichkeit für viele AmerikanerInnen nicht mütterlich genug umging und auch wegen der Frauen die Wahl verlor. Könnte man Sexismus nennen. 25:40: Männer sind in sesshaften Gesellschaften zum Funktionieren erzogen worden, vor allem auch im Militär, und zur Dominanz. Ein Umdenken und vor allem -fühlen entstand erst nach dem zweiten Weltkrieg, nicht ohne Grund. So dass Friedemann sich doch teilweise gerne als männlich definiert. Vielleicht. 33:05: Wie hingegen haben sich Frauen an das dominante Patriarchat angepasst? Samira erwähnt endlich Judith Butler, Friedemann dazu noch de Beauvoir, puh. Mehr Erklärungen zur weiblichen Angst. Und wie empowern sich Frauen gegenseitig? Samira erzählt vom Female Future Force Day und der Performanz von Solidarität. 41:20: Samira ist anders aufgewachsen und eher irritiert von zu viel Mütterlichkeit. Friedemann auch. 44:40: Friedemann will und kann Männlichkeit in Deutschland nicht ohne den Nationalsozialismus denken, der Männlichkeit extremisiert und auch ästhetisiert hat. Damit sind wir wieder bei der deutschen Deep Story und die Pflicht der Männer zu dienen. Es folgt eine Lektüreempfehlung. Männlichkeit hat sich zum Glück seit damals enorm gewandelt, innert nur zweier Generationen. ENDE TEIL 1
Sophie Reyer spricht über "Das Stumme Tal" und "Zwei Königskinder"
In dieser Folge gehen wir mit der Autorin Sophie Reyer „Auf Buchfühlung“ und freuen uns sehr, mit ihr über zwei ihrer in diesem Frühling erschienen Bücher sprechen zu dürfen. Sophie ist in Wien geboren und hat sich an der Universität für angewandte Kunst mit einer Arbeit über Performanz und Biomacht promoviert. Sie studierte aber auch Komposition sowie szenisches Schreiben und Drehbuch und Filmregie. Ihre Tätigkeit als Autorin umfasst ganz unterschiedliche Felder, von Film und Hörspiel über Lyrik und Prosa bis hin zu Theater und visueller Poesie. Daneben unterrichtet Sophie an der Pädagogischen Hochschule Hollabrunn, gibt Schreibworkshops und war Lehrgangsleiterin der Wiener Schreibpädagogik. Ihr historischer Kriminalroman „Das Stumme Tal“ basiert auf einer wahren Begebenheit, einem verheerenden Brand, der 1889 im Tiroler Zillertal wütete und einen Bergbauernhof in Stumm beinahe ganz zerstört hat. Die dreijährige Amelia ist die einzige Überlebende und Zeugin, die schließlich sogar vor Gericht aussagen muss, wo geklärt werden soll, ob ihre Familie nicht den Flammen, sondern einem grauenhaften Raubüberfall zum Opfer fiel. Sind die Täter tatsächlich die zwei jungen Männer, die vagabundierend durch das Tal zogen? Oder verbirgt sich hinter dem Verbrechen ein viel dunkleres Geheimnis? Der zweite Roman von Sophie Reyer, der vor Kurzem erschienen ist, trägt den Titel Zwei Königskinder und ist so ganz anders als Das stumme Tal. In diesem Coming-of-Age-Roman geht es um Käthe, zu Beginn der Handlung ist sie 13 Jahre alt, und ihre Freundin Johanna. Zwischen den beiden Mädchen, die sich im Chor kennenlernen, bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Während Käthe sich immer mehr den Gefühlen für Johanna hingibt, steigert Johanna sich aber in einen religiösen Wahn hinein. Sind die Gefühlswirren der Pubertät ohnehin schon schwierig, werden sie zunehmend komplizierter, wenn sich nicht nur die Eltern gegen die sich anbahnende Liebe stellen, sondern Gott. Kein Wunder, dass es im Lauf der Handlung zu Verzweiflungstaten kommt und dass das Wasser zwischen den zwei Königskindern – ganz wie im Lied, das dem Titel zugrunde liegt und sich auch leitmotivisch durch das Buch zieht – zu tief war, als dass sie zueinanderkommen könnten.
Wenn wir Videospiele als Medium in den Dialog mit anderen Kunstformen treten lassen, sprechen wir meistens über Filme. Mit dem Adjektiv „cinematisch“ schmücken sich die Prestigetitel der Industrie gerne. Aber warum eigentlich? Liegt der Vergleich mit dem Theater nicht viel näher? Schließlich geht es in Spielen nicht selten darum, eine Rolle einzunehmen. Performanz als Konstante […]
CLS 47: Ist die SEO-Performanz von Links hochwertiger Publisher wirklich besser?
Wirken Links von spiegel.de besser als von pusemuckel.xy? Die große Frage beim Linkbuilding ist ja immer: Soll ich mir die Mühe machen und Links eher von sehr hochwertigen Publishern aufbauen oder aber lieber mehr Links als Hintergrundrauschen? The True Value of Top Publisher Links von Kristin Tynski
Wenn ich nicht so gut performe wie es meinen Fähigkeiten eigentlich entspricht. Mehr dazu findet ihr beim Linguisten N. Chomsky. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/dennis-eighteen/message
In diesem Advent präsentiere ich euch einen kleinen philosophischen Adventskalender. Jeden Tag stelle ich einen philosophischen Begriff vor und mache mir ein paar Gedanken dazu. Heute geht es um Performanz.
#119 - Sonderfolge: Ist jetzt eigentlich alles AI?
IT Manager Podcast (DE, german) - IT-Begriffe einfach und verständlich erklärt
I: Herzlich willkommen zum IT-Manager-Podcast. Heute geht es um das Thema „Ist jetzt eigentlich alles AI? Zwischen Hype, starker und schwacher AI“, und ich habe dazu als Gast Herrn Ulrich Kerzel von der IUBH Fernstudium im Interview. Herr Kerzel verantwortet die Professur für Data Science And Artificial Intelligence. Hallo Herr Kerzel, schön, dass Sie da sind. B: Guten Morgen, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. I: Lassen Sie die Hörer doch noch ein bisschen mehr über Ihre Person wissen. B: Ja, ursprünglich bin ich von Hause aus Physiker und komme eigentlich aus der Teilchenphysik und war auch sehr lange an internationalen Großforschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Fermilab in der Nähe von Chicago und dem CERN bei Genf in der Schweiz. Ich sage mal, in meiner Diplomarbeit beschäftigte ich mich damit, aus Daten Erkenntnisse zu gewinne und dies mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das mache ich jetzt seit knapp zwanzig Jahren, und damals gab es noch keine so großen Pakete wie man sie heute kennt, wie TensorFlow von Google oder PyTorch von Facebook. Damals mussten wir das alles selber programmieren, und auch Grafikkarten gab es im Wesentlichen eigentlich so nicht, sodass wir auf ganz anderen Voraussetzungen aufsetzten. Und dann nach vielen Jahren der Wissenschaft bin ich in die Wirtschaft gewechselt zu Blue Yonder, die heute ein Teil von JDA ist. Und Schwerpunkt meiner Arbeit war zum einen die Leitung des Teams zur Weiterentwicklung von Machine-Learning-Algorithmen, und so hat man die Betreuung von Kundenprojekten, zum Beispiel der Automatisierung von Warenwirtschaft im Handel mit künstlicher Intelligenz. Und jetzt seit Herbst 2018 bin ich als Professor für Data Science und künstliche Intelligenz bei der IUBH. I: Ja, super, das Wort „künstliche Intelligenz“ hätte es mir auch deutlicher vereinfacht, das natürlich auszusprechen anstatt den englischen Begriff „AI“ dazu. Und in dieser Folge haben wir uns ja genau diesem Thema AI, der künstlichen Intelligenz, angenommen, da man gefühlt mittlerweile ja überall damit auch konfrontiert wird. Und daher auch die Frage ja zu unserer heutigen Folge: Ist jetzt eigentlich alles AI? Zwischen Hype, starker und schwacher AI. Ich bin gespannt auf Ihren Input dazu. B: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, man sollte ein bisschen mal jenseits des Hypes schauen. Überall hört man ja von AI hier und künstlicher Intelligenz da, und auf der anderen Seite sieht man auch sehr spektakuläre Erfolge, die auch die Performanz von Menschen mindestens gleichziehen oder auch übertreffen. Da haben wir dann zum Beispiel vor einiger Zeit ein AlphaGo, bei dem eine Maschine auch den besten Go-Spieler geschlagen hat, und das war damals auch relativ überraschend, da Go sehr viel komplexer als Schach ist, wo man eigentlich damals nicht damit gerechnet hat, dass jetzt schon irgendwie menschliche Mitspieler von einer Maschine geschlagen werden können. Man hat schon gedacht, dass das irgendwann passiert, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt schon. Und man hat auch festgestellt, dass in diesem Spiel die Maschine Spielzüge entwickelt hat, die traditionell Menschen so nicht gespielt haben. Und das Spiel gibt es ja schon seit mehreren Tausend Jahren. Und es gibt auch viele weitere große Erfolge von AI, zum Beispiel bei der Erkennung von Hautkrebs, wo die Leistung von dem System die Leistung von menschlichen Spitzendermatologen übertreffen. Auf der anderen Seite hört man jetzt aber auch so auf den Artificial Intelligence, AI, künstliche Intelligenz, dass sich ja schon irgendwo auch der Eindruck aufdrängt, dass das jetzt alles nur ein Hype ist. Es gibt sogar eine aktuelle Studie von den MMC Ventures, die haben sich ungefähr dreitausend AI-Start-ups in 13 europäischen Ländern mal genauer angeschaut, und die sind zu dem Schluss gekommen, dass vierzig Prozent gar keine AI da drinnen haben. Und dann ist natürlich die Frage: Was heißt das jetzt eigentlich alles? Und dann wird es schon ein bisschen schwammiger, weil wir eigentlich nicht so genau definiert haben, was AI eigentlich ist. I: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie kann man denn dieses besser definieren? B: Ja, wenn wir uns den Begriff der künstlichen Intelligenz einmal nähern wollen, ist das gar nicht so einfach zu sehen, was damit gemeint ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns selber schwer tun, den Begriff „Intelligenz“ zu definieren. Wir haben zwar eigentlich ein ganz gutes intuitives Verständnis davon, was intelligentes Verhalten ist oder was Intelligenz ist, aber bei der formellen Definition wird das dann schon schwieriger. Ich meine, wir können mal in den Duden schauen, und da steht drin, „Intelligenz ist die Fähigkeit des Menschen, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten“. Das klingt jetzt alles ganz gut, aber so richtig konkret, was das heißen soll, daraus wird man nicht so ganz schlau. Aber man kann eines festhalten aus dieser Definition „zweckvolles Handeln abzuleiten“, das ist schon einmal ein sehr großes Merkmal. Und das heißt aber auch, dass dieses sinnvolle oder zweckvolle Handeln auf eine konkrete Situation bezogen ist. Wenn man sich jetzt den Bereich der künstlichen Intelligenz anschaut, dann unterscheidet man zwischen starker und schwacher oder anders allgemeiner oder spezifischer Intelligenz, das sind jeweils zwei synonyme Begriffe. Unter der starken oder allgemeinen künstlichen Intelligenz versteht man Systeme, die ganz allgemein selbst denken, also hier wäre das Ziel, ein System zu entwickeln, das quasi wie ein künstliches Wesen in der Umwelt zurechtkäme und leben könnte im Sinne, dass es mit uns interagieren könnte. Es könnte zum Beispiel sich mit uns unterhalten oder sich verhalten wie mein Mensch das tun würde. Man sollte jetzt aber nicht in die Falle tappen zu sagen, „Das müsste dann sich verhalten wie Mensch“, denn warum sollte sich eine künstliche Intelligenz a priori so verhalten wie wir Menschen? Auf der anderen Seite steht dann die schwache oder spezifische Intelligenz. Das sind Systeme, die in einem ganz konkreten Bereich ähnlich gut wie ein Mensch Entscheidungen treffen oder auch besser als ein Mensch Entscheidungen treffen. Und das ist zum Beispiel das, was wir bei dem Spiel Go oder bei Erkennung von Hautkrebs oder anderen Systemen gesehen haben. Und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zur Definition der Intelligenz, und da sind wir wieder bei der Ableitung von zweckvollem Handeln. Und dann ist auch hier eigentlich genau die Grenze zum Hype. In der Definition steht ja nichts von spezifischen Algorithmen oder Machine Learning, und vom Gefühl her denken wir heutzutage immer bei künstlicher Intelligenz daraus an große Machine Cluster, wie sie vielleicht bei Google oder bei Amazon stehen mit ganz großen Machine-Learning-Systemen, und wir denken zum Beispiel nicht an mathematische Optimierung wie Operations Research, das es ja auch schon seit langer Zeit sehr erfolgreich gibt. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich auch aus einer ganz einfachen linearen Regression ein natürliches oder zweckmäßiges Handeln ableiten. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt unter dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ zusammenfassen würden. Und diese Schwammigkeit der Definition des Begriffs „Intelligenz“, die erlaubt es dann halt ganz Vielen, da diesen Deckmantel zu packen. Und dann muss man in der Tat schon sehr genau schauen, was denn damit gemeint ist. Da hilft es, den Begriff im Hype etwas aufzublähen, weil gar nicht so genau festgelegt ist, was jetzt Intelligenz ist. Aber eines ist sicher: Die Systeme entwickeln sich rasant weiter und auch jenseits eines Hypes werden fast täglich neue Erfolge errungen, die sich erst durch die große Kombination aus riesigen Datenmengen und Machine Learning möglich wären. Hier stehen wir eigentlich erst am Anfang der ganzen Entwicklung. I: Das kann ich durchaus nachvollziehen, und in vielen Bereichen sollte man tatsächlich jetzt mehr hinterfragen, wenn jemand sagt, sie beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz oder haben Komponenten von künstlicher Intelligenz in ihre Systeme eingebaut, dass man tatsächlich mal hinterfragt, was bedeutet es denn konkret, und damit natürlich dann auch ein bisschen besseren Hintergrund darüber bekommt. Gibt es denn spezielle Tipps, ja, für unsere Zuhörer, was diese Dinge angeht, was sie dann in Zukunft besser machen sollten? B: (lachend) Ich glaube, wenn man jetzt bewertet, was andere Firmen oder Forscher tun mit künstlicher Intelligenz, lohnt es sich, eine gesunde Skepsis mitzubringen und einfach mal zu hinterfragen, was denn eigentlich genau gemacht wird. Wenn die nur schreiben, „Hier wird künstliche Intelligenz verwendet“, kann man durchaus mal nachfragen, „Und was heißt das jetzt? Und wo wird sie verwendet, und was soll diese AI jetzt tun? Oder was macht sie anders als man das beispielsweise mit einer mathematischen Optimierung machen würde?“ Abgesehen davon gibt es natürlich auch sehr grundlegende Forschungsarbeiten zur allgemeinen künstlichen Intelligenz. Ob und wann das passieren wird, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht absehen. Das heißt was wir in der Praxis sehen, ist die schwache oder spezifische künstliche Intelligenz, und da kann man auch genau fragen, wo denn diese Intelligenz stecken soll. I: Ja. Und haben Sie eine konkrete Empfehlung, wenn sich unsere Zuhörer ja deutlich detaillierter mit diesem Thema AI, also auch künstliche Intelligenz, im Prinzip beschäftigen wollen und da tiefer einsteigen wollen, weil sie das für ihre zukünftige Arbeit auch verwenden wollen? Was können die da am sinnvollsten machen? B: Also, wer da richtig tief einsteigen möchte, dem würde ich empfehlen, unsere Kurse im Fernstudium ab nächstem Frühjahr, ab nächstem Februar zu besuchen, da bieten wir auf Bachelor- und auf Master-Niveau jeweils Studiengänge in Data Science und Artificial Intelligence an. Das sind eigentlich ideale Weiterbildungsmaßnahmen, die jeder ergreifen kann, um sich tief in die Systeme einzuarbeiten, auch in dieses Feld einzusteigen. I: Und die gibt es dann im Bachelor- und Master-Niveau? Oder in welchen Bereichen gibt es die? B: Genau. Die fangen im Bachelor Data Science an, das ist die Grundlage für die späteren Master-Studiengänge. Im Bachelor bieten wir Data Science an als Grundlage für die beiden weiteren, und im Master kommen dann spezialisiert Master Data Science und Master Artificial Intelligence, je nachdem, in welche Richtung man jetzt gehen möchte. I: Super. Falls das für Sie als Zuhörer interessant sein sollte: Wir werden natürlich die Links zu diesen Studiengängen in die Shownotes mit einbringen, dann haben Sie es ein bisschen einfacher, da direkt drauf zuzugreifen. Was mich und auch sicherlich die Zuhörer noch interessieren würde: Haben Sie gute Buchempfehlungen zum Thema AI? B: Ja, da ändert sich natürlich gerade alles rasant, also fast jedes Buch, was man so sagen möchte, was jetzt rauskommt, hat ja mindestens zwei Jahre Vorlaufzeit und ist schon quasi gar nicht mehr dem aktuellen Markt hinterher. Ich glaube aber, was man empfehlen könnte, ist der Klassiker, sage ich mal, von Stuart Russell und Peter Norvig, der heißt Artificial Intelligence, A Modern Approach. Das ist ein Lehrbuch, das in sehr vielen Universitätsstudiengängen eingesetzt wird, und gibt einen großen Überblick über die Hintergründe von Artificial Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Und ein anderes Buch, was eher nicht technisch ist, das finde ich auch sehr lesenswert, das ist von Sarah Wachter-Boettcher, das heißt Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threads of Toxic Tech. Das beschäftigt sich eigentlich sehr allgemeinpopulärwissenschaftlich mit der Frage, welchen Einfluss AI eigentlich auf unser Leben hat, und insbesondere dadurch, wie Algorithmen einen Bias entwickeln können, da es ja aus den Daten lernt, die wir einem solchen Algorithmus, einer solchen künstlichen Intelligenz geben und welchen Einfluss das auf unser Leben hat. Das ist eigentlich ganz spannend zu lesen, wie man abseits von rein technischen Fragestellungen dann sieht, welche Konsequenzen sich eigentlich daraus ergeben auf unser Leben. I: Da bin ich ja schon gespannt, welches der Bücher ich dann in meine Buchliste mit aufnehmen werde, vermutlich eher die nicht so technische Variante (lachend) für mich, aber ich glaube, es gibt genug Hörer, die tatsächlich dort auch so einen Deep Dive tatsächlich machen möchten, und je nachdem, ob Studiengang oder nicht, tatsächlich mal tiefer in das ganze Thema AI auch eintauchen wollen. Auch diese Buchempfehlung werden wir mit in die Shownotes mit reinnehmen. Und ich hatte mit Herrn Kerzel im Vorfeld gesprochen, auch die Kontaktdaten von ihm, seine E-Mail-Adresse, nehmen wir mit auf, sodass Sie natürlich jederzeit in der Lage sind, auch wenn Rückfragen hier gerade zu diesem Thema und den Studiengängen ist, gerne an ihn diese Rückfragen zu richten. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Kerzel, für dieses tolle Interview. B: Ja, herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein. I: Und an Sie, liebe Zuhörer, ja, vielen Dank fürs Zuhören natürlich, und schalten Sie gerne wieder ein, wir freuen uns wieder auf Sie am nächsten Freitag, wenn unsere Episode wieder online geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Ingo Lücker, tschüss! Kontakt: Ulrich Kerzel, u.kerzel@iubh-fernstudium.de Kontakt: Ingo Lücker, ingo.luecker@itleague.de
Softwarequalität in Webapplikationen
Verena spricht in dieser Folge (remote) mit Buch-Autor Sebastian Springer und besprechen die Fortschritte in der Entwicklung von Webapplikationen. Auch wie schnell in diesem Bereich Wissen veraltet sein kann. Wie kann man mit JavaScript sauber Webapplikationen entwickeln und hat weniger Schmerzen bei der Wartung? In diesem Podcast eine Premiere für die Aufnahme eines Interviewpartners über eine Internetleitung. Persönlich finden wir jedoch besser :).
In dieser ersten Folge des Podcasts führt uns der Politologe Alexander Kubis in die vergleichende Demokratieforschung ein. Die demokratischen Systeme in den verschiedenen Ländern weisen teilweise erhebliche Unterschiede auf. Daher stellt sich die Frage nach einer Methode für den Vergleich und die Bewertung der Systeme. Grundlegend ist hierbei die Unterscheidung von Konsens- und Mehrheitsdemokratien sowie von repräsentativen und direkten Demokratieformen. Dabei handelt es sich hierbei nicht um exakte Einteilungen, vielmehr existieren viele Mischformen zwischen den ExtremeIn seiner Arbeit hat Alexander Kubis sich insbesondere auf die Performanz der politischen Systeme als Vergleichskriterium konzentriert. Die Perfomanz beschreibt die "Leistungsfähigkeit" eines demokratischen Systems, diese kann grob unterteilt werden in die wirtschaftliche Effizienz und die Partizipation, also die gelebte Teilhabe an der Demokratie. Hier stellt sich nun die Frage, wie sich die unterschiedlichen Leistungswerte sich auf das Wechselspiel zwischen Bevölkerung und politischem System auswirken - dies hat Alexander anhand verschiedener Fallstudien genauer untersucht.
[podcast src="https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/5654821/height/90/width/960/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/forward/render-playlist/no/custom-color/00d3ff/" height="90" width="960"] Um es gleich vorwegzunehmen: Mit „gut“ meinen wir immer qualitativ hochwertig, nachhaltig und wirtschaftlich zielführend. Innovation als solches bildet nämlich noch kein Potential, vielmehr ist Innovation das Werkzeug, das uns hilft, Potential zu erzeugen. Und das will gelernt – und vor allem: richtig umgesetzt sein. Doch nun zur Sache: Seit Jahren gehört Innovation zu den wichtigsten Debattenthemen in der politischen und akademischen Sphäre. Man ist sich darüber einig, dass der Hauptfaktor wirtschaftlicher (und gesellschaftlicher) Gesundheit gute Bildungssysteme und vitale, freie Forschungslandschaften sind, weil allein sie zu nachhaltiger Innovation führen können. EU-Sozialismus Mit Beginn des 21. Jahrhunderts startete die Europäische Union eine vollmundig angekündigte Innovationsinitiative, die sämtliche in der EU organisierten Länder erfassen sollte. Damit machten die Eurokraten Innovation zu einem, wenn nicht dem Hauptanliegen ihrer Wirtschaftspolitik. Die EU hat deshalb ihre Mitglieder dazu verpflichtet, in den ersten beiden Jahrzehnten des neuen Jahrtausends jeweils mindestens 3% ihres BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Dieses Ziel wurde allerdings aus den verschiedensten Gründen von kaum einem Mitgliedsland erreicht. Eigentlich lag es in der Absicht der EU Kommission, das Staatenbündnis bis zum Jahr 2020 in den dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu verwandeln. Über Innovation sowie Forschung und Entwicklung kann man viel zu lesen kriegen. Tausende für teures Geld durchgeführte, hochakademische Studien sehen in der Innovation den Treiber für nachhaltiges Wachstum, das im Gefolge zu mehr allgemeinem Wohlstand führt. Gemeint wäre damit eigentlich kein subventionsfinanziertes Strohfeuer, sondern die Errichtung eines höheren Wachstumssockels, aus dem heraus auch und vor allem qualitatives Wachstum generiert werden kann. Obwohl die gesetzten Ziele regelmäßig weit verfehlt werden, wird das Innovationsprojekt der europäischen Wirtschaft mit absoluter Priorität verfolgt, und zwar, weil nur technischer Fortschritt Volkswirtschaften dazu befähigt, die in ihr vorhandenen Potentiale in Performanz zu übersetzen. Bei vielen wirtschaftspolitischen Entscheidungen geht es deshalb um das Verhältnis von Innovation und deren ökonomischen, möglichst multiplikativen Effekten. Diese machen aber nur dann wirklich Sinn, wenn sie das Merkmal der Nachhaltigkeit aufweisen. Alles andere wäre verbranntes Geld, verschwendete Zeit, sinnlos vergeudetes Potential. Was ist echter Fortschritt? Der Bestand an Bildung und kreativer Intelligenz, der innerhalb einer Volkswirtschaft als Potential existiert, bildet die Basis für die Realisierung von echtem Fortschritt im Sinne nachhaltiger Effekte. Wie aber will man diesen Bestand an Bildung und kreativer Intelligenz messen? Eigentlich müsste sich ja die Vorgabe „3 %!“ an einer wie auch immer möglichen Quantifizierung dieser Faktoren orientieren. So einfach geht es aber nicht. Bestimmt war die 3%-Klausel gut gemeint. Abgesehen vom Problem der Mess- und Umsetzbarkeit gilt aber auch hier: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das Großartige – und auch das besonders problematische und komplexe – ist nämlich die kulturelle und ethnische Inhomogenität der vielen europäischen Länder, die beim in alter Sozialistenmanier durchgeführten Gießkannengießen wieder und wieder vernachlässigt wird. Kultur findet im Kleinen statt, dort, wo Menschen miteinander kommunizieren, VeSupport the show (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2PU5W9H752VZJ&source=url)
Hinter den Kulissen: Die Einbindung der Mitarbeiter
Digitale Markenführung bedeutet viel mehr als nur die Darstellung der Marke zu Zwecken der Verkaufswerbung. Vielmehr muss sie das Unternehmen in seiner Gesamtheit erfassen. In unseren vom Mangel an Fachkräften geprägten Zeiten müssen Marken darüber hinaus auch in besonderem Maße auf ihre Reputation im Arbeitsmarkt achten und sich als attraktive Arbeitgeber positionieren. Die Transparenz des Internet, innerhalb dessen Marken sich den unterschiedlichsten Interessengruppen präsentieren, zwingt Unternehmen, auch beim Personalmanagement und Recruiting neue Wege zu gehen. Ohne digitale Markenführung sind die notwendigen Erneuerungen nicht umsetzbar. Gute Marken entstehen durch Teamgeist Alles, was von außen betrachtet leicht, perfekt und wie gespielt erscheint, erfordert den akribischsten Fleiß, die umfangreichste Vorbereitung und oftmals jahrelange Übung. So ist es bei allen Projekten, die einen Team- bzw. Mannschaftsgeist erfordern, ohne den das zielgerichtete Agieren einer Gruppe nicht möglich wäre, ob im Sport, in der Kunst oder in einem Unternehmen. Wer je eine Aufführung des Bolschoi-Balletts gesehen, eine vom Berliner Philharmonischen Orchester gespielten Sinfonie gehört oder einem Spiel der besten Basketball- oder Fußballteams beigewohnt hat, weiß, wovon die Rede ist: Performanz, die nur deshalb so perfekt wirkt, weil sie ganz leicht, wie gespielt daherkommt: Eingespielte Professionalität. Dabei darf die Gleichrichtung der einzelnen Elemente auf keinen Fall mit deren Gleichschaltung verwechselt werden. Die besten Teams ziehen ihre Stärke aus den besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften ihrer Mitspieler, die nicht ohne weiteres gegen andere auszutauschen sind. Je größer der personelle Austausch, umso langwieriger und mühsamer das erneute Einspielen des Ganzen. Wer an die besten Ensembles denkt, ihren Namen hört das Vereinswappen oder Signet erblickt, weiß sofort, dass es sich um die besten Marken ihrer Branche handelt. Sofort werden Assoziationen an Zuverlässigkeit und Professionalität geweckt, an eine besondere Qualität. Menschen machen Marken Wir wissen ja, dass aus einem guten Markenkonstrukt, einer Marke mit starker Sogwirkung, all das heraus strahlt, was sie zu dem macht, was sie ist: Von der Idee bis zum Endprodukt und dessen Vermarktung. Hinter allem steht ein Team: Das Personal der Marke. Der Begriff der Marke wird in unserem Kontext synonym für Unternehmen verwendet. Da alles auf Menschen zurückgeht, für Menschen erdacht und gemacht ist und von Menschen angeboten und nachgefragt wird, ist der Fokus der Marke in besonderem Maße auf das Personal und die Personalgestaltung zu richten. Der Begriff der Personalgestaltung bezieht sich aber nicht nur auf die Seite des Arbeitgebers, sondern auch auf jene des Mitarbeiters. Es müssen Methoden gefunden werden, mit denen Personal so auf die Marke eingestimmt und eingestellt werden kann, dass sich die Mitarbeiter mit der Marke identifizieren. Dies geschieht nicht nur über die Marke selbst, sondern in viel stärkerem Maße über die Selbstidentifikation der in ein Unternehmen bzw. eine Marke involvierten Menschen als Individuen und Persönlichkeiten. Wie? Es konnte gezeigt werden, dass der sog. „Capability Approach“ ein tragfähiger Ansatz ist, wenn es um die psychologisch „korrekte“ Einbindung von Mitarbeitern in eine Marke geht. Dieser Zugang führt zu den Fähigkeiten von Menschen als wichtigste und wertvollste Ressource von Unternehmen. Er wird den Menschen dort gerecht, wo es um ihre Individualität und ihre Freiheit geht. Die Fähigkeitsprofile von Menschen sind aufgrund individueller Prägungen, Erfahrungen, Wünsche und Träume naturgemäß verschieden. Das heißt, dass in dem Fähigkeiten-Paradigma immer auch die individuSupport the show (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2PU5W9H752VZJ&source=url)
Die Touch Bar wird mit zucker glasiert, so zumindest versucht Andreas seinem Copiloten die Neuerungen schmackhaft zu machen, aber auch andere Folklore ist Thema dieser spannenden Episode auf 8000 Fuß. Lieber Fluggast, wenn dir das Gehörte gefällt oder dir Sorgenfalten auf die edle Stirn fabriziert, dann haben wir etwas für dich: iTunes Bewertungen. Follow-up SuperTuxKart Arcade Trail Google Open Source Cheap Ikea Smart Lights incoming : Hue Dyslexie font Linksammlung: Twitch & YouTube - Landesmedienanstalten fordern Sendelizenzen ZEIT ONLINE: Livestreaming: Gamer? Ihr seid jetzt Rundfunker! YouTube: Let’s Play – ZAK verlangt Rundfunklizenz für „PietSmietTV“ YouTube: Rundfunklizenz Tutorial vom Herrn Solmecke YouTube: Zensur Schreiben der Landesmedien Anstalt - YouTube Sendelizenz YouTube: Der feine Dr. T. Schmid von der Landesmedienanstalt - HateSpeech Zensur Denunzieren ??? Update zu PietSmiet! - Wer braucht eine Rundfunklizenz? - Statements der Landesmedienanstalten NRW Neues ZetttBook Nexstand DA2000 Cable Matters Adapter Gut Meh Laden von beiden Seiten Adapter Touch Bar - Touch ID - Apples eigenes Workflow Der Übercast - Flug #UC031: iOS Robotik Apple Acquires Popular Automation App Workflow - Mac Rumors Wo fällt Workflow auf die Nase und was funktioniert nicht so gut an Workflow? Wo hofft man, dass die Übernahme erhebliche Verbesserungen bringt? Diese und viele weitere Fragen umtreiben nicht nur Pandreas und Aatrick. Mutmaßlich wird die Integration mit allem was nicht von Apple kommt schwerer oder abgesägter, beispielsweise Kalenderdaten sind nur aus dem iOS Kalender verfügbar. Derweil freut sich F. Viticci noch wie ein wildes Wienerschnitzel über die Performanz: 2200 samples as input, a repeat loop reformats each sample with date and value, appends to text file— Federico Viticci (@viticci) March 30, 2017 Guru der Macautomatisierungsjünger, Sal, musste Oktober 2016 von Apple aus gegangen werden. Sal hat seither einen Artikel bei MacStories geschrieben. Da fragt man sich unweigerlich “Was kann jetzt nach der Übernahme mit Workflow passieren?” Die Hoffnung stirbt zuletzt, Andreas stößt und betet, dass Workflow tiefer ins System integriert werden könnte als die Schnittstelle, mit der Power User “mehr” aus ihrem Gerät heraus holen können. Etwa Links mit Chrome öffnen. Derweil streicht Patrick sanft über seinen kugelrunden Bauch, denn auch er gibt sich Hoffnungsschwanger. In Italien publiziert man “Die Zukunft von Workflow” auf MacStories und malt mehrere Szenarien aus. Abschließend werden noch die eigens erstellten Workflow-Innovation von Herr Weitler und Zelker besprochen. Unsere Picks Patrick: BeardedSpice How To Stop iTunes From Interfering With The Mac Media Keys Andreas: CheapCharts In Spenderlaune? Wir haben Flattr und PayPal am Start und würden uns freuen.
Worte erschaffen Wirklichkeiten. Kundige Redner wissen um diese Macht der Worte – und sie setzen sie ein, um Wirklichkeiten zu erzeugen. Die Gegenwart zeigt, dass ein einmal in die Welt gesetztes Gerücht sich unaufhaltsam wie der Rauch eines Lauffeuers verbreitet – im Guten wie im Schlechten. Wenn das Gute Wirklichkeit werden soll, müssen sich die […]
Programmiersprachen: Was können sie und wann nutze ich sie? | Black Box: Tech #4
digital kompakt | Business & Digitalisierung von Startup bis Corporate
Programmiersprachen sind in der IT ein nahezu popkulturelles Phänomen. Doch wie genau funktionieren sie eigentlich und wofür eignet sich welche von ihnen? In der 4. Folge seines Technologiepodcasts spricht Joel Kaczmarek daher mit Johannes Schaback über Programmiersprachen und ihre Funktionsweise, wobei beide auch einige der bekanntesten Programmiersprachen einordnen. Du erfährst... 1) …was eine Programmiersprache ist 2) …ob Programmierer einer Sprache automatisch auch andere sprechen 3) …wie Programmiersprachen-Bibliotheken funktionieren 4) …woran man eine gute Programmiersprache erkennt und welche wofür taugt
Jeden verdammten Donnerstag: Gossip, Rants und Lebenshilfe. Aus Köln. Mit Christian und Jens (Imperium für Dummies). Nach einem kurzen Tinder Talk unterhalten sich Christian und Jens über die Themen Comedy, Improvisation, Performanz, Leidenschaft, zur eigenen Meinung zu stehen und den normativen Einfluss von Gruppen. Christian erklärt außerdem seine Therapie für erfolgreich beendet. Show us some love: Unterstützt den Podcast bei Patreon, folgt ihm auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden!
Sofort bessere Performanz für Deine Markenführung
Starke Marken erzählen eine Geschichte und ziehen ihre Kunden mit dieser in ihren Bann. Doch das ist noch nicht alles: In Zeiten von Internet, Tablet und Smartphones generieren Marken Erlebnisse und nehmen die Kunden so auf eine Reise in die individuelle Welt der Marke mit. Neue Technologien und digitale Medien wie digitale Schauräume, digitale Schaufenster und interaktive Angebote lassen einen regelrechten digitalen Markenkosmos entstehen. Diese Digital Brand Environments sind die digitalen Lebensräume von Marken und werden von diesen erdacht und geprägt. Das und nicht weniger erwarten sich die Kunden heutzutage von einer Marke. Aus diesem Grund ist professionelle digitale Markenführung ein Muss, wenn eine Marke auch in Zukunft bestehen möchte. Dabei ist jedoch stets auf die Besonderheiten der digitalen Medien zu achten. Diese sind als Big Four bekannt und tragen dazu bei, ein nachhaltiges Markenimage zu entwickeln und den Bekanntheitsgrad der Marke bei der Zielgruppe sowie auch darüber hinaus zu steigern. Im folgenden Artikel erfahren Sie alles über die Big Four der digitalen Markenführung und wie Sie diese für die Stärkung Ihrer Marke nutzen können.MARKENREBELL.FMSupport the show (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2PU5W9H752VZJ&source=url)
Cordula ist eine Buchautorin, transpersonale Lehrerin und eine langjährige Freundin. In dieser Episode von Lateral Conversations beginnen wir mit einer neuen Reihe oder Serie, nämlich der 'Performanz der Liebe', in dem wir über die Probleme, Krisen und Möglichkeiten sprechen, die mit der Liebe in unseren - ja man will fast sagen: post-postmodernen - Zeiten einhergehen. Einiges haben wir in dieser Episode besprochen, vieles blieb noch für zukünftige Episoden unerwähnt. Wenn ihr Fragen & Anregungen habt, so habt ihr unten die Möglichkeit, diese zu posten; wir können diese in den nächsten Episoden dann aufgreifen.Hier findet ihr Cordula Website
Quantenklassische Hybridbeschreibung von Solvatisierungseffekten
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/05
Eine aussagekräftige theoretische Beschreibung des Infrarot (IR)-Schwingungsspektrums eines Biomoleküls in seiner nativen Umgebung durch Molekulardynamik (MD)-Simulationen benötigt hinreichend genaue Modelle sowohl für das Biomolekül, als auch für das umgebende Lösungsmittel. Die quantenmechanische Dichtefunktionaltheorie (DFT) stellt solche genauen Modelle zur Verfügung, zieht aber hohen Rechenaufwand nach sich. Daher ist dieser Ansatz nicht zur Simulation der MD ausgedehnter Biomolekül-Lösungsmittel-Komplexe einsetzbar. Solche Systeme können effizient mit polarisierbaren molekülmechanischen (PMM) Kraftfeldern behandelt werden, die jedoch nicht die zur Berechnung von IR-Spektren nötige Genauigkeit liefern. Einen Ausweg aus dem skizzierten Dilemma bieten Hybridverfahren, die einen relevanten Teil eines Simulationssystems mit DFT, und die ausgedehnte Lösungsmittelumgebung mit einem (P)MM-Kraftfeld beschreiben. Im Rahmen dieser Arbeit wird, ausgehend von einer DFT/MM-Hybridmethode [Eichinger et al., J. Chem. Phys. 110, 10452-10467 (1999)], ein genaues und hocheffizientes DFT/PMM-Rechenverfahren entwickelt, das der wissenschaftlichen Ọ̈ffentlichkeit nun in Form des auf Großrechnern einsetzbaren Programmpakets IPHIGENIE/CPMD zur Verfügung steht. Die neue DFT/PMM-Methode fußt auf der optimalen Integration des DFT-Fragments in die "schnelle strukturadaptierte Multipolmethode" (SAMM) zur effizienten approximativen Berechnung der Wechselwirkungen zwischen den mit gitterbasierter DFT bzw. mit PMM beschriebenen Subsystemen. Dies erlaubt stabile Hamilton'sche MD-Simulationen sowie die Steigerung der Performanz (d.h. dem Produkt aus Genauigkeit und Recheneffizienz) um mehr als eine Größenordnung. Die eingeführte explizite Modellierung der elektronischen Polarisierbarkeit im PMM-Subsystem durch induzierbare Gauß'sche Dipole ermöglicht die Verwendung wesentlich genauerer PMM-Lösungsmittelmodelle. Ein effizientes Abtastens von Peptidkonformationen mit DFT/ PMM-MD kann mit einer generalisierten Ensemblemethode erfolgen. Durch die Entwicklung eines Gauß'schen polarisierbaren Sechspunktmodells (GP6P) für Wasser und die Parametrisierung der Modellpotentiale für van der Waals-Wechselwirkungen zwischen GP6P-Molekülen und der Amidgruppe (AG) von N-Methyl-Acetamid (NMA) wird ein DFT/PMM-Modell für (Poly-)Peptide und Proteine in wässriger Lösung konstruiert. Das neue GP6P-Modell kann die Eigenschaften von flüssigem Wasser mit guter Qualität beschreiben. Ferner können die mit DFT/PMM-MD berechneten IR-Spektren eines in GP6P gelösten DFT-Modells von NMA die experimentelle Evidenz mit hervorragender Genauigkeit reproduzieren. Somit ist nun ein hocheffizientes und ausgereiftes DFT/PMM-MD-Verfahren zur genauen Berechnung der Konformationslandschaften und IR-Schwingungsspektren von in Wasser gelösten Proteinen verfügbar.
Auswirkungen der Aufgabenschwierigkeit auf altersabhängige Aktivierungsmuster in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter spielt eine zentrale Rolle für die Gesellschaft der Zukunft und bildet das Hauptaugenmerk dieser Studie. Obwohl einige kognitive Funktionen konstant bleiben (z.B. Wortflüssigkeit) bzw. bis ins hohe Alter kontinuierlich ansteigen (z.B. verbales Wissen), nimmt die Mehrzahl der kognitiven Funktionen im Laufe des Erwachsenenalters ab. Von dieser Tendenz am stärksten betroffen sind die Verarbeitungsgeschwindigkeit und das Arbeitsgedächtnis. Diese Veränderungen werden begleitet von strukturellen Alterungsprozesses der grauen und weißen Hirnsubstanz. Sowohl eine Volumenminderung der grauen Substanz als auch eine verminderte Integrität der Faserverbindungen wird mit verringerten kognitiven Leistungen assoziiert. Studien der funktionellen Bildgebung deuten auf unterschiedliche Aktivierungsmuster bei jüngeren und älteren Probanden hin. Überaktivierung, verminderter Inhibierung und Dedifferenzierung führen bei älteren Probanden zu schlechterer Performanz. Auch eine geringere Effizienz und/ oder Kapazität der neuronalen Netzwerke wird berichtet. Allerdings treten auch kompensatorische zusätzliche (De-)Aktivierungen auf, die zum Erhalt oder zur Steigerung der Leistung beitragen. Der Alterungsprozess zeichnet sich aber auch durch große interindividuelle Unterschiede aus. Zur Beschreibung der Ursachen und Wirkmechanismen werden bio- psycho-soziale Modelle herangezogen, zu denen auch die Theorie der Kognitiven Reserve gezählt wird. Die Theorien der Reserve sind aus der Beobachtung entstanden, dass strukturelle Veränderungen des Gehirns, die durch Krankheiten, Verletzungen aber auch durch normale Alterungsprozesse bedingt sind, nicht bei allen Personen zwangsläufig zu Einbußen in der Kognition führen müssen. Die Modelle der Kognitiven Reserve führen aus, dass diese über das Leben hinweg erworben wird und bei Bedarf aktiviert werden kann. Als Operationalisierungen der Kognitiven Reserve wurden meist die Stellvertretervariablen hohe Bildung, hohe prämorbide Intelligenz, Herausforderungen im Beruf und bei Freizeitaktivitäten und gute Einbindung in soziale Netzwerke herangezogen. Einen Teilbereich der Kognitiven Reserve stellt die Neuronale Reserve dar, welche in der effizienteren oder flexibleren Nutzung neuronaler Netzwerke besteht. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Leistung in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe und ihrer funktionellen Aktivierungsmuster und dem Konstrukt der Kognitiven Reserve bei Berücksichtigung des Alters. Hierzu wurden 104 ältere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 60 und 75 Jahren (M = 68,24 Jahre) und 40 jüngere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren (M = 21,15 Jahre) untersucht. Die Studie beinhaltete eine umfassende neuropsychologische Testung am ersten Tag, in der Teilbereiche der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der exekutiven Funktionen erfasst wurden. Zudem wurde die Kognitive Reserve durch eine wiederholte Durchführung des Zahlen-Symbol-Tests und die Ermittlung der Zugewinne (Testing-the-limits-Verfahren) erhoben. Diese dynamische Testungsmethode weicht von den vielfach verwendeten Methoden der Stellvertretervariablen bewusst ab, da das so erhobene Maß der Definition der Kognitiven Reserve als Leistungspotential besser gerecht wird. Am zweiten Tag folgte die Durchführung einer Arbeitsgedächtnisaufgabe (n-back-Aufgabe) mit drei (bei den jüngeren Probanden vier) unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen während mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztherapie die Aktivierungsmuster des Gehirns aufgezeichnet wurden. Ergänzend wurden strukturelle MRT-Aufnahmen erhoben, welche zur Eruierung der Integrität der weißen Hirnsubstanz herangezogen wurden. Wie erwartet nahmen mit höherer Aufgabenschwierigkeit die Genauigkeit in der Arbeitsgedächtnisaufgabe ab und die Reaktionszeiten zu. Im Vergleich zu jüngeren Probanden reagierten ältere Probanden signifikant langsamer, wiesen mehr Fehler auf und wurden stärker von der Aufgabenschwierigkeit beeinflusst. Überraschend war die Tatsache, dass die Bearbeitung der Aufgabe bei Älteren und Jüngeren mit sehr unterschiedlichen kognitiven Funktionen zusammen hing: Alleine die Verarbeitungsgeschwindigkeit nahm in beide Gruppen eine zentrale Rolle ein. Mit steigender Aufgabenschwierigkeit zeigte sich bei beiden Gruppen eine steigende (De-) Aktivierung in den relevanten Bereichen, jedoch wurde bei älteren Probanden vor allem eine schwächere Deaktivierung des Ruhenetzwerks um den Precuneus beobachtet. Zusätzlich wurden Regionen identifiziert, in denen ein Zusammenhang zwischen der (De-)Aktivierung und dem Leistungsabfall zur Bedingung mit der höchsten Aufgabenschwierigkeit bestand. Während bei den Älteren eine geringere frontale Deaktivierung und höhere Deaktivierung im Precuneus mit einem Leistungserhalt einherging, bewirkte bei den Jüngeren eine höhere frontale Deaktivierung den Leistungserhalt. Die Kognitive Reserve wies in beiden Gruppen jeweils nur einen Zusammenhang mit der Leistung der schwierigsten Aufgabenbedingung auf, was einen Nachweis der externen Validität der verwendeten Operationalisierung, als Leistungspotential, welches bei Bedarf herangezogen werden kann, darstellt. Eine höhere Aktivierung im mittleren und inferioren frontalen Cortex korrelierte positiv mit der Kognitiven Reserve und war leistungsförderlich. Es zeigte sich eine Mediation des Zusammenhangs zwischen der Aktivierung und der Leistung durch die Kognitive Reserve. Dies deutet auf die Vermittlerrolle hin, welche durch die Reserve eingenommen wird. Einen Moderationseffekt der Kognitiven Reserve auf den Zusammenhang der strukturellen Integrität der weißen Substanz des gesamten Gehirns und der Leistung in der Arbeitsgedächtnisaufgabe konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse legen zusammengenommen nahe, dass den älteren Probanden hauptsächlich durch gescheiterte Deaktivierung Leistungseinbußen entstanden, dass sie aber in der Lage waren, kompensatorisch weitere Regionen zur Bearbeitung der Aufgabe hinzuzuziehen. Die Kognitive Reserve bildet das Bindeglied zwischen Aktivierung und Leistung und sollte somit in mögliche Modelle mit aufgenommen werden. Insgesamt liefern die Ergebnisse dieser Arbeit einen Beitrag zur Grundlagenforschung im Bereich des kognitiven Alterns und der Kognitiven Reserve. Besonders der Zusammenhang der Kognitiven Reserve mit den fordernden Bedingungen und die Mediation des Zusammenhang zwischen Aktivierung und Leistung zeigen, dass die hier gewählte Operationalisierung ein valides Testinstrument für zukünftige Studien darstellt.
Der Medienkünstler Karl Heinz Jeron war einer der Mitbegründer der "Internationalen Stadt" Berlin, einem Webprojekt von 1994-98 im Spannungsfeld zwischen Netzkunst und freien Bürgernetz. Jeron (*1962 in Memmenigen geboren) hat ursprünglich Malerei studiert und sich später mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Seine künstlerischen Arbeiten sind Experimente mit Robotorn, ein Spiel mit Netzphänomenen und der Performanz von Maschinen in unerwarteten Kontexten.
Der Neigung folgen - Prof. Dr. Michaela Pfadenhauer im Gespräch
Dr. Michaela Pfadenhauer, ordentliche Professorin für "Kultur und Wissen" an der Universität Wien und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, unterhält sich mit Dr. Udo Thiedeke über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten wissensbasierter individueller Aneignungen der sozialen Welt und deren Konsequenzen für posttradionale Gesellung.Shownotes:#00:02:38# Interdisziplinäre Tagung Zweckentfremdung. Zur kulturellen Praxis des ‘unsachgemäßen Gebrauchs‘ Online Die Beiträge der Tagung erscheinen in: Maria Dillschnitter und David Keller (Hrsg.) 2015: Unsachgemäßer Gebrauch. München: Fink#00:02:58# Zu "Cult Media" Online Zur daran anschließenden Tagung "Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien: Intuition, Kreativität, Kompetenz" Karlsruhe 02.-04.11.14 Online.#00:05:13# Neben den frühen Soziologen wie Emile Durkheim, Georg Simmel und in gewisser Weise auch Max Weber, die sich Gedanken über die Beziehung von Individuum und Sozialität machten, wurde die Auseinandersetzungen mit dem Prozess der Individualisierung wesentlich durch Arbeiten von Ulrich Beck in den 1980er Jahren angeregt. Ulrich Beck: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in: Reinhard Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983, S. 35–74#00:08:48# Zur Einführung in die Wissenssoziologie Peter L. Berger, Thomas Luckmann, 1969: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt: Fischer. Dazu: Michaela Pfadenhauer, 2010: Peter L. Berger. Reihe Klassiker der Wissenssoziologie. Konstanz: UVK#00:14:48# Zu den "neuen Amateuren" siehe die Tagung “Die neuen Amateure – zur Konjunktur einer Sozialfigur” (CfP) 05.-06.06.14. TU Berlin. Online Hierzu ist eine Publikation von Boris Traue und Michaela Pfadenhauer in Vorbereitung, die voraussichtlich 2015 bei Suhrkamp erscheinen wird.#00:15:08# Das utilitaristische Handlungsmodell (nach lat: utilitas der Nutzen, der Vorteil) besagt im Wesentlichen, das vernunftgemäß handelnde Akteure ihre Handlungen als rationale Mittel ansehen, um Zwecke zu erreichen, die ihren egoistischen Interessen entsprechen. Frühe Ansätze dieses Denkens finden sich bei Thomas Hobbes in ausgearbeiteter Form bei Jeremy Bentham. Siehe zum Utilitarismus Online#00:17:29# Zur Definition von Podcasting und Podcast siehe Online#00:26:07# Zu den "Global microstructures" siehe Karin Knorr Cetina, 2005: Complex Global Microstructures. The New Terrorist Societies. In: Theory, Culture & Society, H. 5. S. 213-234#00:29:23# Zur posttraditionalen Vergemeinschaftung siehe Ronald Hitzler, Anne Hohner, Michaela Pfadenhauer, (Hrsg.) 2008: Posttraditionale Gemeinschaften. Theoretische und ethnografische Erkundungen. Wiesbaden: VS#00:31:20# Zur Spezifik in virtueller sozialer Beziehungen siehe: Udo Thiedeke, 2003: Virtuelle Gruppen: Begriff und Charakteristik. In: ders. (Hrsg.): Virtuelle Gruppen. Charakteristika und Problemdimensionen. 2. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 23-67.#00:39:08# Zur Intersubjektivität Hubert Knoblauch, Bernt Schnettler, 2004: “Postsozialität”, Alterität und Alienität. In: Michael Schetsche (Hrsg.): Der maximal Fremde. Begegnungen mit dem Nichtmenschlichen und die Grenzen des Verstehens, Würzburg: Egon. S. 23–41.#00:45:20# Zu Fragen des Designs und den Übergang von Daten zu Fakten siehe: Villém Flusser, 1998: Medienkultur. Hrsg. v. Stefan Bollmann. Frankfurt/M.#00:46:16# Zum gemeinsamen KIT und HfG Seminars von Prof. Dr. Michaela Pfadenhauer und Prof. Dr. Wolfgang Ullrich im Sommersemester 2011 "Bildportale im Web 2.0: Neue Formen der Aneignung von Konsumprodukten" Online#00:50:46# Für Verehrerinnen und Verehrer der Marke, der Apple-Altar für zu Hause Online#00:54:50# In Österreich wird eine Ausbildung für den Aufbau und das Management von Fan-Gemeinschaften angeboten. Online#00:56:16# Was ist "Circuit Bending" Online siehe weiter: Paul Eisewicht, Michaela Pfadenhauer, 2015:Zweckentfremdung als Movens von Aneignungskulturen. Circuit Bending oder: Der gemeinschaftsstiftende inkompetente Gebrauch von Spielzeug. In: Maria Dillschnitter, David Keller, (Hrsg.): Unsachgemäßer Gebrauch. München: Fink (im Erscheinen)#00:59:58# Boris Traue Beschäftigung sich mit den "Audiovisuellen Kulturen der Selbstthematisierung" Online http://videosoziologie.net/forschungsprojekt-audiovisuelle-kulturen-selbstthematisierung seit 10/2014 an der Leuphana-Universität-Lüneburg. Online#01:03:34# Zur situativen Vergemeinschaftung: Winfried Gebhardt, 2008: Gemeinschaften ohne Gemeinschaft. Über situative Event-Vergemeinschaftungen. In: Ronald Hitzler, Anne Honer, Michaela Pfadenhauer (Hrsg.): Posttraditionale Gemeinschaften. Theoretische und ethnografische Erkundungen. Wiesbaden: VS. S. 202-213.#01:10:23# Zu den Techniken der Zugehörigkeit: Paul Eisewicht, Thilo Grenz, Michaela Pfadenhauer (Hrsg.), 2012: Techniken der Zugehörigkeit. Karlsruher Studien Technik und Kultur 5. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing. Online#01:11:43# Zum Begriff der Performanz: Hubert Knoblauch, 2010: Von der Kompetenz zur Performanz. Wissenssoziologische Aspekte der Kompetenz. In: Thomas Kurtz, Michaela Pfadenhauer (Hrsg.): Soziologie der Kompetenz. Wiesbaden: VS. S. 237-255.[alle Links aktuell November/Dezember 2014] Dauer 01:17:16 Folge direkt herunterladen
Architektur- und Werkzeugkonzepte für föderiertes Identitäts-Management
Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/02
Als essentielle Komponente des IT-Security Managements umfasst das Identity & Access Management (I&AM) saemtliche organisatorischen und technischen Prozesse der Verwaltung von Dienstnutzern einer Einrichtung und deren Berechtigungen; dabei werden die Datenbestaende verschiedenster autoritativer Datenquellen wie Personal- und Kundenverwaltungssysteme aggregiert, korreliert und in aufbereiteter Form den IT-Services zur Verfuegung gestellt. Das Federated Identity Management (FIM) hat zum Ziel, die so geschaffenen integrierten Datenbestaende auch organisationsuebergreifend nutzbar zu machen; diese Funktionalitaet wird beispielsweise im Rahmen von Business-to-Business-Kooperationen, Outsourcing-Szenarien und im Grid-Computing zunehmend dringender benoetigt. Die Vermeidung von Redundanz und Inkonsistenzen, aber auch die garantierte Verfuegbarkeit der Daten und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen stellen hierbei besonders kritische Erfolgsfaktoren dar. Mit der Security Assertion Markup Language (SAML), den Spezifikationen der Liberty Alliance und WS-Federation als integralem Bestandteil des Web Services WS-*-Protokollstacks haben sich industrielle und partiell standardisierte technische Ansaetze fuer FIM herauskristallisiert, deren praktische Umsetzung jedoch noch haeufig an der nur unzureichend geklaerten, komplexen organisatorischen Einbettung und den technischen Unzulaenglichkeiten hinsichtlich der Integration in bestehende IT-Infrastrukturen scheitert. In dieser Arbeit wird zunaechst eine tiefgehende und in diesem Umfang neue Anforderungsanalyse durchgefuehrt, die neben I&AM und FIM auch die als User-Centric Identity Management (UCIM) bezeichnete Benutzerperspektive beruecksichtigt; die Schwerpunkte der mehr als 60 strukturierten und gewichteten Anforderungen liegen dabei auf der Integration von I&AM- und FIM-Systemen sowohl auf der Seite der organisation, der die Benutzer angehoeren (Identity Provider), als auch beim jeweiligen Dienstleister (Service Provider), und auf dem Einbezug von organisatorischen Randbedingungen sowie ausgewaehlten Sicherheits- und Datenschutzaspekten. Im Rahmen eines umfassenden, gesamtheitlichen Architekturkonzepts wird anschliessend eine Methodik zur systematischen Integration von FIM-Komponenten in bestehende I&AM-Systeme erarbeitet. Neben der praezisen Spezifikation der technischen Systemschnittstellen, die den bestehenden Ansaetzen fehlt, fokussiert diese Arbeit auf die organisatorische Eingliederung aus Sicht des IT Service Managements, wobei insbesondere das Security Management und das Change Management nach ITIL vertieft werden. Zur Kompensation weiterer grundlegender Defizite bisheriger FIM-Ansaetze werden im Rahmen eines Werkzeugkonzepts fuenf neue FIM-Komponenten spezifiziert, die auf eine verbesserte Interoperabilitaet der FIM-Systeme der an einer so genannten Identity Federation beteiligten organisationen abzielen. Darueber hinaus wird auf Basis der eXtensible Access Control Markup Language (XACML) eine policy-basierte Privacy Management Architektur spezifiziert und integriert, die eine dezentrale Steuerung und Kontrolle von Datenfreigaben durch Administratoren und Benutzer ermoeglicht und somit essentiell zur Einhaltung von Datenschutzauflagen beitraegt. Eine Beschreibung der prototypischen Implementierung der Werkzeugkonzepte mit einer Diskussion ihrer Performanz und die methodische Anwendung des Architekturkonzepts auf ein komplexes, realistisches Szenario runden die Arbeit ab.
Modellselektion in Finite Mixture PLS-Modellen
Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Problem der Modellselektion im Finite Mixture Partial Least Squares (FIMIX-PLS)-Ansatz. Dieser Ansatz, welcher der Methodengruppe der Mischverteilungsmodelle zuzuordnen ist, ermöglicht eine simultane Schätzung der Modellparameter bei gleichzeitiger Ermittlung von Heterogenität in der Datenstruktur. Ein wesentliches Problem bei der Anwendung ist die Bestimmung der Anzahl der zugrunde liegenden Segmente, welche a priori unbekannt ist. Neben diversen statistischen Testverfahren wird zur Handhabung dieser Modellselektionsproblematik häufig auf so genannte Informationskriterien zurückgegriffen. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es herauszuarbeiten, welches Informationskriterium für die Modellselektion in FIMIX-PLS besonders geeignet ist. Hierzu wurde eine Simulationsstudie initiiert, welche die Performanz gebräuchlicher Kriterien vor dem Hintergrund diverser Einflussfaktoren untersucht. Im Rahmen der Studie konnte mit dem Consistent Akaike’s Information Criterion (CAIC) ein Kriterium identifiziert werden, das die übrigen Kriterien in nahezu allen Faktorstufenkombinationen dominiert.
O PodCorrer chega ao último episódio de sua 1ª temporada trazendo as principais diferenças entre correr na rua e na esteira. O bate papo é com os educadores físicos Ramiro Barros e Geovane da Silva, que também falam do Performanz em Movimento, um projeto que visa trabalhar o fortalecimento e à performance de corredores.