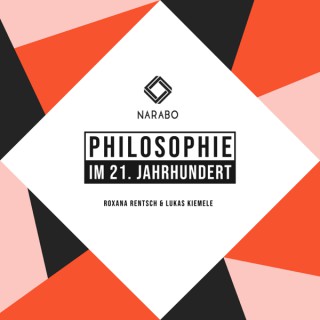Podcasts about sozialstruktur
Sociological classification of human societies according to their social characteristics
- 26PODCASTS
- 26EPISODES
- 42mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Mar 31, 2025LATEST

POPULARITY
Latest news about sozialstruktur
- „Sondergebäude“ in präkeramischen Siedlungen im westlichen Vorderasien (Anatolien, Syrien, Levante) und ihre funktionale Deutung AWOL - The Ancient World Online - Feb 19, 2023
- Die vegane Lebensweise werde hinein den allermeisten absagen durch der gar nicht veganen Sozialstruktur akzeptiert weiters beliebt, Urban Velo - Aug 6, 2022
Latest podcast episodes about sozialstruktur
Was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht?
Systemrelevant - Der Wirtschafts-Podcast der Hans-Böckler-Stiftung
Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie diskutieren Bettina Kohlrausch und Karin Schulze Buschoff basierend auf dem von ihnen herausgegebenen neuen Buch: „Was von Corona übrig bleibt: Erwerbsarbeit, Sozialstruktur, gesellschaftliche Folgen“.
Mutiger Vorstoß in Niedersachsen: Verbot der Ausbildung von Jagdhunden am lebenden Wildtier
Einzigartig und mutig ist die Initiative der grünen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte in Niedersachsen: Als erste Ministerin bringt sie die Abschaffung der nicht tierschutzkonformen Ausbildungs- und Trainingsmethoden von Jagdhunden mit lebenden, flugunfähig gemachten Enten, mit Wildschweinen im Wildschweingatter und mit Füchsen in Schliefenanlagen in einen Referentenentwurf zur Gesetzesvorlage. Auch die Haltung, z.B. von Füchsen in Schliefenanlagen soll damit künftig untersagt sein. Außerdem soll die Baujagd zumindest im Naturbau verboten sein, ebenso der Abschuss von Hunden und Katzen und die Verwendung von Totschlagfallen. Leider setzt sie auch auf die Abschaffung der Rehwild-Abschussplanung, die bisher eine weitgehende Erhaltung der Sozialstruktur bei dieser Tierart gewährleistet.
Diesseits von Eden Ganze Sendung (05.01.2025)
1. Die jüdischen Friedhöfe Nordrhein-Westfalens - im Netz 2. Neues Leben oder Abriss - nach Aufgabe einer Kirche 3. Kirche und Arme- Recherche zur Sozialstruktur der Gemeinden. 4. Queere Theologie und Seelsorge - neues Feld für evangelische Kirchen. 5. Reliquien - wer braucht so was heute? 6. Unsinn und Sinn Moderation: Christina-Maria Purkert Von WDR 5.
Anfang der 1970er Jahre erschütterten hunderte wilder Streiks die bundesdeutsche Industrie. Vor allem die sog. Gastarbeiter kämpften entschieden für besser Arbeitsbedingungen, aber darüber hinaus auch für ein Ende ihrer umfassenden Diskriminierung. Wir hören außerdem das 15minütige Hörspiel von Mesut Bayraktar «Wenn der Damm bricht» und diskutieren mit dem Autor über den Ford-Streik von August 1973 und warum dieser, trotz seiner Niederlage, heute eine stolze Erzählung von Solidarität und Selbstbewusstsein migrantischer Eltern und Großeltern darstellt. Im Anschluss sprechen wir mit Florian Weis über die Transformation der Gewerkschaften, und warum heutige Kämpfe den historischen Blick auf gelingende und misslingende Solidaritäten brauchen. Mesut Bayraktar ist Autor der Romane »Briefe aus Istanbul« (2018), »Wunsch der Verwüstlichen« (2021) und »Aydin – Erinnerungen an ein verweigertes Leben« (2021) sowie eines Sachbuchs zu G.W.F. Hegel »Der Pöbel und die Freiheit« (2021) als auch des Dramas »Die Belagerten« (2018). Im November 2021 wurde sein Theaterstück »Gastarbeiter-Monologe« erstaufgeführt. Florian Weis ist Historiker und seit 1999 Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und war von 2008 bis Anfang 2020 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Er leitet die RLS-Gesprächskreise „Klassen und Sozialstruktur“ und „Antisemitismus / jüdisch-linke Geschichte und Gegenwart“ und hat gemeinsam mit Bernd Hüttner und Riccardo Altieri die Schriftenreihe „Jüdinnen und Juden in der internationalen Linken“ publiziert.
Du siehst ja gut aus für Dein Alter!“ - klingt gut gemeint, in der vermeintlichen Wertschätzung steckt aber Altersdiskriminierung. Die mittleren Lebensjahre gelten in unserer Gesellschaft als Ideal von entscheidungsfähigen und selbstbestimmten Erwachsenen, die frühen und späten Lebensjahre daneben als Abweichung. Und schon kann abschätzig über die viel zu jungen „Fridays for future-Kids“ gesprochen werden oder über die „Demographische Zeitbombe“, die die Älteren zur gesellschaftlichen Bedrohung abstempeln. Altersdiskriminierung begegnet uns in allen Lebensbereichen, auf dem Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen oder auf der Leinwand. Wollen wir uns ein Gegeneinander der Generationen wirklich leisten? Wir sprechen u.a. mit: Prof. Dr. Martina Brandt, Lehrstuhl für Sozialstruktur und Soziologie alternder Gesellschaften, Dr. Anna Wanka, Erziehungswissenschaft Goethe-Universität Frankfurt, Rüdiger Krauß-Matlachowski, Berater im Bürgerinstitut Frankfurt, die Schauspielerin Ruth Reinecke und mit Prof. Dr. Constanze Janda, Uni Speyer.
Staffel 2. Episode 3 - Das Glück liegt auf der Straße
Eine besondere Form der Nachhaltigkeit ist ja bekanntlich Recycling. Klappt das auch in der Kunst? Das Bild: Working Class, Acryl & Papier auf Leinwand, 135 cm x 110 cm, 2020. EUR 3.200 Die Künstlerin: Despoina Pagiota ist geboren und aufgewachsen in Thessaloniki, Griechenland. Sie lebt und arbeitet seit 2014 in Hamburg, studierte an der Hochschule für bildende Künste und schloss ihr Studium mit dem Master of Fine Arts ab. Sie präsentierte ihre Arbeiten in verschiedenen Ausstellungen im In- und Ausland und wurde 2020 u.a. mit der Nachwuchsförderung der Kunststiftung Schües und mit Reisestipendien ausgezeichnet. Despoina Pagiota befasst sich in ihrer künstlerischen Praxis mit der Beziehung zwischen zeitgenössischer urbaner Landschaft und dem Konsumverhalten, dass die zeitgenössische Ikonographie und Sozialstruktur beeinflusst. Zur ihrer Masterarbeit “Wandering in Rothenburgsort, thoughts on painting and class” recherchierte die Künstlerin zu der städtebaulichen Entwicklung von Rothenburgsort, dem Stadtteil, den sozialen Strukturen darin und entwickelte eine Serie von Arbeiten.
Im Anschluss an die NRW-Landtagswahlen 2022 hat sich unsere Redakteurin Anja Wilke damit auseinandergesetzt, warum die Grünen in Köln erneut als stärkste Partei abgeschnitten haben. Dazu hat sie sich mit dem Politikwissenschaftler Christopher Prinz von der Universität Bonn unterhalten. Inwiefern die Wahlergebnisse in Köln mit der Sozialstruktur der Stadt zusammenhängen und warum die Menschen in bestimmten Stadtteilen anders wählen, könnt ihr hier nachhören.
7. Die Veränderung der Sozialstruktur im Hellenismus und in Rom
Wie sozialer Zusammenhalt und moralisches Bewusstsein miteinander historisch zusammenhängen, inspiriert auch unser Leben heute zu betrachten und ich stelle mir die Frage: Fördert soziale Isolation unmoralisches Denken? Vielleicht. Immerhin sind weniger Kontrollinstanzen da, weniger regulierende Gruppendynamik, wenn man nicht in Gemeinschaft lebt. Aber ist das nicht zu pauschal? Was, wenn die Gemeinschaft verdorben ist, Mafiosos oder so? Kann man überhaupt Moral ohne Mitmenschen, oder ohne Mitwelt denken?
Die Primateninitiative bewegt in Basel-Stadt derzeit die Gemüter: Nicht-menschliche Primaten sollen Grundrechte erhalten. Der Zoo Basel spricht sich gegen diese Initiative aus und zeigt in Teil 2 dieser Podcast-Serie auf, wie ein Ja zur Initiative die Affenhaltung im Zoo negativ beeinflussen würde. Und wie stark sich die Sozialstruktur nicht-menschlicher Primaten vom Sozialsystem der Menschen unterscheidet Es äussern sich Vertreter*innen des Zoo Basel, der Professor für Tierschutz Prof. Dr. Hanno Würbel von der Universität Bern sowie der renommierte Affenforscher Prof. Dr. Klaus Zuberbühler von der Universität Neuenburg.
Die Organisation der Zukunft – Mit Jan Hugenroth, Gründer und Managing Director NEXT MATTER
Die Organisation der Zukunft – Mit Jan Hugenroth, Gründer und Managing Director NEXT MATTER Wir starten in dieser Folge 66 mit einem Ausblick in die Zukunft von Organisation und Arbeit. Zu Gast im FUTURE CANDY Studio ist Jan Hugenroth, Gründer und Managing Director von NEXT MATTER, dem SAAS StartUp aus Berlin. Next Matter entwickelt Automatisierungstools zur Koordination operativer Bereiche. Wie werden zukünftige Arbeitsstrukturen und deren Automatisierung genau aussehen? Nick Sohnemann fragt den Software Experten im aktuellen Podcast, was heute bereits möglich ist und welche Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen. Die NEXT MATTER All-in-One-Betriebs-Plattform unterstützt Unternehmen im operativen Bereich. Das wirft die Frage nach zukünftigen Arbeitsstrukturen und deren Automatisierung auf. Nick Sohnemann will wissen, was heute bereits möglich ist und welche Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen. Jan berichtet von seinem Gedankenprinzip. Was das mit LEGO zu tun hat und wieso Bausteine notwendige Transparenz in Unternehmen schaffen, erfahren wir hier. Nick und Jan sprechen im #66 über den Irrglauben an eine digitalisierungsferne Sozialstruktur und die restriktive Toolnutzung innerhalb der Unternehmen. Schon einmal etwas von der No-Code-Logik gehört? Technologie trifft auf Business im Innovations Podcast. Es geht um Datenpunkte, digitale Erfassungen und Entscheidungshygiene, aber auch um Ideenfindung und den kreativen Input der Mitarbeiter. Und wie lautet der Ausblick der beiden Experten? Nick und Jan sind sich einig: Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht, aber es steht fest, dass wir Unternehmen mit einem modernen SetUp brauchen, die agil reagieren können, um den Wohlstand zu erhalten. Eine Veränderung der Tätigkeitsfelder wird auch eine Veränderung der Organisation mit sich bringen. Gute Vorbereitung beginnt jetzt! In unserer Folge 66 geht es innovativ, kurzweilig und philosophisch der Frage nach, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird und was zu tun ist, um auf den Wandel vorbereitet zu sein. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
News in Slow German - #266 - Intermediate German Weekly Program
Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den alarmierenden Klimabericht, der am Montag vom Weltklimarat veröffentlicht wurde. Danach besprechen wir die Ankündigung des polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski vom Samstag, dass Polen Änderungen an der umstrittenen Disziplinarkammer für Richter vornehmen wird. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über die komplexe Sozialstruktur von Giraffen. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem Überblick über einige interessante Statistiken zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Diese Woche werden wir in „Trending in Germany“ über einen versteckten Nazi-Schatz sprechen, der nach den Überschwemmungen in Deutschland in einer Hauswand in der Stadt Hagen gefunden wurde. Außerdem diskutieren wir über die öffentlichen sexistischen Kommentare, die ein Kritiker während der Salzburger Festspiele über die Schauspielerin Verena Altenberger geäußert hat. - UNO-Klimabericht: beunruhigende Prognosen - Ungarn und Polen unter Druck der EU; Unterstützung von Trump-Anhängern - Giraffen haben eine komplexe Sozialstruktur wie Elefanten - Olympische Spiele 2020 in Tokio: Rekorde für Athletinnen und LGBTQ-Athleten - Sensationeller Nazi-Fund in Hagen-Eckesey - Sexismus-Vorwurf bei den Salzburger Festspielen
#23 - Was nützt der Sozialraum? mit Ingolf Hübner (Diakonie) und Steffen Merle (EKD)
Klar, wir leben alle drinne, doch was nützt der Sozialraum eigentlich? Eine berechtigte Frage, wie ich finde, denn beide Kirchen haben lange daran gearbeitet, dass ihre Sozialstruktur der Pfarrei oder Gemeinde als kleine perfekte und vollumfängliche Welt wahrgenommen wird. Klar, dass jetzt, wo es bröckelt, die Kirchen auf das Leben außerhalb der eigenen Mauern schauen, oder? Nicht von dem Denken, was wir anzubieten haben, sondern von den Fragen der Menschen. Und die bekommt man nur heraus, wenn man sich auf sie zubewegt. Ingolf Hübner, Diakonie Für Steffen Merle (Referent für sozial- und gesellschaftspolitische Fragen im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland) und Ingolf Hübner (Diakonie Deutschland) ist die Arbeit im, für und mit dem Sozialraum kein Wachstumstrick von Kirche, sondern Ausdruck der tiefverwurzelte Überzeugung, dass das Heil inklusiv ist. Sehe ich den Nachbarn als Nächsten? Das ist ja etwas, was ich da hineinlege und vielleicht auch den anderen sichtbar machen kann. Und dann bin ich unterwegs das Evangelium zu bezeugen. Steffen Merle, EKD Wen das Thema Sozialraum interessiert, sei herzlich zum Kongress Wir und Hier eingeladen, der im September 2021 stattfinden wird. Mehr Informationen findet ihr auf der Homepage: Der Wir und Hier Kongress
Folge 12: GRW-Prüfungs-Kaffeeklatsch Episode 3: Sozialstruktur und Bevölkerungsentwicklung
Laurenz und Konrad besprechen in dieser Serie die Inhalte der Abiturprüfung in GRW, natürlich im Strafbierstil. In dieser Folge geht es um Sozialstruktur und Bevölkerungsentwicklung. Quellen: https://www.bpb.de/ GRW-Hefter
Es gibt ungefähr 10.000 Billionen Ameisen auf der Erde, die zu circa 9.500 Ameisenarten gehören und insgesamt etwa gleich viel wiegen wie alle Menschen der Welt zusammen. Doch nicht nur quantitativ punktet die Ameise: Sie ist in Bezug auf ihre Sozialstruktur, ihre architektonischen und sonstigen Fähigkeiten ein wahres Faszinosum. Susanne Foitzik, Professorin für Verhaltensökologie und Soziale Evolution an der Universität in Mainz, beschreibt neue Forschungsergebnisse. (SWR 2020) | Mehr zur Sendung: http://swr.li/ameisen | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Twitter: @swr2wissen
Neue Vizechefin des US-Wissenschaftsgremiums - Wissen über die soziale Macht der Algorithmen
Alondra Nelson hat als Soziologin die Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion maßgeblich bereichert. Als neue Vize-Chefin des US-Amtes für Wissenschafts- und Technik-Politik rückt sie die Macht der Algorithmen in den Blickpunkt - und ihre verinnerlichte Sozialstruktur, die viele Gruppen vernachlässigt. Von Thomas Reintjes www.deutschlandfunk.de, Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Neue Vizechefin des US-Wissenschaftsgremiums - Wissen über die soziale Macht der Algorithmen
Alondra Nelson hat als Soziologin die Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion maßgeblich bereichert. Als neue Vize-Chefin des US-Amtes für Wissenschafts- und Technik-Politik rückt sie die Macht der Algorithmen in den Blickpunkt - und ihre verinnerlichte Sozialstruktur, die viele Gruppen vernachlässigt. Von Thomas Reintjes www.deutschlandfunk.de, Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Ein Standpunkt von Ulrich Teusch. Die Apologeten des „Great Reset“ setzen auf modernste Technik, um die existenzielle Krise des globalen Kapitalismus zu überwinden. Doch dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, denn es basiert auf einem naiven, unterkomplexen Technikbegriff. Der vorliegende Beitrag entwickelt ein alternatives Verständnis moderner Technik und erläutert, warum diese nicht als Rettungsanker taugt, sondern eher als Brandbeschleuniger wirkt. Im Zentrum der Argumentation steht das Konzept eines global ausgreifenden technischen Systems. Teil 1 des Artikels ist hier zu lesen. Auch mit dem, was man landläufig unter „Technikdeterminismus“ versteht, hat die Vorstellung eines technischen Systems nichts zu tun. Der Begriff Technikdeterminismus leistet dem Eindruck Vorschub, die Technik sei ein von vermeintlich technikfreien gesellschaftlichen Sphären eindeutig abgrenzbarer Faktor der sozialen Entwicklung, ein Subsystem der Gesellschaft, das auf andere, nicht-technische Bereiche oder Subsysteme determinierende Wirkungen ausübe. Weit angemessener ist demgegenüber das von dem Philosophen Gernot Böhme vorgeschlagene Bild einer „Technostruktur“, die „den gesellschaftlichen Körper wie ein Pilz [durchzieht]“. Worin sich das Konzept einer Technostruktur von einem deterministischen Erklärungsansatz unterscheidet, hat Böhme wie folgt erläutert: „[Die Technik] ist in die Sozialstruktur eingedrungen, in die Formen sozialen Handelns, in die normativen Erwartungen, oder besser, sie ist selbst eine Sozialstruktur, eine Form gesellschaftlichen Handelns und ein Bestandteil des Regelkanons geworden. Es geht (…) nicht mehr um Technik als Ursache oder Technik als Gegenstand, sondern es geht um die technischen Formen von Gesellschaftlichkeit, oder besser gesagt um die Erkenntnis der fortschreitenden Technisierung gesellschaftlicher Wirklichkeit und der damit verbundenen Probleme.“ Und weiter: „Das Thema einer Theorie der Gesellschaft in der technischen Zivilisation ist (…) nicht so sehr die Technik in der Gesellschaft und der ihr entsprechende gesellschaftliche Wandel, sondern die Technisierung der Gesellschaft. Die Produktion von Technik gehört zur gesellschaftlichen Reproduktion: Mit der Technik produzieren wir gesellschaftliche Strukturen.“ Die Folge: Es entstehen manifeste Sachzwänge und Denkzwänge; die einen sind von den anderen nicht zu trennen. Subjekt und Objekt, Mensch und Technik stehen sich nicht länger in einem Verhältnis von Herr und Knecht oder von Zweck und Mittel gegenüber, sondern sind zu einer neuen Einheit verschmolzen. Die Technik erscheint als autonomes Gebilde, und zwar nicht deshalb, weil sie schon von jeher autonom gewesen wäre, sondern weil der Mensch seine Autonomie verloren oder verspielt hat. Der Mensch hat das technische System zwar erdacht und konstruiert und ist auf vielfältige Weise in die systemischen Zusammenhänge integriert, gleichwohl tritt ihm das System als fremde Macht gegenüber. Obwohl die Technik fraglos von dieser Welt ist, bildet sie eine Welt für sich. Dialektik der Technik Doch sosehr das technische System die Gesellschaft auch durchdringt, es ist mit ihr nicht deckungsgleich. Nicht alle gesellschaftlichen Sphären sind gleichermaßen technisiert oder technisierbar. Analoges gilt für das Verhältnis zwischen technischem System und den natürlichen Lebensgrundlagen. Technik durchdringt die Natur, bedient sich ihrer, verändert oder zerstört sie. Doch sie bleibt auf halbwegs intakte ökologische Systeme ebenso angewiesen wie auf gesellschaftliche Ressourcen. Es ist eine Dialektik am Werk. Auf dem sozialen Feld werden die entsprechenden Spannungen und Widersprüche in der Regel so „gelöst“, dass der weniger technisierte Bereich nachzieht, also eine Art „Frontbegradigung“ (so der Technikhistoriker Thomas Hughes) stattfindet. Gelingt dies jedoch nicht, entstehen große Probleme. Und wenn Technik global ausgreift, entstehen diese Probleme im globalen Maßstab. Wenn der Technisierungsprozess zudem ständig an Geschwindigkeit zulegt, sind die Anpassungsprozesse immer schwerer zu bewerkstelligen – auf individueller Ebene ohnehin, aber auch auf gesellschaftlicher und schließlich auf globaler Ebene. Insofern ist die Vorstellung verfehlt, der Technisierungsprozess würde zu stets größerer Harmonie führen…weiterlesen hier: https://kenfm.de/technik-und-krise-teil-2-von-ulrich-teusch/ Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde https://de.tipeee.com/kenfm https://flattr.com/@KenFM See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Vom Publikum gewünscht 10/10: Aboriginals, älteste Kultur der Welt
Überraschend und vielfältig: Das Publikum regt die Themen der zehnteiligen Sommerserie an. Es geht um Familiengeheimnisse, Scheidungskinder und die Generation im mittleren Alter. «Kontext» spricht mit Schweizern im Ausland und Aborigines in Australien und berichtet über Liedermacher und Strickkunst. Wie schaffen es die Ureinwohner Australiens, mehr als 50'000 Jahre unter äusserst harten Umweltbedingungen zu überleben? Ohne diese Natur zu zerstören – ohne Kriege – ohne Schrift – ohne festen Wohnsitz? Indem die Mitglieder dieser Kultur ein hochdifferenziertes Wissen pflegten, über eine ausgeklügelte Sozialstruktur verfügten, welche auf einem ebenso ausgeklügelten religiösen System basiert. Doch was heisst das genau? Wir sprechen mit Birgit Scheps, einer der ausgewiesensten Kennerinnen der Kultur der australischen Ureinwohner, und Australienkorrespondent Urs Wälterlin trifft Delise Freeman, Chefin einer indigenen Community. Weitere Themen: - Traumzeit - Echtzeit
Soziologe Hans-Peter Müller - Relevanz der Philosophie in der heutigen Zeit #4
Hans-Peter Müller ist seit 1992 Professor für allgemeine Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und bei uns zu Gast in der vierten Folge des Narabo-Podcasts ›Philosophie im 21. Jahrhundert‹ zum Thema der Relevanz der Philosophie in der heutigen Zeit. Herr Müller ist seit 2019 Mitglied des Vorstands in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS). Als Soziologie hat er seine Forschungsgebiete unter anderem im Bereich der Soziologie der Lebensführung, Klassiker der soziologischen Theorie, Bildung und Gesellschaft sowie Sozialstruktur und Ungleichheit. Themen des Gesprächs sind unter anderem die Fragen, wie sich Soziologie von Philosophie unterscheidet, warum wir heutzutage Geisteswissenschaftler*innen brauchen und wie soziologische Arbeit aussieht.
Zwischen Haus, Kindern, Job und Dorfsaal: Frauen auf dem Land
Eine ausgeglichene Sozialstruktur ist für die gesunde Entwicklung einer Region unentbehrlich. Doch oft sind es die Frauen, die besser ausgebildet, die Regionen verlassen. Wie leben Frauen heute auf dem Land?
Man ist nicht nur einmal im Jahr arm. Arm sein heißt, die dunkle, kleine Wohnung, die schlechte Luft im schlechten Kiez, das schlechtere Essen, die schlechtere Schule, den härteren Job -- Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang. Das ist aber keine Neuigkeit. So wie viele andere Themen, die eher strukturelle, dauerhafte Probleme betreffen, bietet die Armut nur gelegentlich Anlass zur Berichterstattung. Die Aufmerksamkeitsökonomie der Massenmedien folgt anderen Gesetzen als die Alltäglichkeit der Sozialstruktur. Wir sprechen mit Maja Malik, die eine der wenigen systematischen empirischen Studien zur Armutsberichtserstattung in Deutschland publiziert hat. Das Ergebnis: Armut ist durchaus ein präsentes Thema in Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen. Sobald eine neue Studie herauskommt oder ein Politiker sich kontrovers äußert, bekommt die Armut die nötige Aktualität. Zugleich bleiben politische Hintergründe oft unerklärt und die Betroffenen kommen selten selbst zu Wort. Haben wir es hier mit einem allgemeinen Problem der Öffentlichkeit zu tun? Muss der Journalismus seine Beziehung zur Aktualität überdenken? Müsste er noch stärker eigene Themen setzen, als auf Tagespolitik nur zu reagieren? Finden wir in den journalistischen Rechercheverbünden oder sogar auf YouTube Gegenmodelle?
Mike Josef, wie stoppen Sie die Explosion der Mieten?
Mike Josef hat eine beinahe unlösbare Aufgabe. Frankfurt wächst und wächst, wie alle Großstädte, trotzdem muss er es schaffen, dass die Mieten nicht weiter steigen. Was tut er dafür, dass Menschen mit normalem Einkommen in der Stadt wohnen bleiben können, dass Sozialwohnungen nicht weiter verschwinden, dass die gewachsene Sozialstruktur von Stadtteilen nicht binnen weniger Jahre durch Gentrifizierung zerstört wird? Als Planungs- und Wohnungsbaudezernent von Frankfurt muss er darauf Antworten finden. Früher war das vielleicht ein dröger Job, heute geht es um Zukunftsfragen: „Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist die Voraussetzung Teil einer Gesellschaft zu sein", sagt Josef. Josefs Leben ist eine Aufsteigergeschichte: Seine Eltern flohen als Christen aus Syrien nach Deutschland. Vieles musste die Familie erst lernen. Auf die Flüchtlingskrise hatte der SPD-Politiker 2015 einen anderen Blick: "Wenn meine Eltern damals, 1987, nicht das Land verlassen hätten, wäre ich vielleicht heute einer von denen, die jetzt gekommen sind.“ Warum seine Eltern ihren Namen eindeutschen ließen und wieso Josef als heutiger Hoffnungsträger der hessischen SPD bei seiner ersten Bundestagswahl 2002 Edmund Stoiber wählte - über all das sprechen wir mit ihm im F.A.Z.-Gesprächspodcasts Am Tresen.
#02 - Denk doch mal einer an die Kinder!
Kann denn nicht mal einer an die Kinder denken? Klar doch! Die Nordstadt ist Dortmunds kinderreichster Stadtteil. Entgegen der landläufigen Meinung sind die Bildungsangebote hier geradezu exzellent. Sie produzieren jede Menge Bildungsgewinner und Aufsteiger. Die Sache hat aber einen Haken: Die Gewinner ziehen weg und es rücken neue Abgehängte nach. An der Sozialstruktur der Nordstadt ändert sich durch die Bildung deshalb nichts. Für diese Folge habe ich mit Thorsten Stumm, einem alleinerziehenden Vater, Maren Reimann, der Konrektorin der Grundschule Kleine Kielstraße und dem Politikwissenschaftsprofessor Aladin El-Mafaalani gesprochen.
Wie sind wir bloß in das Hamsterrad geraten – und wie kommen wir wieder heraus?
Wie sind wir bloß in das Hamsterrad geraten? Und wie kommen wir wieder heraus? Im November 2016 habe ich einen 45-minütigen Vortrag im artop-Institut in Berlin gehalten zum Thema Heraus aus dem Hamsterrad Über Psycho-Ökologie und Sinn-Orientierung im Zeitalter des Narzissmus. Sie können ihn >>>hier online nachhören. Hier der Vortrag als Text: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, habt ihr eigentlich genug Zeit? Habt ihr im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche oder eines Monats genug Zeit für Muße? Habt ihr Zeit auch einmal nichts zu tun? Habt ihr Zeit genug, um bei etwas oder mit jemandem zu verweilen? Habt ihr Zeit genug um euch wirklich entspannen zu können? Zeit zur Regeneration? Mit eurer Familie, euren Partnern, euren Kindern? Zeit genug für eure und mit euren Freunden? Oder steht ihr unter Zeitdruck? Würdet ihr sagen, dass der Zeitdruck in den letzten Jahren eher zugenommen oder eher abgenommen hat? Fühlt ihr euch unter Leistungsdruck? Erlebt ihr Termindruck? Kennt Ihr Konkurrenzdruck? Leidet Ihr unter Bürokratiestress? Ausgehend von zeitkritischen Autoren wie Rahel Jaeggi, Byung-Chul Han, Alex Honneth und Hartmut Rosa möchte ich euch folgende Thesen vorstellen: Im Neoliberalismus, also einem globalisierten, digitalisierten und medialisierten Marktfundamentalismus werden Gefühle, Bedürfnisse und soziale Beziehungen mehr und mehr in Bewertungs- und Verwertungsprozesse einbezogen und damit wie Waren behandelt, also verdinglicht. Die neoliberale Gesellschaft fördert und prägt bestimmte, als „postmodern“ bezeichnete psychische Störungen der Selbststruktur. Daher ist eine intersubjektive Form der Beziehungsgestaltung im Kontext psychischer Dienstleistungen wie Psychotherapie oder Coaching besonders hilfreich. Gemeint ist eine Art, sich auf den Klienten zu beziehen, die aus einem Sich-Einlassen und Sich-Berühren-Lassen im Rahmen der professionellen Grenzen als Kern der Beziehung zum Klienten besteht. Das ist nicht im Sinne einer rezeptartig vorgebbaren und schematisch reproduzierbaren Technik zu verstehen, sondern als grundlegende Einstellung, als Werthaltung, als Berufsethik. Nachdem ich diese Thesen formuliert hatte, habe ich mich gefragt: Ist das nicht eventuell banal? Werdet ihr nicht sagen: Das ist doch klar, was glaubst du denn, was wir tagtäglich sowieso machen? Ich denke, dass das stimmt, aber auch nicht stimmt. Eine intersubjektive, dialogische, personzentrierte Haltung einzunehmen beziehungsweise sich immer wieder darum zu bemühen ist so etwas wie die Wertschätzung des Friedens, der Demokratie, der Menschenwürde, der Gleichberechtigung, der Inklusion oder der sozialen Gerechtigkeit. Jeder vernünftig (also nicht rechtspopulistisch) denkende Mensch würde all das für selbstverständlich halten. Es scheint gar nicht der Rede wert zu sein, sich damit zu beschäftigen. Dennoch ist die konkrete Umsetzung humanistischer Werte im täglichen Leben und besonders in der Arbeit mit Menschen gerade in Zeiten des weltweiten Wiedererstarkens antipluralistischer und aggressiv-autoritärer Orientierungen notwendiger denn je, aber in der Praxis manchmal eine recht diffizile Angelegenheit. Die Grundfrage, um die es hier geht, ist: Wie sehe ich den Menschen, hier speziell den Klienten, mich selbst mit ihm und das was zwischen uns geschieht? In den letzten Jahren hat sich vor allem an den Hochschulen ein Verständnis von Psychologie als Naturwissenschaft etabliert. Naturwissenschaftlich betrachtet ist der Mensch ein Objekt wissenschaftlicher Forschung wie jedes andere. Daraus resultieren in der Anwendung bestimmte generalisierbare und rezeptartig anwendbare Transformationstechniken. Der Mensch erscheint dann entweder als Blackbox, die auf einen Input mit einem statistisch vorhersagbaren Output reagiert, oder als biologischer Computer im Schädel, der durch seine Schaltkreise determiniert ist, als Ergebnis unbewusster Triebschicksale und Abwehrprozesse oder unentrinnbar eingesponnen in ein Netz systemischer Wechselwirkungen. In einer solchen Sichtweise wird der Psychotherapeut oder Coach zu einem Transformationsexperten mit der Aufgabe, vor dem Hintergrund umfassenden Fachwissens mithilfe empirisch validierten Interventionen dem Klienten aus seinem Leiden heraus und in ein zufriedenes Leben hinein zu verhelfen, und das bedeutet auch, ihn leistungsfähiger zu machen. Zweifellos ist der Mensch auch ein materielles Wesen mit beschreibbaren Hirnprozessen, biologischen Trieben, auf vielfältige Weise Konditionierungen unterworfen und in dynamische Beziehungssystem eingebunden. Die Frage, die sich aus einer humanistisch-existenziellen Perspektive stellt ist: Ist der Mensch als Mensch vielleicht mehr als all das? Ist der Mensch nicht mehr als ein Tier? Was genau unterscheidet uns eigentlich von den Tieren, und welche Folgen hat das in Psychotherapie und Beratung? Der Mensch kann und muss naturwissenschaftlich untersucht werden. Ohne diese Perspektive gäbe es kein Insulin, kein MRT und keine Kontaktlinsen. Wenn ich aber als Psychotherapeut oder Coach den Menschen ausschließlich als Objekt, zugespitzt ausgedrückt als Ding unter Dingen entgegentrete, aus der Perspektive eines unabhängigen Beobachters und Technikers, beraubte ich ihn dann nicht seiner Würde als Person, und damit auch mich selbst? Und was genau wäre dazu – praktisch gesehen – die Alternative? Wir können zwei Grundformen menschlicher Beziehungen unterscheiden: geschäftliche Beziehungen und persönliche Beziehungen. Wie wir alle wissen, wird es immer schwierig, wenn diese beiden Ebenen vermischt werden, aber genau das geschieht in der Psychotherapie und in etwas anderer Form und Umfang wohl auch beim Coaching, in der Supervision, in der Personal- und Organisationsentwicklung. Eine geschäftliche Beziehung habe ich zum Beispiel zu einer Verkäuferin beim Bäcker, wenn ich dort Brötchen kaufen will. Ich bin vielleicht höflich und freundlich, aber als Person, als Mensch bleibt mir die Verkäuferin ebenso fremd wie ich ihr. Wir haben das, was der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber als eine Ich-Es-Beziehung bezeichnet hat. Wir begegnen uns nicht persönlich, sondern funktional – in diesem Fall als Verkäuferin und Kunde. In manchen Kontexten ist das unvermeidlich und oft auch angemessen. Eine persönliche Beziehung habe ich dagegen zum Beispiel zu einem Freund. Er ist mir wichtig, er liegt mir am Herzen und ich ihm. Wir begegnen uns und beziehen uns aufeinander als Menschen, als Personen. Wir vertrauen uns einander an. Wir tauschen uns persönlich aus und setzen uns miteinander auseinander über uns und über das, was uns beschäftigt und bewegt. Buber hat das eine Ich-Du-Beziehung genannt. In der Psychotherapie, so wie ich sie verstehe und praktiziere, und möglicherweise auch im Coaching, handelt es sich um eine Mischform zwischen beiden, ich bezeichne das als „professionelle Intersubjektivität“. Psychotherapeut oder Coach und Patient oder Klient haben miteinander zweifellos eine professionelle Auftragsbeziehung und ein juristisches Vertragsverhältnis über eine bezahlte Dienstleistung. Wenn dieser Aspekt jedoch verabsolutieren wird, wenn beide sich ausschließlich oder überwiegend als bloße Geschäftspartner sehen und behandeln, und das was zwischen ihnen passiert als rein sachliche, zweckorientierte Unternehmung betrachten, dann wird Psychotherapie und Coaching zur bloßen Psychotechnik und des Menschlichen entkleidet zu einer dinglichen, entfremdeten Angelegenheit, zu einem bloßen Geschäft. Wenn dagegen die Beteiligten vergessen oder vergessen wollen, dass sie sich zur Erfüllung eines professionellen Auftrags treffen, für den der eine den anderen beauftragt hat und für dessen Bezahlung er sorgt, dann verwandelt sich Psychotherapie und vielleicht manchmal auch Coaching in einen Beziehungsersatz oder in eine privaten Beziehung mit den bekannten, oft tragischen Folgen. Ich bin nun schon seit tatsächlich 33 Jahren als Psychotherapeut tätig und erkenne in dieser und ähnlichen Berufsgruppen in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Trend in Richtung Professionalisierung. Das ist gut, weil vieles von dem, was in den wilden 1960er bis `80er Jahren im Bereich der Seelenarbeit ausprobiert wurde, wohl mehr geschadet als genutzt hat. Professionalisierung war und ist notwendig und außerdem unvermeidbar. Aber – meiner Meinung nach kommt heute bei Seelenarbeitern der Mensch als Subjekt und die Beziehung als Intersubjektivität, also das humanistische Element oft zu kurz. Ich beobachte das insbesondere bei den nachwachsenden, jungen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die die Universität nach dem Bologna-Prozess durchlaufen haben, der jede kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten und mit sich selbst in einer Flut von Prüfungen erstickt, und die als Psychotherapeuten nur die Alternative zwischen zwei Richtlinienverfahren kennen. Sie lernen, Menschen in Diagnosen oder Typologien einzusortieren und sich an Handbuchwissen und Behandlungsleitlinien zu orientieren, was wie zu verstehen ist und wann welche Interventionen erforderlich sind. Auf diese Weise wird die Beziehung zum Klienten etwas ganz oder überwiegend Zielorientiertes. Dass der Therapeut oder Coach vom Klienten unweigerlich auf einer persönlichen, emotionalen Ebene berührt, ja manchmal tief bewegt oder gar erschüttert wird, kommt dann zu kurz. Und dass auch der Therapeut oder Coach nicht nur eine Art käuflicher Heilungs- oder Orientierungswerkzeugkasten ist, sondern auch und gerade durch die Art, wer und wie er als Mensch ist, wie er sich zeigt und wie er als Person wirkt, sich nachhaltig in die Seele des Klienten einprägt, kommt oft zu kurz. Ich möchte daher diesen Aspekt hier betonen, was die Erfordernisse, Errungenschaften und Qualitäten einer professionellen, angemessen abgegrenzten und methodisch fundierten Arbeit überhaupt nicht in Frage stellen soll. Als Psychotherapeut habe ich täglich Anteil an Schicksalen, Erfahrungen, Erlebensebenen, biografischen Umbrüchen und kreativen Intuitionen, die mich immer wieder komplett überraschen, und mit denen ich niemals gerechnet hätte. In der Zen-Tradition spricht man vom Anfängergeist, also einer Haltung, in der man versucht, sich jeder Situation so zu nähern, als ob man sie zum allerersten Mal erlebt. In mir hat sich im Laufe der Jahre eine recht umfangreiche Bibliothek aus konzeptuellem und technischem Wissen und professioneller Erfahrung angesammelt. Dennoch verblüffen mich jeden Tag Patienten mit Wendungen und Wandlungen, die in keinem Lehrbuch stehen, und die unmöglich geplant oder vorhergesehen werden können. Und ich selbst überrasche mich mit Einfällen und Interventionen, die ich nie zuvor gehabt habe. Genau das ist es, was diese Arbeit für mich immer wieder lebendig und befriedigend macht. Wenn wir Psychotherapie im Sinne von Irvin Yalom und Coaching im Sinne von Alfried Längle als existenziellen Dialog verstehen, dann sprechen wir nicht von einer Technik neben anderen Techniken. Es ist vielmehr eine Art der Bezugnahme auf den Anderen als Person, als Subjekt, wodurch professionelle Seelenarbeit zugleich menschliche Begegnung sein kann. Meiner Meinung nach ist das nicht nur eine ethische Frage im Sinne eines menschlichen Umgangs miteinander, sondern von größter Bedeutung auch für die Wirksamkeit dessen was wir tun, insbesondere, wenn wir es mit Fragen, Problemen oder Störungen zu tun haben, die durch Entfremdung, Verdinglichung, Funktionalisierung, Ausnutzung oder gar Benutzung von Menschen als Objekt entstanden sind oder zu tun haben. Mit einem Begriff von Heidegger gesprochen ist Verdinglichung grundsätzlich betrachtet ein Existenzial, also ein unvermeidlicher Aspekt menschlichen Lebens. Wir sind umgeben von Verdinglichungen des Seelischen und des Sozialen. Gefühle und Einstellungen, ökonomische und organisatorische Strukturen müssen zum Beispiel objektiv erforscht und begrifflich auf den Punkt gebracht werden. Wenn aber Gefühle von Wirtschaftspsychologen renditeorientiert „gemanagt“ werden, wenn Menschen in ihrer Selbstliebe nur noch von ihren Leistungen abhängig sind, wenn körperliche Attraktivität im Vergleich zu Bildschirmschönheiten als geschrumpft erlebt wird und durch Botox und Implantate aufgepäppelt werden muss, wenn Arbeitskräfte nur noch als Humankapital betrachtet werden und Sozialkontakte als bloß nützliche Connections, dann wird etwas Menschliches zu einem Ding mit einem Wert und einem Preis, also zum Objekt, zum Gegenstand, zur Ware. Zum Problem wird Entfremdung und Verdinglichung also immer dann, wenn sich in etwas zutiefst Persönliches, wie eine intime Partnerschaft, ein soziales Engagement oder ein empathisches Sich-Einstimmen mit einem Menschen eine Intention einschleicht, in der die andere Person und damit im Grunde auch man selbst als bloßes Objekt betrachtet und behandelt wird. In der existenziellen Sichtweise ist dagegen alles, was in der Psychotherapie oder beim Coaching geschieht, intersubjektiv. Das bedeutet, dass wir alles, was wir vom Patienten zu wissen glauben und alles wovon wir glauben, dass es in einem mechanischen Sinn funktioniert, zunächst zurückstellen (Edmund Husserl spricht hier vom Einklammern, von der „Epoché“) und uns fragen: Wer ist dieser ganz besondere Mensch? Was erlebt er genau in diesem Moment? Was sind seine ganz persönlichen Ängste und Wünsche? Was scheut er wie der Teufel das Weihwasser? Wie wirkt diese einzigartige Person anders auf mich und in mir anders als jeder andere Mensch? Was bewirkt er in meiner eigenen Seele? Wie wirke ich als Person auf ihn und in ihm? Was stellen wir zwischen uns her, und was erschaffen wir hier und jetzt miteinander? Auf diese Fragen gibt es keine abschließenden Antworten, aber aus ihnen kann eine kooperative Auseinandersetzung mit den Themen des Klienten entstehen, eine dialektische Bewegung, ein kreativer Dialog, in dem dann auch wieder theoretische Konzepte und erprobte Techniken eingesetzt werden können. Das dynamische Gleichgewicht zwischen unmittelbarem und gegenseitigen emotionalen Berühren und Bewegtwerden als Personen einerseits und der reflektierenden Distanz vor dem Hintergrund fundierten Fachwissens macht die Kunst jeder professionellen Arbeit mit dem Seelischen von Menschen aus. Wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, kommen sie unweigerlich dabei auch mit sich selbst in Kontakt und d.h. insbesondere mit ihren Gefühlen. Intersubjektive Beziehungen bestehen darin, dass jeder sich selbst mit dem anderen und den anderen in sich selbst spürt und erspürt. In der Psychotherapie sprechen wir heute von Emotionsfokussierung. Wir erleben den Kontakt mit Anderen im Kontakt mit uns selbst als emotionale Verbundenheit, als Resonanz, als Einschwingen und Mitschwingen mit vielerlei Ober- und Untertönen, die miteinander interagieren und pausenlos in Bewegung sind. Wir fühlen uns, wir fühlen mit dem anderen, wir fühlen uns ein, wir fühlen uns an, wir erfühlen und werden erfühlt – oder aber emotional verfehlt und als Mensch verkannt. Gefühle verbinden uns mit dem Körper, seinen Bedürfnissen und Grenzen. Unsere kreativen Intuitionen, aber auch unsere angst- und schamvollen Befürchtungen aufgrund von alten, zum Teil unbewussten Mustern werden uns gewahr als Gefühle. In der Arbeit mit dem Seelischen und dem Zwischenmenschlichen geht es immer um Gefühle. Was aber geschieht, wenn ein Mensch, Kind oder erwachsenen, unter dem Druck steht, seine Lebendigkeit, sein authentisches Erleben verleugnen, verdrehen oder unterdrücken zu müssen, um liebevolle Zuwendung oder Anerkennung zu erhalten? Mit einem Begriff des englischen Kinderpsychoanalytikers Donald Winnicott entsteht auf diese Weise durch Überanpassung ein falsches, also entfremdetes Selbst, eine Identifikation mit Normen und Vorstellungen, die dem eigenen Wesen nicht entsprechen. Eine in unserer Kultur verbreitete Form des falschen Selbst ist die narzisstische Persönlichkeit, die am differenziertesten von dem Psychoanalytiker Heinz Kohut untersucht wurde. Die Art, wie Narzissten nach außen auftreten, ihre Ichsucht, ihre Selbstverliebtheit und Image-Besessenheit kann als faszinierend oder als abstoßend empfunden werden und manchmal als beides zugleich. Ebenso empfindet man narzisstische Anteile in der eigenen Seele, die wohl niemandem, der sich ein wenig mit sich beschäftigt hat, fremd sind. Sie lösen bei anderen oft Neid und Verachtung zugleich aus. Daher wird der Begriff Narzissmus häufig als Schimpfwort, also im Grunde selbst aus einer narzisstischen Perspektive heraus gebraucht. Die zunehmende Förderung anpreisender Selbstausstellung und Eigenwerbung in Online-Profilen, WhatsApp-Selfies, in Casting-Shows und Bewerbungsgesprächen, in der Wahlwerbung und in sich wissenschaftlich nennenden Debatten führt dazu, dass derjenige, der besser blufft, sich mehr aufbrezelt, sich aufbläht oder den Gegner effektiver verbal niederwalzt, sozial nach oben steigt, während der Bedächtige, Reflektierte, der auch bereit ist, Einwände ernst zu nehmen, und sich eigenen Unsicherheiten zu stellen, oft im Getöse untergeht. Menschen mit aktivierter narzisstischer Dynamik sind süchtig nach Applaus, Bewunderung und Beifall. Sie scheuen partnerschaftliche emotionale Bindungen, leiden unter innerer Leere und diffusen Ängsten vor Kontrollverlust. Ihr Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl ist abhängig von aufwertenden Rückmeldungen anderer. Bleiben diese aus, kollabiert ihr Selbstwertgefühl, und sie fühlen sich in ihrer schieren Berechtigung zur Existenz infrage gestellt. Ihre Abhängigkeit von endlosem Anhimmeln macht narzisstische Menschen zu Spiegel-Sklaven. Ihr Problem ist aber nicht eigentlich ihre Gier nach Aufwertung und ihre Angst vor Abwertung, sondern die Bewertung an sich: die Bewertung als Mensch, ihrer Erscheinung, ihrer Seele, ihres Körpers, ihrer Eigenschaften und Eigenheiten. Wenn persönliche Wirkung, Anziehungskraft, Ausstrahlung, Kommunikationsfähigkeit, Intelligenz oder Eloquenz „geratet“, also in ein skalierendes Mehr oder Weniger einsortiert werden, dann wird der Mensch zum bewerteten Ding, also verdinglicht, zur Ware, und er erlebt sich selbst als solche. Das kann einen Narzissten stark oder schwach machen, je nachdem, wie er ankommt. Daher ist seine emotionale Stabilität von seiner äußeren Performance abhängig, und durch Mangel an Erfolg jederzeit irritierbar. Die Tragik der narzisstischen Dynamik besteht in einer inneren Verdopplung zwischen Aufgeblasenenheit und Geschrumpftheit, mit Kohuts Begriffen zwischen Größenselbst und entwertetem Selbst. In dieser Verdopplung, die in der Psychoanalyse als Spaltung bezeichnet wird, erlebt ein narzisstischer Mensch auch seine Umwelt, die für ihn bevölkert ist mit überlegenen Gurus und Mäzenen, denen gegenüber er sich verkrötet, also minderwertig und unansehnlich fühlt und unterlegenem Fußvolk, auf das er hinabschaut, und das für ihn nur insofern interessant ist, als es ihn hofiert und bewundert. Narzisstische Menschen hat es schon immer gegeben. Aber durch den schleichend immer weiter um sich greifenden Druck in Richtung Bewertung und Selbstbewertung an Universitäten, Schulen und Kinderstuben sind narzisstische Muster heute derart verbreitet, dass wir sie meistens gar nicht mehr wahrnehmen, weshalb Christopher Lasch bereits 1979 von einem Zeitalter des Narzissmus sprach. Und für bestimmte Funktionsrollen in unserer Gesellschaft wie Popstar, Talkshowteilnehmer oder Wahlkämpfer sind narzisstische Selbstdarsteller sogar optimal angepasst. Ein gesunder Narzissmus im positiven Sinn, also ein liebevolles Verhältnis zu sich selbst und zu anderen, ein stabiles Selbstwertgefühl, intrinsische, also an Werten orientierte Motivationen, eine gute soziale Verwurzelung und ein respektvolles Verhältnis zu den eigenen Bedürfnissen und Grenzen sind zentrale Voraussetzungen psychischer Gesundheit und sozialer Kompetenz, auch und ganz besonders für Leitungskräfte sowie für Psychotherapeuten und Berater. Eine gewisse Power, Durchsetzungsfähigkeit, persönliche Präsenz und Standfestigkeit ist unabdingbar für Menschen in leitenden Positionen und auch für diejenigen, die sie und ihre Betriebe und Organisationen beraten. Die neoliberale Ökonomie und Sozialstruktur bringt jedoch Menschen hervor, deren Selbstwert ihnen alles bedeutet. Bei ihnen wird psychische Stabilität zu Pseudostabilität, Power zu Aufgedrehtheit, Präsenz zu Exhibitionismus und Verantwortungsübernahme zu Machtbesessenheit. Je mehr die Selbstwertregulation ins Pathologische abdriftet, umso mehr sehen wir Menschen, die mächtig und zerbrechlich zugleich und daher sehr krisenanfällig sind. Als Paradebeispiel einer – man kann es nicht anders sagen – pathologisch narzisstischen Dynamik sehen wir den rassistischen Horrorclown Donald Trump, der sich öffentlich an seiner vermeintlichen Großartigkeit berauscht und alles zu entwerten, ja zu vernichten bereit ist, was ihm fremd ist oder ihm im Wege steht. Daneben seine bloß papageienhaft mitagierende Model-Frau Melania, der Inbegriff einer Co-Narzisstin, deren einzige Funktion es ist, ihn, den blinden Autokraten, wie eine hübsche Krawattennadel zu schmücken und seine Dominanz hervorzuheben. Gefährlich wird der Narzisst dann, wenn sein Selbstwertgefühl nach endloser Aufblähung vielleicht schon durch einen Nadelstich platzt und er bereits nach einer nur gefühlten Kränkung seines Selbstwertgefühls zu gnadenloser Zerstörung übergeht. Diese Dynamik wird als maligner, d.h. bösartiger Narzissmus bezeichnet. Das ist die sozialpsychologische Definition einer globalen Gefahr, die gerade dabei ist, das noch-liberale Kern-Europa regelrecht zu umzingeln. Ein Mensch, der sich im positiven Sinn selbst liebt, respektiert auch seine Mitmenschen, seine Mitarbeiter, Untergebenen und Vorgesetzten, die Menschen die ihm nahestehen, seine Familie, seine Freunde und Nachbarn. Die Stabilität seines Selbstbewusstseins und die Sicherheit seines Auftretens gründet sich auf innere Ausgeglichenheit. Er hat es nicht nötig, „aufzutrumpen“, sondern er wirkt warmherzig. Er muss seine menschlichen Grenzen und Schwächen nicht verschleiern, selbst dann, wenn er manchmal deutliche Worte sagen oder klare Entscheidungen treffen muss. Die neoliberale Ökonomie und Politik hat für breite Schichten in den kapitalstarken Nationen, (teilweise entgegen ihrer eigenen Selbstwahrnehmung) jahrzehntelangen Frieden, ökonomische Sicherheit, soziale Freiheit und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung geschaffen, die es in dieser relativen Breite in der Geschichte wohl noch nie gegeben hat. Allerdings basiert diese Stabilität auf einer weltweiten Blasenökonomie, die zwar nicht psychologisierend als Folge, aber durchaus als globalökonomische Entsprechung der narzisstischen Aufblähung ihrer Funktionsträger verstanden werden kann. Ob wir das sehen, wollen und gutheißen oder nicht, auch wir Psychotherapeuten, Berater, Coaches und Personal- und Organisationsentwickler sind unweigerlich auch Erfüllungsgehilfen der Schaffung und Verwertung von Humankapital, zugleich aber mögliche, und manchmal einzig erreichbare Rettungsinseln, Orte der Reflexion und möglicher Positionsfindung in den Strudeln der entfesselten Leistungsgesellschaft. Psychotherapie kann nicht nur störende Symptome wegräumen, um die Patienten wieder arbeitsfähig zu machen, sondern auch zur existenziellen Reflexion einladen: Wofür lebe ich eigentlich? Wo stehe ich in dieser Welt, und wofür stehe ich ein? Coaches und Personalentwickler können zur Humanisierung der Arbeitswelt beitragen und ein Stück mehr Menschlichkeit in die Betriebe bringen. Das können Beiträge zur Gestaltung einer menschenwürdigen Welt sein, auf die wir einmal mit begründetem Stolz zurückblicken können, wenn wir spüren, dass unsere Lebenszeit langsam abläuft. Die ungeahnten Möglichkeiten der Globalisierung, die in vergangenen Jahrhunderten noch nicht einmal den Reichsten und Mächtigsten zur Verfügung gestanden hätten, bringen als ihre Kehrseite ein Gefühl der Heimatlosigkeit mit sich. Wenn alles möglich ist – wer bin ich dann? Wo gehöre ich hin? Was ist richtig und sinnvoll für mich und was nicht? Das betrifft den Beruf, die sexuelle Orientierung, den Umgang mit persönlicher Nähe und Grenzen, den Ort an dem man lebt und die eigene Weltanschauung, die mehr und mehr zu einem beliebig auswechselbaren Konstrukt oder – als Gegenregulation –zu einem rigide abgeschotteten Gedankengefängnis wird. Als Produkt der Deregulierung, die Vermarktungsgesetze ungehindert in die Köpfe schon der Kinder träufelt, wird die Ausübung von äußerem Zwang um grenzenlose Leistungsbereitschaft zu bewirken mehr und mehr überflüssig, weil der dringende Wunsch verinnerlicht wird, mehr, besser und schneller zu sein als alle anderen (und damit zugleich mehr, besser und schneller als man selbst überhaupt sein kann). Den als Eigenmotivation verinnerlichten Leistungswahn als Schattenseite postmoderner Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, der vermutlich in der Arbeit mit Führungskräften besonders häufig anzutreffen ist, hat Byung-Chul Han eindrücklich unter dem Begriff Selbstoptimierungszwang analysiert. Der Mangel an Muße, an Zeit zum Verweilen, zur Regeneration von Körper und Seele, im Grunde der Mangel an Zeit zu leben führt zu der drastischen Zunahme an Burnout-Symptomen und Erschöpfungsdepressionen, auf die die Statistiken der Krankenkassen hinweisen. Wie in der „Zeit“ vom letzten Mittwoch nachzulesen ist, sind laut einer repräsentativen Umfrage bereits ein Drittel aller Führungskräfte abhängig von schwer suchterzeugenden Schlafmitteln um überhaupt noch zur Ruhe kommen zu können. Tragischerweise trifft die Burnout-Erschöpfung, die Ermüdung aus Selbstüberforderung am ehesten die Leidenschaftlichen, die mit dem Herzen bei der Sache sind, die brennen für ihre Tätigkeit und daher die ersten sind, die aus Mangel an sozialem Rückhalt und an alltagspraktischer Regeneration ausbrennen und manchmal für immer verlöschen. Burnout und Erschöpfung kann nicht als rein individuelles Phänomen verstanden werden. Zunehmende Sparmaßnahmen, vor allem im Bildungs- und Sozialbereich, eine überbordende, immer sinnfreier werdende Bürokratie, die entgrenzte Datensammelwut und die papierenen Folterinstrumente der sogenannten Qualitätssicherung nehmen gerade den Begeisterten die Freude an ihrer Arbeit. Wer immer weniger einzusehen vermag, warum er einen Großteil seiner Arbeitszeit zur Selbstverwaltung und Selbstüberwachung verwenden muss, für den droht der Sinnverlust und damit ein Austrocknen seiner Motivation. Wenn die ersten Spuren von Zynismus gepaart mit Kraft- und Lustlosigkeit schon spürbar waren und dann eine Gratifikationskrise dazukommt, also das Gefühl: Wo bleibe ich hier eigentlich? Wer ist eigentlich mal für mich da? … dann schlägt der Burnout manchmal über Nacht zu, und die Frühverrentung aus psychischen Gründen ist nicht mehr weit. Was ein Mensch mit einer instabilen oder pseudo-rigiden Selbststruktur professionell braucht, ist einen Psychotherapeuten oder Berater, der sich in der Dialektik zwischen Empathie und Selbstempathie auf der einen Seite, kritischer und selbstkritischer Auseinandersetzung auf der anderen Seite konstruktiv zu bewegen vermag. Ein reines empathisches Bekräftigen einer teilweise deformierten Identität kann leicht dazu führen, gleichsam dem Affen Zucker zu geben, also selbstschädigende oder sozial destruktive Tendenzen zu stabilisieren oder gar zu verstärken. Eine zu früh oder zu penetrant angesetzte Auseinandersetzung oder Herausforderung einer leidvoll instabilen Selbststruktur dagegen kann zu einer Überforderung oder gar zu einem Kollaps der Selbstregulationsfähigkeiten des Klienten führen. Die produktive Handhabung der Dialektik zwischen Einfühlung und Auseinandersetzung macht den Kern eines konstruktiven psychotherapeutischen oder Coaching-Prozesses aus. In einem hermeneutischen, also verstehenden Prozess der Psychotherapie oder Beratung bemüht sich der Berater, sich auch in diejenigen Anteile und Ebenen des Erlebens oder Noch-Nicht-Erlebens des Klienten einzufühlen und hineinzudenken, die diesem selbst nur vage, indirekt, verzerrt oder in Form von Vermeidungen oder psychischen schwarzen Löchern bewusst sind. Er bietet ihm Begriffe und Metaphern an, die den Klienten anregen, Worte oder Symbole für Anteile und Motive zu finden, die zunächst noch sprachlos sind und daher manchmal blind agiert oder auch somatisiert werden. Der Therapeut oder Berater kann das nur leisten, indem er sich seiner eigenen Gefühlsreaktionen, Fantasien und Intuitionen in Resonanz mit dem Klienten gewahr ist, sie unablässig beachtet, auslotet, reflektiert, einordnet und nutzt. Dafür ist differenziertes Fachwissen unabdingbar. Letztlich aber kann nur ein einfühlendes und mitfühlendes Subjekt ein anderes Subjekt und die Beziehungen zwischen Subjekten verstehen. Alle Begriffe, alle Formulierungen und benannten Zusammenhänge sind immer nur vorläufig, in Bewegung und in sozialer und biografischer Veränderung. Der dialektische Gegenpol zum Verstehen ist die Auseinandersetzung mit dem Klienten, das kritische Sich-Reiben mit seinen Mustern und Themen, das oft mühsame gemeinsame Aufbereiten und Durchkauen seiner Fragen und das manchmal auch konfrontative und selbstkonfrontative Infragestellen von Anschauungen oder Werthaltungen, die zu Entwicklungsblockaden oder zur Aufrechterhaltung von psychischem Leid beitragen. Dieses Sich-Miteinander-Auseinandersetzen ist nicht leicht und nicht immer angenehm. Es wird daher gerne vermieden, durch nur-bestätigende Empathie oder bloßen Zuspruch ersetzt oder durch nur-technische Interventionen zu hantieren versucht. Dennoch bietet die intensive, von Mitgefühl und Unterstützungswillen getragene Bereitschaft zur Auseinandersetzung einzigartige Möglichkeiten zum Miteinander-Wachsen, sowohl im Therapie- und Beratungskontext als auch in persönlichen Beziehungen. In der Seelenarbeit dient Auseinandersetzung einzig und allein der Linderung des psychischen Leids des Klienten durch psychosoziales Wachstum. Zu diesem Zweck müssen sich Klient und Berater auch mit Überzeugungen und Einstellungen auseinandersetzen, die der Klient als Teil seines eigenen Wesens empfindet und die er daher zunächst instinktiv verteidigt. Diese Muster müssen wahrgenommen, gefühlt und verstanden, akzeptiert, verbalisiert und in ihrer Funktion anerkannt werden, um es dem Klienten überhaupt erst zu ermöglichen, sich von Ihnen bei Bedarf auch innerlich abzugrenzen, so dass er alten Verstrickungen nicht weiter blind folgen muss, sondern eine Wahlfreiheit gewinnt, indem er selbst definiert, wer er ist und wofür er steht und lebt. Das innere wie das äußere Andere, das Fremde, das Nicht-Wie-Ich erscheint uns in unser eigenen Seele, in persönlichen Beziehungen, am Arbeitsplatz und in der sozialen Welt als Grenze, als Angst, als Erstaunen und Herausforderung, als Sehnsucht und Begehren, als Freude und Überraschung. In der Auseinandersetzung mit innerem oder äußerem Zunächst-Fremden erkennen wir, dass wir manches verstehen und integrieren können, anderes anzuerkennen bereit sind oder akzeptieren müssen, manches trotz allem Bemühen nicht verstehen und einiges als inakzeptabel empfinden und uns daher davon distanzieren müssen. Eine humanistische, dialogische Grundhaltung ist leicht zu behaupten oder zu propagieren, sie aber in der alltäglichen Praxis tatsächlich zu praktizieren, ist eine spannende Herausforderung, an der man immer wieder auch kreativ scheitert, die daher unablässig reflektiert und weiterentwickelt werden kann und muss. Empathie, Selbstempathie und Auseinandersetzung können im Rahmen praktisch jeder psychotherapeutischen oder Coaching-Arbeitsweise realisiert – oder auch verfehlt werden und sind de facto immer mehr oder weniger präsent. Sie äußern sich in Themen, Inhalten und Interaktionen, aber auch nonverbal und subtil, in Form psychovegetativer Resonanzprozesse durch affektives Einschwingen oder emotionale Irritation und in der Fortentwicklung miteinander erzeugter dialogischer Narrative. Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund eines zeitkritischen Verständnisses der psychischen Folgen des digitalisierten Neoliberalismus kann Psychotherapie und Coaching als eine Form der Mikropolitik verstanden werden, die unweigerlich mit Phänomenen der Entfremdung, Beschleunigung, Verdinglichung und des Selbstoptimierungszwangs konfrontiert ist, und durch die Förderung von Resonanz, Empathie, Selbstbestimmung und Anerkennung zur produktiven Auseinandersetzung mit den psychosozialen Verwerfungen der postmodernen Welt beitragen kann. Es muss Gefühl und Subjekt in die Arbeit, dann ist das Leben voller Überraschungen! Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Ruanda, das Land der tausend Hügel gut 20 Jahre nach dem Genozid
Ziel des Genozids war es, die Tutsi-Bevölkerung im Land auszurotten. Auch die Zivilbevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich an den Morden zu beteiligen. Nachbarn brachten einander um, Frauen wurden vergewaltigt, Kinder getötet. Dem Genozid fielen innerhalb von nur 100 Tagen rund 1 Million Menschen zum Opfer. Rund 75% der Tutsi-Minderheit wurden in dem Massaker umgebracht. Unvorstellbare Gräueltaten wurden begangen, Infrastruktur und Sozialstruktur des Landes wurden zerstört.Susanne Lehner diskutiert mit ihren Gästen über die Ursachen des Genozids, dessen Rolle und Aufarbeitung, die Entwicklungen der letzten 20 Jahre und die Bedingungen und Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda.Moderation und Sendungsgestaltung: Susanne Lehner (für den Sendungsinhalt verantwortlich)Gäste:Mag. Robert Burtscher, Fachreferent für Wasser und Siedlungshygiene bei der Austrian Development Agency (ADA)Gabriel Müller, Director of International Alliances bei Licht für die WeltDr. Jan Pospisil, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Internationale Politik (OIIP) und Dozent am Institut für Politikwissenschaften/Universität WienSendetermin: Freitag, 17.07.2015, 20:00-21.00 UhrMusik: Wheelin‘ Guitar - Flux Bikes; 1. Lale Lale – Imperial Tiger Orchestra; Mourning Song – Olima Anditi; Yedao – Imperial Tiger Orchestra; Mama Africa – UFO Nachzuhören auf Free Music Archive (FMA), einer Community für freie, legale und unlimitierte Musik, die unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht wurde.
Wir Künstler unserer Körper - Dr. Christian Steuerwald im Gespräch
Dr. Christian Steuerwald, der derzeit im Sommersemester 2012 die Professur für Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit (Vakanz Stefan Hradil) am Institut für Soziologie der Universität Mainz vertritt, unterhält sich mit Dr. Udo Thiedeke über die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft in unsere Körper einschreibt, wie dabei soziale Ungleichheiten zum Ausdruck kommen und warum wir als "Künstler unserer Körper" von biologischen und gesellschaftlichen Anforderungen herausgefordert sind. Shownotes #00:01:04# Steuerwald, Christian 2011: Wer bin ich? Soziologische Antworten und künstlerische Übersetzungen. In: Schader Stiftung, Hessisches Landesmuseum (Hrsg.): Ansichten des Ich. Bilder gesellschaftlichen Wandels 10. Ausstellungskatalog. #00:05:12# Auch Erving Goffman geht davon aus, dass die Ich-Identität immer gesellschaftlich angelegt ist: Goffman, Erving 1975: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt: Suhrkamp. #00:05:45# Der Soziologe Emile Durkheim und der "Homo Duplex": Durkheim, Emile, 2002: Der Selbstmord. Dt. von Sebastian und Hanne Herkommer. 8. Aufl. Neuwied/Berlin: Luchterhand [Le suicide: Étude de sociologie. 1897, S. 237] #00:08:34# Zu Durkheims "sozialen Tatsachen" siehe hier: Emile Durkheim, 1976: Die Regeln der soziologischen Methode, hrsg. v. René König. 5. Aufl. Neuwied: Luchterhand. [Les règles de la méthode sociologique. 1985] #00:09:05# Zur Unterscheidung von "I" und "Me": Mead, George Herbert 1934: Mind, Self and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, hg. v. Morris, Charles W. Chicago: University of Chicago Press. #00:09:58# So vertritt etwa Ulrich Beck eine "Individualisierungsthese" gesellschaftlicher Strukturen: Beck, Ulrich 1983: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt: Sonderband 2. Göttingen. S. 35-74 #00:11:21# Eine der historischen Studie zu Parfum oder Körperpflegemitteln: Corbin, Alain 1996: Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs. Berlin: Wagenbach. #00:12:13# Marcel Mauss hat etwa gezeigt, wie natürliche Bewegungsabläufe sozial bedingt sind: Mauss, Marcel 1989: Die Techniken des Körpers. In: ders.: Soziologie und Anthropologie 2. Frankfurt: Fischer. #00:12:20# Das Thema von Christian Steuerwald: Steuerwald, Christian 2010: Körper und soziale Ungleichheit. Eine handlungssoziologische Untersuchung im Anschluss an Pierre Bourdieu und George Herbert Mead. Konstanz: UVK. #00:17:05# Nach Simmel ist Mode immer "Klassenmode", die sich von 'oben' nach 'unten' (trickle down) durch Nachahmung verbreitet: Simmel, Georg 1911: Die Mode in: ders., Philosophische Kultur. Gesammelte Essais, Leipzig: Alfred Kröner Verlag. S. 29-64 [ursprünglich 1905 Philosophie der Mode] #00:17:38# Reinhard macht sich Gedanken über die Sauberkeit der Epochen: Reinhard, Wolfgang 2004: Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie. München: C.H. Beck. #00:19:55# Zum Miasma, der alles anstreckenden 'schlechten Luft' #00:20:25# Zum 'körperlichen Territorium' macht sich Erving Goffman Gedanken: Goffman, Erving 1974: Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. Frankfurt: Suhrkamp. #00:21:03# Die Krinoline ist allerdings eher eine Reifrockmode des 19. Jahrhunderts. Weiteres zur Reifrockmode #00:23:30# Anregend zum Wandel der Schönheitsideale: Eco, Umberto 2004: Die Geschichte der Schönheit. München, Wien: Hanser #00:25:11# Mit "irgendwo in Asien" waren etwa die Baruya in Neuguinea gemeint. #00:25:43# Gemeint ist die Schönheitskonkurrenz der Wodaabe-Männer im Niger #00:36:54# Hier zeigt Bourdieu, wie man Aufsteiger an ihrem Körper erkennt: Bourdieu, Pierre 1999: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. #00:40:59# Zu Goffmans Unterscheidung von "Vorder-" und "Hinterbühne" des Rollenverhaltens: Goffman, Erving 1997: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München, Zürich: Piper. #00:44:10# Wer mehr wissen möchte zum sog. Arschgeweih #00:45:00# Wer mehr wissen möchte zum Korsett, das zur "Wespentaille" führt; ebenso: Heszkey, Max 1925: Die Kulturgeschichte des Korsetts von ihren Uranfängen in den Römerzeiten bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts. Berlin: Carl Hause #00:45:50# Sichtweisen der Körpersoziologie finden sich etwa hier: Schroer, Markus 2005(Hrsg.): Soziologie des Körpers. Frankfurt/M.: Suhrkamp. #00:50:33# Max Weber macht sich Gedanken über das Gehör anderer Völker: Weber Max 1986: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Band 1. 8. Aufl. Tübingen: Mohr S. 17. [1920] #00:51:36# Hier findet sich ein guter alter Punk-Klassiker der Sex Pistols: God save the Queen #00:52:42# Zum drei Sekunden dauernden "Gegenwartsspeicher" des Gehirns: Pöppel, Ernst 1989: Eine neurophysiologische Definition des Zustands 'bewußt'. In: ders. (Hrsg.): Gehirn und Bewußtsein. Weinheim: VCH. S. 17-33. #00:53:53# Zum Einschreiben der Gesellschaft in die Körper: Foucault, Michel 2003: Die Machtverhältnisse gehen in das Innere des Körpers über. In: ders.: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band 3. Frankfurt: Suhrkamp. S. 298-308 #00:54:05# Zum Konzept der Epigenetik: Jablonka, Eva, Lamb, Marion J. 2002: The Changing Concept of Epigenetics. In: Annals of the New York Academy of Sciences Vol. 981, S. 82-96. Online #00:56:01# Zur Diskussion von Foucaults Diskursbegriff siehe z.B.: Wrana, Daniel, Langer, Antje 2007: An den Rändern der Diskurse. Jenseits der Unterscheidung diskursiver und nicht-diskursiver Praktiken. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 8(2), Art. 20. Online #00:56:58# Zum Konzept der Geste bei Georg Herbert Mead: Mead, George Herbert 1934: Mind, Self and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, hg. v. Morris, Charles W. Chicago: University of Chicago Press. S. 47 #00:59:31# Zu den "Territorien des Selbst": Goffman, Erving 1974: Die Territorien des Selbst. In: ders.: Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. Frankfurt/ M.: Suhrkamp #01:01:20# Zur Entwicklung anthropmetrischer Dimensionen wie der Körpergrösse: Komlos, John 1993: Über die Bedeutung der Anthropometrischen Geschichte. In: Historical Social Research, 18/3, S. 4-21. #01:05:40# Zur Problematik der Neutralisierung und Reaktualisierung von Geschlecht in der modernen Gesellschaft: Tacke, Veronika 2008: Neutralisierung, Aktualisierung, Invisibilisierung. Zur Relevanz von Geschlecht in Systemen und Netzwerken. In: Wilz, Sylvia Marlene (Hrsg.): Geschlechterdifferenz - Geschlechterdifferenzierung. Ein Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen und theotretische Positionen. Wiesbaden: VS. S. 253-289. Online #01:07:46# Und so geht es aus soziologischer Perspektive im Fahrstuhl zu: Hirschauer, Stefan 1999: Die Praxis der Fremdheit und die Minimierung von Anwesenheit. Eine Fahrstuhlfahrt. Soziale Welt 50/3. S. 221 - 246 Online #01:08:40# In seiner Theorie des Zivilisationsprozesses legt Elias anschaulich die Zurücknahme des Körpers dar: Elias, Norbert 1998: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Band 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Frankfurt: Suhrkamp. #01:10:35# Zur individualmedialen Kommunikation: Thiedeke, Udo 2012: Soziologie der Kommunikationsmedien. Medien - Formen - Erwartungen. Wiesbaden: Springer VS. S. 159ff. #01:11:40# So schön kann man sein nach dem "Photoshoppen" #01:12:45# Zum tatsächlichen Umgang von Jugendlichen mit ihrer Privatsphäre im Netz: Boyd, Danah, Marwick Alice 2011: Social Privacy in Networked Publics: Teens’ Attitudes, Practices, and Strategies. Paper to be presented at Oxford Internet Institute’s “A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society” on September 22, 2011. Online [alle Links aktuell Juni/Juli 2012] Dauer 01:15:15 Folge direkt herunterladen