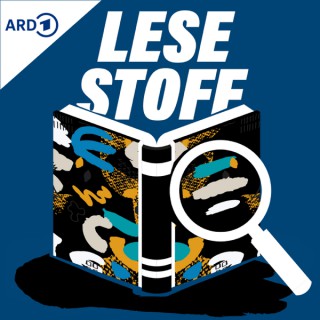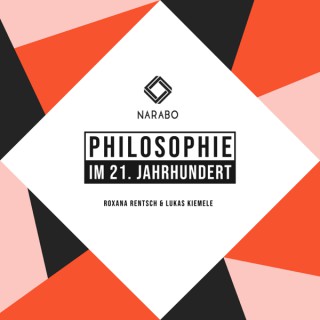Podcasts about zeitlichkeit
- 30PODCASTS
- 40EPISODES
- 43mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 5, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about zeitlichkeit
Latest podcast episodes about zeitlichkeit
Splitter, Schnipsel, Snaps und Shots – Fragmente begegnen uns im Alltag in vielen Gestalten und Kontexten. Kuratorin Sophia Nava spricht mit der Künstlerin Sara Masüger über Leerstellen im Schaffensprozess, Bruchstücke und über die Zeitlichkeit in Kunstwerken. Die Ausstellung «Fragmente. Vom Suchen, Finden und Zeigen des Unvollständigen» ist vom 06.09.2025 – 04.01.2026 im Bündner Kunstmuseum zu sehen.
Allein unterschiedliche Kalendersystem zeigen es schon: Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Zeitlichkeiten. Unterschiedliche Kulturen und Kollektive haben unterschiedliche Zeitvorstellungen. Wir haben heute einen Gast, der sich schon lange mit Zeittheorien und Zeitlichkeiten auseinandersetzt: Achim Landwehr. Explizit sprechen wir mit ihm über sein neues Buch Zeiten haben. In dem er sich speziell mit Zeiten und Zeitlichkeiten im Kontext der Klimakrise und des Anthropozän und der aktuellen Polykrisen auseinandersetzt.Wir sprechen darüber wie viel immaterielles in Form von Zeiten in einer Plastikflasche steckt undMit der Industriemoderne geht ein dominierendes Konzept von Zeitlichkeit einher. Aber wir brauchen ein anderes nur wissen nicht welches und wie das gehen soll. Aber klar ist: Wenn wir sehen wir machen Zeiten, dann können wir sie auch anders machen.Literatur & Quellen:Chakrabarty, Dipesh: The Climate of History in a Planetary Age, Chicago 2021.Feichtner, Isabel: Bodenschätze. Über Verwertung und Vergesellschaftung, Hamburg 2025.Hartog François: Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York 2015.Koselleck, Reinhart: Zeitschichten Studien zur Historik, Frankfurt am Main 2003.Landwehr, Achim: Historische Diskursanalyse (Historische Einführungen, Bd. 4), Frankfurt am Main 2018.Landwehr, Achim: Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Fischer, 2016.Landwehr, Achim: Zeiten haben. Klimakrise und Endlichkeit. Campus, 2025.Laxness, Halldor: Sein eigener Herr, Göttingen 2018.Maß, Sandra: Zukünftige Vergangenheiten. Geschichte schreiben im Anthropozän, Göttingen 2024.Tomkins, Calvin: Duchamp, New York 1998.
Der Titel der heutigen Episode ist »Zeitlos«. Wie komme ich darauf? Die Motivation für diese kurze Episode der Reflexion ist eine Reihe von Tweets. Der erste war von Axel Bojanowski, dem — wie ich meine — führenden Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Er schreibt: »Der mit Abstand beste deutsche Wissenschaftspodcast ist Zukunft Denken« Natürlich freut mich eine solche Empfehlung aus derartig berufenem Munde ganz besonders. Es spornt auch an, weiter hart an diesem Projekt zu arbeiten. Es gab dann aber noch eine Reaktion eines Hörers, der den Aspekt der Zeitlosigkeit der Episoden betont hat. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Der erste Aspekt von Zeit ist ein eher banaler, aber einer, auf den ich gerne kurz eingehen möchte. Ich bekomme immer wieder Zuschriften, wo sich Hörer öfter neue Folgen wünschen. Warum das schwierig ist, erkläre ich in aller Kürze. Dann aber zu weiteren Aspekten der Zeitlosigkeit, die eher inhaltlicher Natur sind, denn dieser Kommentar hat mich zum Nachdenken gebracht zumal es einige Überschneidungen zu vorigen Episoden gibt. Was hat etwas das Zitat von Gerd Gigerenzer aus Episode 122 »Je größer die Unsicherheit ist, desto mehr Informationen muss man ignorieren.« mit dem Zitat von Stafford Beer aus Episode 121 gemein? »Information and Action are one and the same thing« Zur Dimension der Informationsdichte kommt noch die Dimension der Zeit auf eine sehr interessante Weise hinzu. Je Größer die Unsicherheit, desto wichtiger ist also nicht nur die Auswahl der Parameter, der Daten, sondern auch die richtige Zeitlichkeit im Umgang mit dem Problem. Was bedeutet dies für News? Für den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit komplexen Problemen? »Die relevanten Information entstehen Wochen, Monate, bei aktivistischen Großereignissen wie etwa Covid auch Jahre später. Diese geht dann aber im Lärm des nächsten Events unter.« Fortschritt und Entschleunigung haben aber eine durchaus interessante Gemeinsamkeit, wir Herfried Münkler bemerkt: “...Chance des Reflexionsgewinns durch Entschleunigung: Man kann die Bedeutung beim Treffen von Entscheidungen über größere Zeitspannen zu verfügen kaum überschätzen. und diese Zeitspannengewinn hängt nun einmal am Übergang vom mündlichen zum schriftlichen.” […] »Man konnte nunmehr sehr viel komplexere Fragen zum Gegenstand von Beratungen machen, als das in den direkten partizipatorischen Formen der Antike möglich war. Und man konnte Herausforderungen und Probleme in längerfristigen Perspektiven ins Auge fassen.« Sind wir immer am Puls der Zeit? Oder sind wir eher am Puls des Rauschens? Warum gibt es keine Wissenschafts-News und warum ist es gerade in komplexen Zeiten wichtig, Abstand von schnellen Medien zu halten? Warum sind Bücher gerade in schnellen Zeiten von besonderer Bedeutung? Wie kann man die Welt in Schichten verschiedener Geschwindigkeiten begreifen? Stewart Brand bezeichnet dies als Pace Layering: »Build a thing too fast, and mistakes cascade. Build a thing at the right pace, and mistakes instruct. Build a thing too slow, and mistakes are forgotten, then endlessly repeated in the endless restarts. For instance, with infrastructure: Building a thing at the right pace steadily all the way to completion probably works best with: Continuity of control Protected and guided by continuity of oversight and Guided by continuously monitored undersight—from workers and early customers. Continuity is the key.« Was aber machen wir mit Systemen — um wieder auf Stafford Beer zurückzukommen — deren tatsächlicher Zweck sich vom deklarierten Zweck entfernt hat? Wir enden nochmals mit einem Zitat von Stewart Brand: »Fast learns, slow remembers. Fast proposes, slow disposes. Fast is discontinuous, slow is continuous. Fast and small instructs slow and big by accrued innovation and by occasional revolution. Slow and big controls small and fast by constraint and constancy. Fast gets all our attention, slow has all the power.« Was haben Sie mitgenommen? Schreiben Sie mir! Referenzen Podcast Umfrage — Bitte teilnehmen! Andere Episoden Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer Episode 121: Künstliche Unintelligenz Episode 119: Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten Episode 104: Aus Quantität wird Qualität Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2 Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion Episode 49: Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist Episode 47: Große Worte Episode 32: Überleben in der Datenflut – oder: warum das Buch wichtiger ist als je zuvor Fachliche Referenzen Tweet von Axel Bojanowski (2025) Herfried Münkler, Verkleinern und entschleunigen. Die Zukunft der Demokratie? ARD (2022) Stewart Brand, Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning (2018) Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They're Built, Penguin (1995)
Filipa Matos Wunderlich – Temporal Urban Design: Temporality and Place-rhythmanalysis, an Alternative to Urban Place Aesthetics
Informed by multiple disciplinary debates including critical theory, relativity theory and quantum physics, and musicology, Temporal Urban Design is a comprehensive new theory and methodological approach to the aesthetics of time and rhythm in the city. In this third episode of Time/Out, Filipa Matos Wunderlich shares her path to conceptualizing place-temporality and learning how to map and represent the performative aesthetic of time through rhythm in different built environments. Her thinking informs her new book published at the start of 2024, which invites urban designers and planners to think differently about urban places from a temporal perspective and refreshes the way we think about urban design and widens the framework for place design practice. Overall, it anchors the conversation on place-time, rhythm and rhythmanalysis, and offers urban designers a conceptual, analytical and practice framework. Finally, it assists with ways to communicate with others on time, and design for temporality and rhythm in urban space.Gestützt auf interdisziplinäre Diskurse aus der Kritischen Theorie, der Relativitäts- und Quantenphysik sowie der Musikwissenschaft, stellt Temporal Urban Design eine umfassende neue Theorie und methodische Herangehensweise an die Ästhetik von Zeit und Rhythmus in der Stadt dar. In dieser dritten Episode von Time/Out berichtet Filipa Matos Wunderlich von ihrem Weg zur Konzeptualisierung von Ortszeitlichkeit und davon, wie sie lernte, die performative Ästhetik von Zeit durch Rhythmus in unterschiedlichen gebauten Umgebungen zu kartieren und darzustellen. Ihre Überlegungen fließen in ihr neues Buch ein, das Anfang 2024 erschienen ist. Es lädt Stadtgestaltende und Planende dazu ein, urbane Orte aus einer zeitlichen Perspektive neu zu denken, und verleiht dem Urban Design frische Impulse, indem es den Rahmen für ortsbezogene Gestaltungspraxis erweitert. Insgesamt verankert es das Gespräch um Ort-Zeit, Rhythmus und Rhythmusanalyse und bietet Stadtgestaltenden ein konzeptuelles, analytisches und praxisorientiertes Rahmenwerk – als Unterstützung für die Kommunikation über Zeit sowie für die Gestaltung von Zeitlichkeit und Rhythmus im urbanen Raum.You can find the blog What/Next at www.planung-neu-denken.deSound pack credits: josefpres (https://freesound.org/people/josefpres/ )You can find this pack online at: https://freesound.org/people/josefpres/packs/36680/
"Hat die Geschichte überhaupt Zeit?" – Achim Landwehr ist 'Zu Gast bei L.I.S.A.'
"Hat die Geschichte überhaupt Zeit?" – Achim Landwehr ist 'Zu Gast bei L.I.S.A.' 04.01.2021 (Hördauer 60 Minuten) Raum und Zeit sind die zwei Achsen des Koordinatenssystems Geschichte. Der Mensch bewegt sich im Raum und erfährt Zeit. Doch aber was genau verstehen wir unter dem Begriff "Zeit"? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Was davon ist real, was vom Menschen konstruiert? Ist die Abfolge von Tag und Nacht oder von Winter, Frühling, Sommer und Herbst nur eine menschliche Erfindung oder gibt es etwas Unhintergehbares, das wir Zeit nennen und das vom Menschen unbeeinflusst ist? Und wenn Zeit menschengemacht ist, von welchen Menschen? Welche Zeitverständnisse dominieren die Welt? Und welche anderen gibt es noch? Mit diesen Fragen setzt sich der Frühneuzeithistoriker Prof. Dr. Achim Landwehr von der Universität Düsseldorf in seinem neuen Buch auseinander und wendet sie dabei auf die Geschichtsschreibung an. Sind wir alle gleichzeitig jetzt? Geschichtsschreibung unter den Bedingungen der Vielzeitigkeit. Die Geschichte - sie ist überall präsent. Seit mehr als zwei Jahrhunderten sind nicht nur westliche Gesellschaften gewohnt, in diesem Kollektivsingular zu denken und mit ihm zu leben. Dieser übermächtigen Gesamtheit alles Geschehen(d)en wird nicht nur eine umfassende Wirkmacht, sondern eine ebenso grundlegende Erklärungsfunktion zugeschrieben. Das paradoxe Ergebnis: Alles hat eine Geschichte, außer die Geschichte selbst. Spätestens jedoch seit sich die europäisch-westlich geprägte Geschichtswissenschaft mit ihrem sehr speziellen Begriff von Geschichte im Rahmen postkolonialer Diskussionen auch mit anderen Verständnissen von Zeitlichkeit und Veränderung konfrontiert sieht, wird deutlich, wie problematisch dieses Geschichtsverständnis ist. Allein, es mangelte an Alternativen. Mit dem zentralen Begriff der Chronoferenz wird in diesem Buch ein theoretischer wie auch in Einzelstudien erprobter Vorschlag für eine andere Art der Historiographie gemacht - ein Vorschlag, der die Fähigkeit des Menschen ernst nimmt, gleichzeitig in und mit unterschiedlichen Zeiten zu leben. Denn keine Gegenwart ist gleichzeitig mit sich selbst.»Jede Gegenwart hat die Eigenschaft, ungleichzeitig mit sich selbst zu sein, weil in ihr immer schon so viele andere Zeiten vorkommen.« Achim Landwehr Achim Landwehr, geb. 1968, ist Historiker und Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.Veröffentlichungen u. a.: Historische Diskursanalyse (2. aktualisierte Aufl. 2018); Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie (2016); Geburt der Gegenwart. Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert (2014). Georgios Chatzoudis absolvierte sein Studium der Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Anglistik an der Universität zu Köln. Im Rahmen eines DFG-Projekts namens "ACACIA" forschte er von 2001 bis 2004 über den Nationsbildungsprozess in Namibia. Nach seiner akademischen Tätigkeit arbeitete Chatzoudis als Journalist, unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk (WDR). Seit 2010 leitet er die Online-Redaktion der Gerda Henkel Stiftung und ist dort für das Wissenschaftsportal L.I.S.A. verantwortlich. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Nation und Nationalismus, Deutschlandpolitik sowie afrikanische Geschichte, insbesondere die Nationsbildung in Namibia. Chatzoudis' Expertise liegt im Bereich der Neueren Geschichte. Originalbeitrag bei L.I.S.A. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch diesen. Hörbahn on Stage - live im Pixel – Autor*innen im Gespräch - besuchen Sie uns! Realisation Uwe Kullnick
Hirn und Amir: Gestern, heute, übermorgen-Philosophieren über Zeit
Gestern, heute, übermorgen - Philosophieren über ZeitSpätestens seit Martin Heideggers Hauptwerk "Sein und Zeit" (1927) ist das Nachdenken über Zeitlichkeit ein wesentlicher philosophischer Gegenstand. Für Heidegger ist Zeit eine Kategorie über die das Sein überhaupt erst verstanden werden kann - und auf deren Grundlage Dinge in der Welt erst sinnhafte Bezüge zwischen einander ausbilden können. Der deutsche Philosoph Ludger Schwarte stellt aktuell in seinem Buch "Qualitäten der Freiheit. Demokratie für übermorgen" die Frage der Zeitlichkeit in Verbindung mit Freiheit und Demokratie. So attestiert er einen "Präsentismus", eine Fixierung auf die Gegenwart, der er eine "Futurität", also ein Denken und Handeln, das das Übermorgen im Blick hat, entgegen hält.Über Schwartes Thesen, Zeit und Zeitlichkeit, über gestern, heute und übermorgen treten Lisz Hirn und Fahim Amir in einen philosophischen Dialog. Eine Eigenproduktion des ORF, ausgestrahlt in der Svcience Arena am 23.12.2024.
"Ich bin nicht von der Zeitlichkeit" von Betty Paoli
Leidenschaftliche Liebesgedichte machten sie berühmt, als Journalistin schrieb sie auch scharfsinnige Literaturkritiken und Essays. "Ich bin nicht von der Zeitlichkeit" gibt Einblick in das bemerkenswerte Werk von Betty Paoli. Eine Rezension von Dorothea Breit. Von Dorothea Breit.
Ein langes, eigenständiges Leben steht oft im Widerspruch zu dem, was am Ende viele erwartet: die letzten Jahre im Altenheim. Hier treffen Bewohner*innen mit wenig verbleibender Lebenszeit auf Pflegekräfte, die unter hohem Zeitdruck arbeiten. Beide sind in den Ablauf des Betriebs eingezwängt. Hinter alltäglichen Gesprächen über das Wetter oder den Brotbelag offenbart sich die unausweichliche Vergänglichkeit des Lebens, die unaufhaltsam voranschreitet. „Fünf Flure, eine Stunde“ ist ein Wahrnehmungsspiel von Luise Voigt; alles ist echt und nicht echt zugleich. Am 20. Mai 2019 wurden in fünf Altenheimen zwischen 8 und 9 Uhr O-Töne aufgenommen. Diese wurden übereinandergelegt, transkribiert und von jungen Schauspieler*innen nachgespielt. Die Aufnahme fand in einem einzigen Take statt, ohne Schnitt und ohne vorproduzierte Musik oder Geräusche. Das Stück spiegelt die Hektik und die zwischenmenschliche Nähe im Pflegeheim wider und thematisiert die Zeitlichkeit des Lebens als ununterbrochenen „Take“. Regie: Luise Voigt Mit Lisa Charlotte Friederich, Philippe Ledun, Nele Niemeyer, Pirmin Sedlmeir und Anna Sonnenschein hr/SWR/Dlf Kultur 2020 | 54 Min. (Audio verfügbar bis 13.10.2025) Unser Hörspieltipp: „Unsere Seelen bei Nacht“. Eine einfühlsame Geschichte über das Älterwerden nach dem Roman von Kent Haruf : https://1.ard.de/unsere-seelen
#9: Die erfüllte Zeit - Videoserie zum Buch Initiation
Es gibt eine profane und eine heilige Zeit. Die Erfahrung einer anderen, verwandelten Zeitlichkeit ist etwas Großartiges auf dem Weg der Initiation. Mehr Infos findet ihr unter: https://autor-frank-krause.de/initiation.html. Dort könnt ihr sowohl das Buch als auch den Kurs dazu kaufen. HINWEIS: Podcast enthält Werbung. Podcastproduktion © Markus Herbert (https://www.mhview.de).
Lüthe und Lüthe über die Zukunft, die persönliche und gesellschaftliche...und die Frage nach der Zeit
Die dokumentarfilmwoche hamburg vom 23. bis 28. april / Zweites Studiogespräch
freie-radios.net (Radio Freies Sender Kombinat, Hamburg (FSK))
Wir sprechen zu "Dokumentierter Aktivismus & aktivistisches Filmen." Zugrunde gelegt sind die Filme ›Xaraasi Xanne – Crossing Voices‹, ›Operation Namibia‹ und ›Fasia – von trutzigen Frauen und einer Troubadora‹. Die Filme erzählen von emanzipatorischen Kämpfen von den 60ern bis in die 2000er zwischen Selbstorganisation, Supporter*innentum und Aktivismus. Bei aller Unterschiedlichkeit der politischen Milieus, Zeitlichkeiten und Erzählweisen spricht aus den Filmen der Geist des Internationalismus des 20. Jahrhunderts. Die Behauptung: Alle Menschen können gleichermaßen am Kampf gegen Kapitalismus und Ausbeutung partizipieren. Respondenzen von Onome Ekeh und Abdou-Rahime Diallo werden im Rahmen der Diskussionsveranstaltung (in englischer Sprache) gehört werden. Am Sonnabend, 27.4. um 11 Uhr im Festivalzentrum fux eG. Das Festivalzentrum befindet sich in der fux eG in Altona, Bodenstedtstrasse 16. Fortsetzung von https://www.freie-radios.net/128026. Operation Namibia Martin Paret, DE 2023, 93 min, engl. OmdtU Eine Gruppe weißer linker Aktivist*innen kauft 1976 in England ein Segelboot für eine mehrmonatige Überfahrt nach Namibia. Die Mission der jungen Crew: nichts weniger als eine gewaltfreie Revolution im Apartheidsystem des von Südafrika besetzten Landes anzustoßen. Mit an Bord sind 6.000 verbotene Bücher, viel Idealismus und Zeit. Anhand des Briefverkehrs der Crew mit den Organisationsbüros in Philadelphia und London erzählt der Film geschickt und humorvoll vom Verlauf und Scheitern des Versuchs von philanthropischem Aktivismus, Selbstorganisation und all ihren zwischenmenschlichen Grenzen. ›Operation Namibia‹ ist eine vielstimmige Odyssee zwischen Briefen, Fotos und Super8-Film, aus der nicht zuletzt der naive Glaube an internationale Solidarität der 70er-Jahre spricht. Fasia – von trutzigen Frauen und einer Troubadora Re Karen, BRD 1987, 84 min, dt. OF Erstaufführung der digitalisierten 4K-Version Fasia Jansen wird 1929 als uneheliche Tochter von Elli Jansen aus Hamburg-Rothenburgsort und dem liberianischen Generalkonsul Momulu Massaquoi geboren und wächst in der Familie ihrer Mutter auf. Während der NS-Zeit hat sie als Afrodeutsche keinen Zugang zu den Luftschutzbunkern und ist medizinischen Versuchen der Nazis ausgesetzt, die ihre Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Später wird das Ruhrgebiet zu ihrer Wahlheimat, und sie engagiert sich in der Anti-Kriegsbewegung. Ihre Bluesstimme und ihre Bühnenpräsenz machen sie in den 1980er-Jahren zu einer Ikone der europäischen feministischen Friedensbewegung. Der Film ist eine Hommage an Fasia Jansen und zeigt beeindruckende Interviewszenen mit ihrer Mutter und Hamburger Jugendfreundinnen. Xaraasi Xanne – Crossing Voices Raphaël Grisey, Bouba Touré, FR/DE/ML 2022, 123 min, soninké/frz./bambara/pulaar OmeU Der Film handelt von Kämpfen um Arbeit und Anerkennung in Frankreich, der Sans-Papiers-Bewegung, vom Senegal-Fluss in Mali und was von Termiten zu lernen ist. Unterschiedliche Kulturen der Aufzeichnung und Überlieferung treffen aufeinander. Dokumente migrantischen Widerstands: Videos, Fotos, Plakate und Flugblätter, die Griots und das Radio, koloniales Bildmaterial und Google Earth. Als Reisender zwischen Mali und Frankreich bringt Touré in Frankreich erworbenes landwirtschaftliches Wissen zurück nach Mali und begründet 1977 mit anderen Rückkehrer*innen die bis heute bestehende Kooperative Somankidi Coura. Touré und Grisey legen gemeinsam Pfade durch Tourés reichhaltiges Archiv und versehen sie mit einer eigenen Zeitlichkeit: die Permakultur des Kampfes gegen koloniale Dominanz.
093 – Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Die heutige Episode gehört zu den wenigen, die eine gewisse Zeitlichkeit haben. Es war vor rund vier Jahren, als die Covid-Pandemie auch in Europa richtig angekommen ist. Ab 16. März 2020 wurde der erste österreichweite Lockdown verfügt. Dies war der Anfang einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die große Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheit der Menschen hatten. Vier Jahre später würde man erwarten, dass diese Maßnahmen, die in dieser Form einzigartig seit dem Zweiten Weltkrieg waren, breit in Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit reflektiert und diskutiert werden. Dies nicht nur, um die konkrete Krise aufzuarbeiten, sondern auch um zu fragen, wie wir mit zukünftigen Krisen umgehen sollten. Was beobachten wir in etablierten Medien, Wissenschaft und Politik? So gut wie nichts, was nach einer ernsthaften Aufarbeitung aussieht. Der Titel dieser Episode ist daher: »Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm?« Der heutige Gesprächspartner ist wieder Jan David Zimmermann, was mich sehr freut! Jan ist Autor, Publizist und Wissenschaftsforscher, hat auch gerade ein neues und äußerst empfehlenswertes Buch herausgebracht — Lethe, Vom Vergessen des Totalitären. Außerdem ist er Redakteur beim Stichpunkt-Magazin. In dieser Episode diskutieren wir nicht fachlich die Maßnahmen, die gesetzt oder unterlassen wurden, sondern vielmehr den Prozess, der zu diesen Maßnahmen geführt hat, sowie die Rolle von Wissenschaft und Expertise in diesem Zusammenhang. Wir fallen dabei nicht in die post-hoc fallacy, also aus dem Rückblick alles besser zu wissen. Sondern die Betrachtung ist eine aus der heutigen Zeit, aber vor allem hinsichtlich der Frage, was wir richtig und falsch gemacht haben, und wie wir von hier an weitergehen sollten. Wir versuchen also (nach Heinz von Förster) eine Beobachtung zweiter Ordnung. Was hat Corona angestoßen oder welche Trends in der Gesellschaft deutlicher gemacht? Beobachten wir neue totalitäre Tendenzen, eine Polarisierung, wie Wissenschaft in Krisen agiert? Covid per se bedarf einer Nachbearbeitung, aber auch die Folgeeffekte auf Wissenschaft, Politik und Gesellschaft für andere, ähnliche Probleme. Denn es wird fallweise behauptet, wir hätten einen Mechanismus, eine »Blaupause« entwickelt, um auch mit anderen (ähnlichen) Krisen umzugehen. Ist diese wünschenswert und Erfolg versprechend? Was bedeutet Ausnahmezustand; vor allem, auch wenn damit langfristig Politik gemacht wird? »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet«, Carl Schmitt Wie autoritär ist Gesellschaft der vormaligen »Mitte« geworden? Alle möglichen ideologischen Seiten finden autoritäre Ideen und auch Gewalt plötzlich rechtfertigbar? Was bedeutet Entscheiden unter Unsicherheit — oder allgemeiner: Wie sollten wir als Gesellschaft mit Unsicherheit umgehen? Wir diskutieren die verschiedenen Aspekte in Bezug auf folgende Phasen der Krise: Zeit vor 2020 Frühjahr/Sommer 2020 Herbst-Winter 2020 (vor der Impfung) Nach der Impfung 2021 2022 und später Wie gefährlich kann Forschung sein? Gain of Function Research, Lab Leaks? Wer sollte über solche Wissenschaft entscheiden? »Wissenschaft ist nicht einfrieren von Erkenntnis« Zur Cochrane Studie über Masken siehe Podcast Episode 72. Was bedeutet Krisenmanagement in solchen Situationen? Haben wir Maßnahmen von Privilegierten für Privilegierte auf dem Rücken der restlichen Gesellschaft erlebt? »Luxury beliefs are the new status symbols«, Rob Henderson Das Verhalten der Wissenschaft während der Pandemie wurde von einzelnen hochrangigen Wissenschaftern wie John Ioannidis untersucht, und das Ergebnis war wenig schmeichelhaft: »Even the best peer-reviewed journals often presented results with bias and spin.« »Whatever the origins of the virus, the refusal to abide by formerly accepted norms has done its own enormous damage.« »most of this work was of low quality, often wrong, and sometimes highly misleading.« »The disdain for reliable study designs was even celebrated.« »Big Tech companies […] developed powerful censorship machineries« »There was a clash between two schools of thought, authoritarian public health versus science—and science lost.« Man muss sich nach solchen Analysen natürlich die Frage stellen: Sind unsere Wissenschaftstugenden mittlerweile völlig korrodiert? Was hat es mit der Great Barrington Declaration auf sich und was waren die unerfreulichen Folgen für die beteiligten Wissenschafter? Niemand wird primär dafür kritisiert, im Jahr 2020 Fehler gemacht zu haben, aber wenn man sich 2024 dafür rühmt ist das ernüchternd. Dies zeigt sich auf drastische Weise am Auftritt des deutschen Soziologen Heinz Bude (der Mitglied des deutschen Krisenstabes war): Heinz Bude: »Noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert: Wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, dass so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und das war diese Formel flatten the curve. Wie können wir die Leute überzeugen mitzutun... Das sieht so nach Wissenschaft aus. Wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. […] Das haben wir geklaut von einem Wissenschaftsjournalisten. Das haben wir nicht selber erfunden. Wir fanden das irgendwie toll, dass man so ein Quasi-Wissenschaftsargument hat.« Anderer Diskutant: »Das bedeutet, dass sich die Wissenschaft in einem normativ vorgegebenen Rahmen engagiert. […] Diese normativen Vorgaben muss man einkaufen« HB: »Wissenschaft ist ja auch operativ interessant. « AD: »Aber wenn man sich normativ sehr sicher ist. Ich glaube, viele Leute waren sich sehr schnell sehr sicher.« Bude zuckt mit den Achseln. Heinz Bude war außerdem ein Verfechter der Zero-Covid Idee, die sehr schnell diskreditiert war. Was bedeutet es auch, wenn Wissenschaft »operativ interessant« wird? Das Vertrauen in die Wissenschaft geht verloren — wie ist das zu bewerten? Wird hier nicht oftmals Ursache mit Wirkung verwechselt? Wie kann das Vertrauen in Institutionen und Wissenschaft wieder hergestellt werden? Matt Taibbi spricht im Rahmen der Twitter Files vom Censorship Industrial Complex »Twitter was more like a partner to government « Wissenschaft ist immer stark mit Macht verwoben, wie steht das im Verhältnis zum Erkenntnisgewinn? Aber auch die Medien erfüllen ihre Aufgabe in keiner Weise. Wie gehen wir damit um? Wie kann entschieden werden, was legitime Kritik und was schlicht Unsinn ist? Wie konnte es passieren, dass liberale Nationen wie Kanada, Australien und Neuseeland in autoritäre Strukturen abgeglitten sind? Damit stellt sich die fundamentale Frage: Wie lange darf ein Krisenmoment dauern? »Moralpolitik hat die Sachpolitik abgelöst« Auf der »richtigen« Seite zu sein wird wichtiger als das Richtige zu tun. Und das Richtige wird mit allen Mitteln durchgesetzt, nicht nur mit harten Maßnahmen, sondern auch mit Soft Power wie Nudging. Dabei wird die eigentlich wichtige Frage gerne übersehen: Wer bestimmt, was das Richtige für mich ist? »The dictatorship of the future will be very unlike the dictatorships we experienced in the past. […] If you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. […] Making him actually love his slavery. Being happy under the new regime.«, Aldous Huxley Das Totalitäre ist stärker von klaren Strukturen und nicht von Inhalten bestimmt: »Das Totalitäre ist stärker ein wie als ein was.« Referenzen Andere Episoden Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers Episode 85: Naturalismus — was weiß Wissenschaft? Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann Episode 83: Robert Merton — Was ist Wissenschaft? Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson Episode 76: Existentielle Risiken Episode 74: Apocalype Always Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann Episode 47: Große Worte Episode 39: Follow the Science? Episode 37: Probleme und Lösungen Episode 25: Entscheiden unter Unsicherheit Jan David Zimmermann Homepage Facebook: Jan D. Zimmermann Instagram: j._zimmermann Buch: Lethe. Vom Vergessen des Totalitären Stichpunkt Magazin Fachliche Referenzen Sitzungsprotokoll der "Taskforce Corona" über zu wenig Angst in der Bevölkerung, Der Standard (2020) Regierungsprotokoll: Angst vor Infektion offenbar erwünscht, ORF (2020) Internes Papier aus Innenministerium empfahl, den Deutschen Corona-Angst zu machen, Focus (2020) Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen. Strategiepapier des Bundesinnenministeriums. Umstritten. Ein journalistisches Gütesiegel. Fitfty Fifty/ Westend Verlag (2024) Das integrative Empire: Wissensproduktion und kulturelle Praktiken in Habsburg-Zentraleuropa (Global- und Kolonialgeschichte). transcript Verlag (2023) Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als Ideologie Suhrkamp (1968) Rob Henderson, Luxury Beliefs John Ioannidis, How the pandemic is changing pandemic norms (2021) Great Barrington Declaration (2020) Heinz Bude im Gespräch 2024 Zero Covid, No Covid, Artikel im Deutschlandfunk (2021) Susanne Gaschke, Interview in der NZZ: »Sie wollten ganze Landkreise abschotten!« – »Ich würde immer noch so vorgehen, wie wir es getan haben!« (2023) Alexander Bogner, Nach Corona (2023) Matt Taibbi, The Censorship Industrial Complex (2023) Telegraph, The Lockdown Files Ein neuer Bericht offenbart Pläne für eine Veränderung von Coronaviren – kurz vor der Pandemie, NZZ (2021) Richard Thaler, Cass Sunstein, Nudge, Yale University Press (2008) WEF Artikel (2021) mit Interview Cass Sunstein Gesundheitspolitik: Nudging: Anstupsen für den guten Zweck (Spektrum 2015) Nudging Task Force unter Obama (2015) Rainer Mausfeld im Gespräch über sein neues Buch, Hybris und Nemesis (2023) Jesse Singal, The Quick Fix: Why Fad Psychology Can't Cure Our Social Ills, Farrar, Straus and Giroux (2021) Margaret Heffernan, Uncharted, Simon & Schuster UK (2020) Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books (2019) Aldous Huxley über Diktaturen der Zukunft (1958) Martin Kulldorff: Fired by Harvard for getting Covid right, Unherd (2024) Vinay Prasad, Martin Kulldorff was wrongly fired from Harvard Medical School (2024)
Prof. Dr. Birgit Glorius und Dr. Marcel Berlinghoff über dicke Bücher über Flucht
In dieser Folge stellen wir gleich zwei Neuerscheinungen in der Fluchtforschung in vergleichender Perspektive vor. Dabei handelt es sich einerseits um das Handbuch „Flucht- und Flüchtlingsforschung“ und anderseits den „Report Globale Flucht“. Regelmäßige Hörer*innen kennen Dr. Marcel Berlinghoff bereits aus Folge 16 zu historischer Migrationsforschung; dieses Mal ist er als Mit-Herausgeber beider Publikationen zu Gast. In dieser Special-Folgen dürfen wir daneben mit Prof. Brigit Glorius als Mit-Herausgeberin auch erstmalig eine Professorin begrüßen. Die Folge beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Gestaltung und Veröffentlichung der Sammelbände: Was sind die Zielsetzungen? Wie waren die jeweiligen Prozesse von der Auswahl der Autor*innen bis hin zur Publikation? Wesentlich ist auch die Frage nach Zeitlichkeit und Aktualität von Forschung. Note: Wir bitten unsere Zuhörer*innen für die schlechten Aufnahmebedingungen von Moderatorin Merve um Entschuldigung. Das verwendete Aufnahmestudio kommt kein zweites Mal zum Einsatz.
dieMotive und Bettina Lockemann
Mit Bettina Lockemann spreche ich über das Phänomen Fotobuch. Was so einfach klingt, ist für einen Fotobuchbanausen wie mich gar nicht so einfach. Nach der Lektüre von Bettinas Buch „Das Fotobuch denken“ fiel mir der Einstieg jedoch deutlich einfacher. Was Bettina in ihrem Buch zu beschreiben versucht besprechen wir in einer sehr kurzweiligen Podcastepisode. Dabei geht es auch um die Unterschiede von Serien, Sequenzen und Gruppen sowie Begrifflichkeiten wie Zeitlichkeit, das Filmische und das Fotografische. Auch die Idee des Erzählens und des Narrativs spielen eine große Rolle. Welchen Einfluss die theoretische Auseinandersetzung mit der Fotografie und dem Fotobuch auf die künstlerische Arbeit von Bettina Lockemann hat klären wir zum Schluss dann ebenfalls. Bettina Lockemann ist Künstlerin und Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt künstlerische Dokumentarfotografie. Nach ihrem Studium der künstlerischen Fotografie und Medienkunst in Leipzig promovierte sie an der ABK Stuttgart in Kunstgeschichte mit der Arbeit „Das Fremde sehen. Der europäische Blick auf Japan in der künstlerischen Dokumentarfotografie der Gegenwart“. Von 2009 - 2010 hatte sie eine Vertretungsprofessur für Fotografie an der Merz-Akademie in Stuttgart.Anschließend war sie 5 Jahre Professorin für Praxis und Theorie der Fotografie an der HBK in Braunschweig. https://www.cafelehmitz-photobooks.com/gossage-john-the-pond.html https://archivalien.de/publikation/pub_fotobuch.html
dieMotive und Bettina Lockemann
Mit Bettina Lockemann spreche ich über das Phänomen Fotobuch. Was so einfach klingt, ist für einen Fotobuchbanausen wie mich gar nicht so einfach. Nach der Lektüre von Bettinas Buch „Das Fotobuch denken“ fiel mir der Einstieg jedoch deutlich einfacher. Was Bettina in ihrem Buch zu beschreiben versucht besprechen wir in einer sehr kurzweiligen Podcastepisode. Dabei geht es auch um die Unterschiede von Serien, Sequenzen und Gruppen sowie Begrifflichkeiten wie Zeitlichkeit, das Filmische und das Fotografische. Auch die Idee des Erzählens und des Narrativs spielen eine große Rolle. Welchen Einfluss die theoretische Auseinandersetzung mit der Fotografie und dem Fotobuch auf die künstlerische Arbeit von Bettina Lockemann hat klären wir zum Schluss dann ebenfalls. Bettina Lockemann ist Künstlerin und Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt künstlerische Dokumentarfotografie. Nach ihrem Studium der künstlerischen Fotografie und Medienkunst in Leipzig promovierte sie an der ABK Stuttgart in Kunstgeschichte mit der Arbeit „Das Fremde sehen. Der europäische Blick auf Japan in der künstlerischen Dokumentarfotografie der Gegenwart“. Von 2009 - 2010 hatte sie eine Vertretungsprofessur für Fotografie an der Merz-Akademie in Stuttgart.Anschließend war sie 5 Jahre Professorin für Praxis und Theorie der Fotografie an der HBK in Braunschweig. https://www.cafelehmitz-photobooks.com/gossage-john-the-pond.html https://archivalien.de/publikation/pub_fotobuch.html
Aus der Perspektive der Zeitlosigkeit ist Hoffnung Ursache für Leid. Aus der Perspektive der Zeitlichkeit würde ohne die Hoffnung, dass Dinge möglich sind, die jetzt noch nicht möglich sind, etwas wesentliches fehlen.
058 — Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
Ich hatte seit längerer Zeit in Thema im Hinterkopf, das für die Zukunft unserer modernen Gesellschaften von großer Bedeutung ist, und dennoch häufig unter dem Radar läuft, beziehungsweise in den letzten Jahren seit dem immer stärkeren durch systemisches Versagen in vielen Ländern unter Beschuss geraten ist. So weit, dass manche von einer fundamentalen Ablöse träumen — sei es in Blockchain-Träumen oder mondäneren Varianten davon: Dieses Thema ist, »Verwaltung und staatlichen Strukturen«, denn beide bilden meiner Ansicht nach das Rückgrat jeder modernen Gesellschaft und es freut mich daher besonders mit Veronika Lévesque, eine äußerst kompetente Ansprechpartnerin zu diesem Themenfeld gefunden zu haben. Veronika Lévesque ist Organisationsbegleiterin und Projektmensch am Institut für Arbeitsforschung und Organistionberatung IAFOB. Beschäftigt sich vorzugsweise mit Fragen, für die es noch keine fertige Antwort gibt. Das macht sie natürlich zu einer perfekten Ansprechpartnerin für diesen Podcast. Ebenso, dass Frau Lévesque begeisterte Grenzgängerin ist: sie ist in vier Ländern, drei Sprachen und am liebsten in den Zwischenräumen zwischen Disziplinen unterwegs, mit den Schwerpunkten: Transformation, Organisations- und Entwicklungshandwerk, agile Spielfelder in nicht-agilen Umgebungen und Methodenentwicklung. Der Umgang mit Nicht-Planbarem ist dabei immer ein wesentliches Motiv. »Ein ambitionierter Fehler ist oft hilfreicher als eine mutlose Wahrheit.« Sie hat ihre Karriere im weiteren Sinne in der Erwachsenenausbildung begonnen, in Schulen weitergeführt und nutzt ihre Erfahrung in der Organisationsentwicklung um in der Verwaltung in der Schweiz für 15 Jahre zu arbeiten. Wir werden daher eine Einsicht in die Situation der Schweiz bekommen, was mich freut, weil wir von der Schweiz im restlichen deutschsprachigen Raum ohnedies zu wenig erfahren, die Schweiz aber offensichtlich in einigen Bereichen sehr erfolgreich agiert; wir diskutieren aber auch über Deutschland und Österreich, sowie die globale Situation. Wir beginnen mit der Frage, ob meine Ansicht, dass die Verwaltung das Rückgrat einer modernen Gesellschaft sei zutrifft? Wie spielen Exekutive, Legislative, Judikative und Verwaltung zusammen und — ist die Verwaltung damit die vierte Gewalt im Staate? »Die Verwaltung schützt das gesetzte Recht und gleichzeitig hilft sie dabei es zu ändern.« Ist die Verwaltung auch für Fragen »der Zukunft« verantwortlich, also Themen, die sich kurzfristigen ökonomischen Betrachtungen entziehen? Mit dem Ansatz des New Public Management wurde der Anspruch gestellt, dass auch Verwaltungen effizient sein müssen, was zu einer deutlichen Verkleinerung in den letzten Jahrzehnten geführt hat. D.h. Aufgaben, die besser am freien Markt zu erledigen sind, wurde ausgelagert. Was ist das aktuelle Fazit dieser Veränderungen? Auch stellt sich wieder das im Podcast häufiger genannte Dilemma zwischen Effizienz und Resilienz, das heißt der Fähigkeit sich auf eine unbekannte Zukunft mit neuen Herausforderungen und Risiken einzustellen. »Most modern efficiencies are deferred punishment«, Nassim Taleb Wie spielen politische Ideoligien (von sozialdemokratisch bis libertär) zusammen mit Verwaltung und: was zählen wir eigentlich zur Verwaltung? Eine weitere wichtige Rolle spielen staatsnahe Unternehmungen, die aber nicht im engeren Sinne zur Verwaltung zu zählen sind. Wird die Verwaltung immer nur dann genannt, wenn etwas nicht funktioniert, oder anders ausgedrückt: leidet die Verwaltung darunter, dass sie im Kern unsichtbar wird, wenn sie (zu) gut funktioniert? Wie geht die Verwaltung mit der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Anforderung nach Transparenz um und ist Transparenz überhaupt ein Wert an sich? Wem verantwortet sich die Verwaltung gegenüber? »Demokratie ist eine träge Maschinerie, konzipiert um Entscheidungen zu verlangsamen«, Herfried Münkler, zitiert in Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht Wie sieht es mit Zeitlichkeit aus, nach Herfried Münkler — ist Verwaltung vielleicht auch ein notwendiges und sinnvolles dämpfendes Element einer modernen Gesellschaft? Standardisierung, Stabilität, Nachvollziehbarkeit waren der Erfolgsmuster der Vergangenheit — das bereitet uns zunehmend Schwierigkeiten. Aber nicht nur die Verwaltung hat Probleme sich der Geschwindigkeit der Zeit anzupassen, auch die Gesetzgebung kommt selten hinterher, sie wird von den Themen getrieben und setzt sie selten. »Die Verwaltung als Bastion gegen Willkür« Wird, wie so häufig, das gemessen, was sich leicht messe lässt: also der Kosten, und nicht der Nutzen — zum Schaden der Gesellschaft? Was macht die »Digitalisierung« mit der Verwaltung, beziehungsweise die Verwaltung mit der Digitalisierung? Dann unterhalten wir uns über den Unterschied zwischen Politik und Verwaltung, die sehr gegensätzlich sind: erstere laut, schnell und flach, die letztere still, konzentriert und tief? Haben wir Angst, gesetzlich die Idee (und nicht jedes Detail) klarzustellen und Verwaltung beziehungsweise Exekutive mehr Freiheit in der Umsetzung zu lassen und versuchen wir stattdessen (erfolglos) alles bis ins Letzte zu regeln und zu bestimmen und scheitern dabei naturgemäß an der Komplexität und Geschwindigkeit der Welt? Haben wir also, anders gesagt, Angst selbstständig zu denken? Wollen wir jeden kleinsten Schritt vorbestimmt haben, wissend, dass dies zum Scheitern verurteilt ist? »When I look at people I have hope. When I look at institutions I am hopeless«, Donella Meadows via Vicki Robin Was sind die Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte zu beurteilen und welche Rolle spielen dabei Verwaltung und staatliche Strukturen (Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Versagen im Covid-Management usw.): „Der Bund hatte die im Pandemiefall notwendigen organisatorischen Strukturen und personellen Grundvoraussetzungen nicht sichergestellt.“ und „die Herausforderungen des Krisenmanagements in der COVID-19-Pandemie [waren] bislang ungelöst. Die seit Ausbruch der Pandemie gemachten Erfahrungen wurden zu wenig genutzt, um das Krisenmanagement im Sinne von Lessons Learned weiterzuentwickeln“, Rechnungshofbericht Österreich, Juni 2022 Also, nicht nur wurden erhebliche Fehler gemacht, man hat aus diesen bisher auch nicht nennenswert gelernt — ein rein österreichisches Problem? Wie bekommt man Kompetenz, Schlagkraft, Handlungsfähigkeit und Agilität in die Verwaltung, die gleichzeitig auch Stabilität und Langfristigkeit sichern soll? Und damit im Zusammenhang: ist das Beamtenwesen überhaupt noch ein Zukunftsmodell, oder sollte die Verwaltung nicht vielmehr den Rest der Gesellschaft widerspiegeln? Und nicht zuletzt zeichnet Frau Lévesque auch ein optimistischeres Bild für die Kooperation zwischen den Generationen — vom Übergang einer linearen in eine digitale Lebenslogik mit Hilfe anderer Denkmodelle der »Gamergeneration«? Referenzen Veronika Lévesque Veronika Lévesque am IAFOB Veronika Lévesque, Wie innovierend, agierend und selbstaktiv getrieben kann und soll eine Verwaltung sein? (2017) Andere Episoden Episode 17: Kooperation Episode 25: Entscheiden unter Unsicherheit Episode 26: Was kann Politik (noch) leisten? Ein Gespräch mit Christoph Chorherr Episode 30: (Techno-)Optimismus — ein Gespräch mit Tim Pritlove Episode 38: Eliten, ein Gespräch mit Prof. Michael Hartmann Episode 42: Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit Herbert Saurugg Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise? Fachliche Referenzen Forum Agile Verwaltung Rechnungshofbericht zum österr. Pandemiemanagement (Juni 2022) Vicki Robin im Team Human Podcast am 9.2.2022 (Douglas Rushkoff) Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht (2017) The C.D.C. Isn't Publishing Large Portions of the Covid Data It Collects (20.2.2022)
Nomadismus als Zugang zur Moderne – mit Sina Steglich
In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Nomadismus. Zu Gast ist Sina Steglich, die sich in ihrem neuen Projekt mit dem Thema Nomadismus als Reflexionsfigur der Moderne oder der Postmoderne beschäftigt. Wir sprechen über die Frage was Nomadismus überhaupt ist, wie er sich von der Migration abgrenzt, wie er wahrgenommen wird von außenstehenden und wie man durch Nomadismus die Moderne verstehen kann. Außerdem reden wir darüber, warum interdisziplinäre Forschung so wichtig ist und was der mobility turn ist. Zum Schluss verrät Sina uns noch welches Buch zu welchem Bier für sie am besten zusammenpasst. Quellen & Literatur Bösch, Frank: Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann. C.H. Beck, 2019. Di Cesare, Donatella: Philosophie der Migration. Matthes & Seitz Berlin, 2021. Graeber, David & Wengrow, David: Anfänge: Eine neue Geschichte der Menschheit. Klett-Cotta Verlag, 2022. Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit. Suhrkamp, 2003. Hansen, Valerie: Das Jahr 1000. Als die Globalisierung begann. C.H. Beck, 2021. Illies, Florian: 1913: Der Sommer des Jahrhunderts. S. Fischer, 2012. Liebisch-Gümüş, Carolin: Mobilität/en und Mobilitätsgeschichte. Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.03.2022 http://docupedia.de/zg/Liebisch_Guemues_mobilitaet_v1_de_2022 Nomaden. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2015: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/208259/nomaden/ Sarrasin, Philipp: 1977. Eine Geschichte der Gegenwart. Suhrkamp, 2021. Siegelberg, Mira: Statelessness. Harvard University Press, 2020. Steglich, Sina: Zeitort Archiv: Etablierung und Vermittlung geschichtlicher Zeitlichkeit im 19. Jahrhundert. Campus Verlag, 2020. Toynbee, Arnold J.: A Study of History. 1934–1961. Trawny, Peter (Hrsg.): Martin Heidegger: Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 1931–1938). Gesamtausgabe Band 94. Frankfurt am Main, 2014. von Suffrin, Dana: Otto. Kiwi-Verlag, 2019.
Für gewöhnlich spricht man nicht gerne von den dunklen Seiten des Lebens. Sorgen, Krankheiten und Schicksalsschläge werden als Schattenseiten bezeichnet und man möchte die der Sonne abgewandte Seite des Lebens am liebsten gar nicht wahrnehmen. Abschnitte, die man besser vergessen oder ausblenden möchte, die aber gleichermaßen zum Alltag dazugehören. Wir waren geschockt, als wir die Nachricht erhielten, dass ein lieber Freund und Kollege im Alter von 45 Jahren von uns gegangen ist. Mitten im Leben stehend, Vater von drei Töchtern, von denen die älteste kurz vor ihrer Hochzeit stand. Ein bitterer Verlust, der die Schattenseite des Lebens in schmerzlicher Weise aufzeigt und uns unsere Zeitlichkeit vor Augen führt. Dabei fällt mir die Geschichte eines Mannes ein, der auch unter Einflüssen litt, die er nicht ausblenden konnte, aber dennoch nicht den Mut und die Zuversicht verlor. Von allen Seiten bedrängt, setzte er sein Vertrauen und seine Sicherheit auf Gott: „auf den er hoffte.“ Ich spreche von David aus der Bibel. Nachdem er von der Schafherde weggeholt wurde, legte er eine steile Karriere als Kriegsheld hin, zog den Neid des Königs auf sich und musste sich jahrelang in der Wüste verstecken. Dabei war er selbst für den Thron bestimmt. Aber er gab sein Vertrauen auf Gott nicht auf, bis die Prophezeiung endlich wahr wurde und er die Königskrone erhielt. Ganz ehrlich geht es mir auch oft so, dass ich nicht weiter weiß. Vielleicht befindest du dich auch in einer Situation die dir aussichtslos erscheint und die Ereignisse in deinem Leben werfen ihre Schatten voraus. Es scheint, als liege etwas in der Luft. Niemand will im Schatten des anderen stehen, sondern aus ihm heraustreten und Anerkennung und Bestätigung bekommen. Wenn wir also im Schatten sitzen, dann am besten im Schatten dessen, der etwas Außergewöhnliches in uns bewirkt. David drückt es im zweiundneunzigsten Psalm so aus: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue.“ Es lohnt sich den ganzen Psalm zu lesen, um zu erfassen, durch wie viele Situationen und Bedrängnis der Autor im Vertrauen auf Gott und mit dessen Beistand hindurchgegangen ist. Schatten kann in bestimmten Lagen sogar lebenswichtig sein und ist eine Anspielung auf die Frische und Erholung, die sich darin verbirgt. Wie oft machen wir uns einen Kopf, dabei hat Gott die Lösung schon parat, auch wenn wir sie noch nicht wahrnehmen. Persönlich durchleben wir gerade eine Situation, der wir uns stellen müssen. Und geradeweil wir die Situation nicht ändern können, sondern so annehmen müssen wie sie ist, ist es gut, inmitten des Schattens des Allmächtigen zu sitzen. Catarina drückte es so aus: „dass wir die Umstände im Vertrauen so angehen müssen, als wenn Gott schon geholfen hat.“ Wirft das Leben seine schwarzen Schatten voraus und hüllt dich ein in Dunkelheit, darfst du wie David in Gottes sicherer Burg Hilfe suchen. Dort empfängt dich sein liebendes Licht und sein schützender Schatten beschirmt dich, auch an diesem Tag. This episode is also available as a blog post: http://missionconnects.net/2022/03/07/schattenseiten/
Machtstreben, schwarz-weiß - Joel Coens Filmdrama "The Tragedy of Macbeth"
Machtstreben, schwarz-weiß - Joel Coens Filmdrama "The Tragedy of Macbeth" / Dringlich und Bildkräftig - Albert Ostermaiers neuer Gedichtband "Teer" / Im größten Überwachungsstaat der Welt - Moderatorengespräch mit Alexandra Cavelius über ihr Buch "China-Protokolle” / Die Vermessung der Zeit - Die Ausstellung "Futura” in der Hamburger Kunsthalle widmet sich der Zeitlichkeit.
Ob Car-Sharing, das Teilen von Wohnungen und Arbeitsplätzen, das Verleihen von Klamotten, Werkzeug und anderen alltagspraktischen Dingen – Teilen ist Trend, und zwar nicht nur aus ökologischen Gründen. Welche soziologischen Aspekte hinter der „Sharing Economy“, also der Ökonomie des Teilens, stecken, das wird in dem Projekt „Dinge verfügbar machen. Eigentum als spezifische Form der Weltbeziehung“ – ein Teilprojekt des interdisziplinären Sonderforschungsbereiches „Strukturwandel des Eigentums“ – näher untersucht. Geleitet wird es von Prof. Dr. Hartmut Rosa, der schon mit seiner Forschung über Beschleunigung, Resonanz und das gute Leben den Nerv der Zeit getroffen hat. Rosa ist Professor für Soziologie an der FSU Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien an der Universität Erfurt. Mit ihm gehen wir in der fünften Episode unseres Wissenschaftspodcasts "WortMelder" den Fragen auf den Grund, welchen Einfluss Eigentum auf der einen und das Teilen auf der anderen Seite auf uns als Individuen und auf das gelingende Leben hat und ob eine Ökonomie des Teilens vielleicht sogar ein Stück weit mit der Steigerungslogik unserer Zeit brechen könnte. ||| Shownotes ||| mehr zu Prof. Dr. Hartmut Rosa: https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg/personen/direktorat-personal/direktorat/prof-dr-hartmut-rosa *** mehr zum Sonderforschungsbereich/Transregio SFB TRR 294 „Strukturwandel des Eigentums“: https://sfb294-eigentum.de/de/ *** mehr zum Teilprojekt „Dinge verfügbar machen. Eigentum als spezifische Form der Weltbeziehung“: https://sfb294-eigentum.de/de/teilprojekte/dinge-verfuegbar-machen/ *** Publikationen: Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa. „Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie?“: https://www.suhrkamp.de/buch/spaetmoderne-in-der-krise-t-9783518587751 *** Hartmut Rosa. „Unverfügbarkeit“: https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-unverfuegbarkeit-t-9783518471005 *** Hartmut Rosa. „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“: https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-resonanz-t-9783518298725 *** Hartmut Rosa. „Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit“: https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-beschleunigung-und-entfremdung-t-9783518585962 *** Hartmut Rosa: „Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne“: https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-beschleunigung-t-9783518293607 ||| Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie Ihr Anliegen an die Hochschulkommunikation der Universität Erfurt: pressestelle@uni-erfurt.de *** Shownotes und Kontakt auch unter: https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/forschungsblog-wortmelder/eigentum-teilen-und-das-gute-leben
#072 »Erst die Digitalisierung führte zu der Frage, was Fotografie eigentlich ist.«
Nicolas Oxen. Medienwissenschaftler, Düsseldorf. Zitate aus dem Podcast: »Mich interessiert das Verhältnis von technischen Medien und Zeit.« »Wie beeinflussen technische Medien unsere Zeitwahrnehmung?« »Bereits mit dem Fernsehen begannen Bilder zeitlich zu werden, wie heute digitale Bilder.« »Wir machen heute viel mehr Bilder in Situationen, in denen wir sonst keine Kamera zur Hand gehabt hätten.« »Auf unseren Smartphones gibt es Bilder, die wir nie wieder anschauen.« »Die Bildsammlungen werden diffuser und ungeordneter.« »Unser Leben wird fotografischer und bildintensiver.« »Oft ist die Digitalisierung schneller, als wir sie verstehen können.« »Neben dem Fortschrittsoptimisums müssen wir uns auch den Technikpessimismus abgewöhnen.« »Es ist problematisch, dass wir bereitwillig die Kapitalisierung des Internets akzeptieren.« »Ich würde mir wünschen, dass Technik kreativ gesehen wird und nicht nur funktional.« Nicolas Oxen wurde 1986 in Schleswig-Holstein geboren. Er studierte Kultur- und Medienwissenschaft an der Bauhaus-Universität Weimar und an der Université Lumière Lyon 2. An der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Philosophie audiovisueller Medien (Prof. Dr. Christiane Voss) und an der Kunstakademie Düsseldorf am Lehrstuhl für Philosophie (Prof. Dr. Ludger Schwarte) tätig. Als Visiting Scholar verbrachte er einen Forschungsaufenthalt an der Duke University (Program in Literature, Prof. Mark B.N. Hansen). Einen wichtigen Forschungsschwerpunkt stellt die medienphilosophische Auseinandersetzung mit der Zeitlichkeit technischer Medien dar. Weitere Forschungsfelder sind: Film- und Medienwissenschaft, Filmphilosophie, Medienökologie, Prozessphilosophie, politische Theorie und digitale Kultur. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5817-0/instabile-bildlichkeit/ https://www.transcript-verlag.de/author/oxen-nicolas-320001097/ https://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/medienwissenschaft/philosophieavmedien/personen/nicolas-oxen-ma-vita/ https://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/medienwissenschaft/philosophieavmedien/personen/nicolas-oxen-ma-publikationen/ Episoden-Cover-Gestaltung: Andy Scholz Episoden-Cover-Foto: Privat Idee, Produktion, Redaktion, Moderation: Andy Scholz http://fotografieneudenken.de/ https://www.instagram.com/fotografieneudenken/ Der Podcast ist eine Produktion von STUDIO ANDY SCHOLZ 2021. Andy Scholz wurde 1971 in Varel am Jadebusen geboren. Er studierte Philosophie und Medienwissenschaften in Düsseldorf, Kunst und Design an der HBK Braunschweig und Fotografie/Fototheorie in Essen an der Folkwang Universität der Künste. Seit 2005 ist er freier Künstler, Autor sowie künstlerischer Leiter und Kurator vom FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER, das er gemeinsam mit Martin Rosner 2016 in Regensburg gründete. Seit 2012 unterrichtet er an verschiedenen Instituten, u.a. Universität Regensburg, Fachhochschule Würzburg, North Dakota State University in Fargo (USA), Philipps-Universität Marburg, Ruhr Universität Bochum. Im ersten Lockdown, im Juni 2020, begann er mit dem Podcast. Er lebt und arbeitet in Essen. http://fotografieneudenken.de/ http://photography-now.com/exhibition/150189 https://www.instagram.com/fotografieneudenken/ https://festival-fotografischer-bilder.de/ http://andyscholz.com/ http://photography-now.com/exhibition/147186
This week is our first reading of Women, Race & Class by Angela Y. Davis.The full book is available online here:https://archive.org/details/WomenRaceClassAngelaDavisContent warnings for this episode as a whole:SlaveryPregnancyRapeDeathTortureRacismBloodAnd abuse related to multiple of the above topics. [Part 1 – This Week]1. THE LEGACY OF SLAVERY: STANDARDS FOR A NEW WOMANHOODFirst half – 01:32[Part 2]1. THE LEGACY OF SLAVERY: STANDARDS FOR A NEW WOMANHOOD (Second half)[Part 3]2. THE ANTI-SLAVERY MOVEMENT AND THE BIRTH OF WOMEN'S RIGHTS[Part 4 - 5]3. CLASS AND RACE IN THE EARLY WOMEN'S RIGHTS CAMPAIGN[Part 6]4. RACISM IN THE WOMAN SUFFRAGE MOVEMENT [Part 7]5. THE MEANING OF EMANCIPATION ACCORDING TO BLACK WOMEN [Part 8]6. EDUCATION AND LIBERATION: BLACK WOMEN'S PERSPECTIVE[Part 9]7. WOMAN SUFFRAGE AT THE TURN OF THE CENTURY: THE RISING INFLUENCE OF RACISM[Part 10]8. BLACK WOMEN AND THE CLUB MOVEMENT[Part 11]9. WORKING WOMEN, BLACK WOMEN AND THE HISTORY OF THE SUFFRAGE MOVEMENT[Part 12 - 13]10. COMMUNIST WOMEN[Part 14 - 15]11. RAPE, RACISM AND THE MYTH OF THE BLACK RAPIST [Part 16 - 17]12. RACISM, BIRTH CONTROL AND REPRODUCTIVE RIGHTS [Part 18-19]13. THE APPROACHING OBSOLESCENCE OF HOUSEWORK: A WORKING-CLASS PERSPECTIVEFootnotes:1) – 01:54Ulrich Bonnell Phillips, American Negro Slavery: A Survey of the Supply, Employment, and Control of Negro Labor as Determined by the Plantation Regime (New York and London: D. Appleton, 1918). See also Phillips' article “The Plantation as a Civilizing Factor,” Sewanee Review, XII (July, 1904), reprinted in Ulrich Bonnell Phillips, The Slave Economy of the Old South: Selected Essays in Economic and Social History, edited by Eugene D. Genovese (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1968). The following passage is included in this article:The conditions of our problem are as follows:1. A century or two ago the negroes were savages in the wilds of Africa. 2. Those who were brought to America, and their descendants, have acquired a certain amount of civilization, and are now in some degree fitted for life in modern civilized society. 3. This progress of the negroes has been in very large measure the result of their association with civilized white people. 4. An immense mass of the negroes is sure to remain for an indefinite period in the midst of a civilized white nation. The problem is, How can we best provide for their peaceful residence and their further progress in this nation of white men and how can we best guard against their lapsing back into barbarism? As a possible solution for a large part of the problem, I suggest the plantation system. (p. 83)2) – 02:41 Observations on the special predicament of Black women slaves can be found in numerous books, articles and anthologies authored and edited by Herbert Aptheker, including American Negro Slave Revolts (New York: International Publishers, 1970. First edition: 1948); To Be Free: Studies in American Negro History (New York: International Publishers, 1969. First edition: 1948); A Documentary History of the Negro People in the United States, Vol. 1 (New York: The Citadel Press, 1969. First edition: 1951). In February, 1948, Aptheker published an article entitled “The Negro Woman” in Masses and Mainstream, Vol. 11, No. 2.3) – 02:54Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made (New York: Pantheon Books,1974). 4) – 02:59John W. Blassingame, The Slave Community: Plantation Life in the Antebellum South(London and NewYork: Oxford University Press, 1972). 5) – 03:06Robert W. Fogel and Stanley Engerman, Time on the Cross: The Economics of Slavery in the Antebellum South, 2 volumes. (Boston: Little, Brown & Co., 1974.)6) – 03:12Herbert Gutman, The Black Family in Slavery and Freedom, 1750–1925 (New York: Pantheon Books, 1976) 7) – 03:23Stanley Elkins, Slavery: A Problem in American Institutional and Intellectual Life, third edition, revised (Chicago and London: University of Chicago Press, 1976)8) – 04:16See Daniel P. Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action, Washington, D.C.: U.S.Department of Labor, 1965. Reprinted in Lee Rainwater and William L. Yancey, The Moynihan Report and the Politics of Controversy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1967).9) – 05:53See W. E. B. DuBois, “The Damnation of Women,” Chapter VII of Darkwater (New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920).10) – 06:44Kenneth M. Stampp, The Peculiar Institution: Slavery in the Antebellum South (New York: VintageBooks, 1956), p. 343. 11) – 07:57Ibid., p. 31; p. 49; p. 50; p. 60. 12) – 08:55Mel Watkins and Jay David, editors, To Be a Black Woman: Portraits in Fact and Fiction (New York: William Morrow and Co., Inc., 1970), p. 16. Quoted from Benjamin A. Botkin, editor, Lay My Burden Down: A Folk History of Slavery (Chicago: University of Chicago Press, 1945).13) – 11:30Barbara Wertheimer, We Were There: The Story of Working Women in America (New York: Pantheon Books, 1977), p. 109. 14) – 13:21Ibid., p. 111. Quoted from Lewis Clarke, Narrative of the Sufferings of Lewis and Milton Clarke, Sons ofa Soldier of the Revolution (Boston: 1846), p. 127. 15) – 13:49Stampp, op. cit., p. 57.16) – 14:44Charles Ball, Slavery in the United States: A Narrative of the Life and Adventures of Charles Ball, a Black Man (Lewistown, Pa.: J. W. Shugert, 1836), pp. 150–151. Quoted in Gerda Lerner, editor, Black Women in White America: A Documentary History (New York: Pantheon Books, 1972), p. 48. 17) – 15:30Moses Grandy, Narrative of the Life of Moses Grandy: Late a Slave in the United States of America (Boston: 1844), p. 18. Quoted in E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1969. First edition: 1939).18) – 16:19Ibid. 19) – 17:00Robert S. Starobin, Industrial Slavery in the Old South (London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1970), pp. 165ff. 20) – 17:26Ibid., pp. 164–165 21) – 17:43Ibid., p. 165. 22) – 17:54Ibid., pp. 165–166.23) – 18:02“Iron works and mines also directed slave women and children to lug trams and to push lumps ofore into crushers and furnaces.” Ibid., p. 166. 24) – 18:32Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band (Berlin, D.D.R.: Dietz Verlag, 1965), pp. 415–416: “In England werden gelegentlich statt der Pferde immer noch Weiber zum Ziehnusw. bei den Kanalbooten verwandt, weil die zur Produktion von Pferden und Maschinen erheischte Arbeit ein mathematisch gegebenes Quantum, die zur Erhaltung von Weibern der Surplus-populationdagegen unter aller Berechnung steht.” Translation: Capital, Vol. 1 (New York: International Publishers, 1968), p. 391. 25) – 18:53Starobin, op. cit., p. 166: “Slaveowners used women and children in several ways in order to increase the competitiveness of southern products. First, slave women and children cost less to capitalize and to maintain than prime males. John Ewing Calhoun, a South Carolina textile manufacturer, estimated that slave children cost two-thirds as much to maintain as adult slave cottonmillers. Another Carolinian estimated that the difference in cost between female and male slave labor was even greater than that between slave and free labor. Evidence from businesses using slave womenand children supports the conclusion that they could reduce labor costs substantially.”26) – 19:49Frederick Law Olmsted, A Journey in the Back Country (New York: 1860), pp. 14–15. Quoted in Stampp, op. cit., p. 34. 27) – 20:15Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Berlin, D.D.R.: Dietz Verlag, 1953), p.266. “Die Arbeit ist das lebendige, gestaltende Feuer; die Vergänglichkeit der Dinge, ihre Zeitlichkeit,als ihre Formung durch die lebendige Zeit.”28) – 23:48Quoted in Robert Staples, editor, The Black Family: Essays and Studies (Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1971), p. 37. See also John Bracey, Jr., August Meier, Elliott Rudwick,editors, Black Matriarchy: Myth or Reality (Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1971),p. 140.29) – 24:30Bracey et al., op. cit., p. 81. Lee Rainwater's article “Crucible of Identity: The Negro Lower-Class Family” was originally published in Daedalus, Vol. XCV (Winter, 1966), pp. 172–216.30) – 25:05Ibid., p. 98. 31) – 25:31Ibid32) – 25:50Frazier, op. Cit.33) – 25:31Ibid., p. 102 34) – 26:50Gutman, op. Cit.35) – 27:45The first chapter of his book is entitled “Send Me Some of the Children's Hair,” a plea made by a slave husband in a letter to his wife from whom he had been forcibly separated by sale: “Send me some of the children's hair in a separate paper with their names on the paper.... The woman is not born that feels as near to me as you do. You feel this day like myself. Tell them they must remember they have a good father and one that cares for them and one that thinks about them every day.... Laura I do love you the same. My love to you never have failed. Laura, truly, I have got another wife, and I am very sorry, that I am. You feels and seems to me as much like my dear loving wife, as you ever did Laura.You know my treatment to a wife and you know how I am about my children. You know I am one man that do love my children.” (pp. 6–7) 36) – 28:16Ibid. See Chapters 3 and 4. 37) – 29:20Ibid., pp. 356–357. 38) – 30:31Elkins, op. cit., p. 130. 39) – 31:22Stampp, op. cit., p. 344.
Für ihre erste Einzelausstellung in Italien hat Jessika Khazrik nor the Society of False Witnesses ihre Arbeit umgestaltet und ihr die Form einer vielschichtigen, ferngesteuerten Installation gegeben, die ausschließlich von der Straße aus und damit trotz der aktuellen Schließungsmaßnahmen erfahrbar ist. Abeyance & Concurrence (Schwebe & Gleichzeitigkeit) entstand in Reaktion auf die gedehnte Zeitlichkeit der (post-)koronialen Gegenwart und entsorgten Vergangenheit angesichts der jüngsten kollektiven wie auch persönlichen Erfahrungen von Aufstand, Solidarität und Verhaftung der Künstlerin. Es handelt sich um einen Versuch, strukturellen Verwerfungen des internationalen Rechts den gewaltigen Ausbruch langsamer Gewalt und die gleichzeitige Suche nach transformativer Gerechtigkeit anhand von Akten kollektiver Störung entgegenzustellen. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/saltobz/message
Christopher Clark - Gefangene der Zeit. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump
Der australische Starhistoriker Christopher Clark veröffentlicht einen Sammelband mit 13 ausgewählten Aufsätzen. Rezension von Konstantin Sakkas. Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz DVA 2020, 336 Seiten, 26 Euro ISBN 978-3-421-04831-8
#03 - Bewusstsein der Rollenvielfalt: Umgang mit der Vielzahl an Rollen anhand von Henry Mintzberg
Leadership Impuls | Einblicke, Impulse und Tipps zur Führung
Wie viele Rollen hat eine Führungskraft zu erfüllen? Bei ihrem Start als Führungskraft ist vielen Menschen nicht bewusst, wie viele Rollen eine Führungskraft zu erfüllen hat. Um mit dieser Rollenvielfalt geschickt umzugehen und sicherzustellen, dass alle Hüte mit Leben gefüllt werden, bedarf es im ersten Schritt vor allem ein Bewusstsein über diese Herausforderung. Damit ist es jedoch nicht ganz getan: Denn auch das Umfeld muss sich bewusst sein, dass es beispielsweise noch mehr zu tun gibt, als „nur“ die Mitarbeiter*in zu führen.
Stoizismus - Über Seelenruhe und das glückliche Leben #5
Der Stoizismus wird oft als Gegenspieler zum Epikureismus gehandelt, wobei die beiden philosophischen Strömungen interessanterweise auf demselben ethischen Fundament aufbauen. In der fünften Folge klären wir die Grundgedanken des Stoizismus und betrachten Senecas Ausführung über Zeitlichkeit.
Episode 065: Der Mann, der vom Himmel fiel (The Man Who Fell to Earth), 1976
In seinem narrativen Herzen ein Science-Fiction-Film, der alles, was kausal SciFi ist, fallen zu lassen scheint, ist Nicolas Roegs Literaturverfilmung eine fragile Konstruktion, der es um menschliche Abgründe und Bedingtheiten, Abhängigkeiten und Sexualität geht. Er bindet seinen Kamerablick an das von David Bowie gespielte Alien, einen Mann, der sich in die Gesellschaft einpasst, aber dennoch immer verzerrt von außen auf die Welt schaut. Gleichzeitig bleibt auch sein Charakter für uns ein Außen, und so doppelt sich das Filmbild zu einem wenig verlässlichen Spiegelbild. Roeg, gerade leider verstorben, ist ein Großmeister des 70er Jahre Arthouse-Films, versteht sich auf ein Kino fern von absichernden Kausalketten, dem es um Fragen von Zeitlichkeit und subjektive Erinnerungsbilder geht - ein Potential des Mediums Film, das er wie kaum ein anderer untersucht. Dabei ist sein Film selten emotional, aber immer faszinierend, und zutiefst einflussreich. Wir schauen darauf, wie er mit seinem Erzählen und seiner Ästhetik den Weg für Lynch, Cronenberg, Egoyan oder Nolan ebnet, aber auch wie seine Erzählstrategie um den Nukleus einer Figur andere Geschichten zu arrangieren, Comic-Autor und Film-Vorlagengeber Alan Moore tief beeinflusst hat. Auch wenn dies nicht sein bester Film ist: Roeg, den man irgendwo etwas vergessen hatte, hat unsere Kultur verändert.
19. Oktober 2017, die 292. Folge. Längere aber bruchstückhafte, kratzige, schiefe Not(iz)en zum Klingen, zum Musikalischen des Denkens, zum Hören und Spielen, zum Üben, zum zur Darstellung bringen, statt nur dem Dargestellten und der Darstellung, zu Melodie des Denkens und der Konstruktivität des so denkens, zur Zeitlichkeit von Musik, die ihre Qualität nur in der Zeit hält, aufgibt, entfaltet, usf. - so viele winzige Not(iz)en, so wenig Musik.
27. Februar 2017, die 58. Folge. Ich lese aus "Miamification" weiter, heute vom 24. September und notiere ein paar (sehr müde und spärliche, eigentlich zerstreute, weil in Gedanken wo völlig anderes...) Überlegungen im Anschluss. Was meint nun diese eigentümliche Zeitlichkeit der Phänomene im Falle der Unterscheidung gegenwärtiger Zukünfte und zukünftiger Gegenwarten? Was die Fixierung der Medien heute (!) auf drohende Zukünfte statt vergangene Geschehnisse? Und was kann man eigentlich durchschauen, wenn das Phänomen Trump dann doch nur in den Narrativen gekauft wird?
24. Februar 2017, die 55. Folge. Ich habe auf einer umständlichen Zugfahrt weiter in "Miamification gelesen". Nicht nur aber auch den Eintrag vom 23. September - und mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Was heisst es, Phänomene an ihrer eigentümlichen Zeitlichkeit zu beobachten? Sind Phänomene gar ihre eigentümliche Zeitlichkeit? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Phänomen und seiner Zeitlichkeit? Was sieht ein spekulatives Denken, das auf diese neuartige Zeitlichkeit fokussiert? Ich habe heute vor allem Fragen.
"Die Zeit ist kurz" (1 Kor 7, 29) - Besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit.
Erzbischof Dr. Heiner Koch
Costrutti marcati a sinistra come risorse interazionali nel parlato tedesco e italiano
Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften - Digitale Hochschulschriften der LMU
Gegenstand dieser Dissertation sind Konstruktionen ‘am linken Satzrand’ (die sogenannte ‘Linksversetzung’ und das ‘freie Thema’) im gesprochenen Deutsch und Italienisch. Diese Strukturen werden aus der Perspektive der interaktionalen Linguistik und der Konversationsanalyse betrachtet und mit Methoden der Gesprächsforschung analysiert. Es werden insbesondere die folgenden Fragen behandelt: Welche interaktionalen Aufgaben werden durch die Verwendung einer Konstruktion am linken Satzrand gelöst? Welche Merkmale weisen diese emergenten Konstruktionen in der Rede-in-der-Interaktion auf? Gibt es Unterschiede zwischen Deutsch und Italienisch hinsichtlich der interaktionalen Dynamiken, die solche Konstruktionen charakterisieren? Um diese Fragen zu beantworten wurden die Konstruktionen in ihrem sequentiellen Kontext in verschiedenen Korpora des gesprochenen Italienischen und des gesprochenen Deutsch analysiert. Die Datenanalyse hat ergeben, dass die untersuchten Konstruktionen im Deutschen und im Italienischen mit ähnlichen interaktionalen Aufgaben verbunden sind: Sie werden übereinzelsprachlich als Ressourcen für die thematische und konversationelle Strukturierung benutzt. Die Analyse hat ferner gezeigt, dass diese Konstruktionen keine feste Strukturen darstellen, die bestimmten a-priori etablierten formalen Kriterien zugeordnet werden können, sondern flexible Ressourcen sind, die strategisch eingesetzt werden, und je nach Kommunikationssituation unterschiedliche Merkmale zeigen. Ein allgemeineres Ziel dieser Arbeit ist es, Ansätze und Methoden der Gesprächsforschung und der interaktionalen Linguistik mit der italienischen Gesprochene-Sprache-Forschung zu verbinden. Trotz der Aufmerksamkeit, die die gesprochene Sprache erfährt, werden in den Arbeiten zum Italienischen Aspekte wie der Zusammenhang zwischen Syntax und Interaktion oder die Zeitlichkeit des Gesprochenen kaum betrachtet. Darüber hinaus zielt die Dissertation darauf ab, Überlegungen über die Adäquatheit der Nutzung der Termini ‘Linksversetzung’ und ‘linke Saztperipherie’ in Bezug auf Phänomene der gesprochenen Sprache zu fördern, indem alternative Termini vorgeschlagen werden.
"Die Zeit ist kurz" (1 Kor 7, 29) - Besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit.
Ref.: Weihbischof Dr. Heiner Koch, Köln
Edmond Couchot: Historische Zeit und „uchronische“ Zeit. Gedächtnis und Vergessen anders denken
The Digital Oblivion. Substanz und Ethik in der Konservierung digitaler Medienkunst | Symposium Do, 04.11.2010 – Fr, 05.11.2010 Edmond Couchot counterposed the concept of »chronic time« with that of »uchronic time«. The latter was shaped by simulations, eventualities and possibilities – it refers to a condition of permanent present-ness, free from delay, duration and action. Via the Internet, everyone can construct their own history, but these stories are not reproducible. Perhaps an archive functioning like an organic, living memory might serve as a medium to transmit these stories. The digital technologies (computers, global communication networks, multimedia, electronic games or art installations) have not merely changed our relationship with the world and the other, they have shaken our relationship with time and rocked the very foundations of our culture. We are torn between two temporalities. The first temporality belongs to chronic time, the longitudinal time of history, of the events absorbed and retained by writing, writing being what organises memory and oblivion. The second temporality belongs to machines and plunges us in a time outside of time, that virtual or »uchronic« time where events give way to eventualities. What happens to our world when writing, which has guaranteed the permanence of history until now, conforms to the model of hypertext and splits? When the thread which history spans from past and present to the future threatens to tear under the pressure of »uchronic« time? Are we to reinvent our relationship to time? What are the consequences of this change of temporality for the conservation of digital art works and for the sphere of art more generally? Edmond Couchot is »Docteur d’État« and »Professeur émérite des universités«. He has directed the master studies in art and technology of the image at the Université Paris 8 for twenty years and continues to participate in research activities at the Centre for Digital Imagery and Virtual Reality. /// Laut Edmond Couchot verändern die digitalen Technologien (Computer, globale Kommunikationsnetzwerke, Multimedia, elektronische Spiele oder künstlerische Installationen) nicht nur unsere Beziehung zur Welt und zum Anderen, sie bringen ebenfalls unsere Beziehung zur Zeit durcheinander und erschüttern die Grundlagen unserer Kultur. Wir finden uns zwischen zwei Zeitlichkeiten zerrissen. Die eine Zeitlichkeit ist der chronischen Zeit eigen, der langen Zeit der Geschichte, der Ereignisse, die von der Schrift, die das Gedächtnis und das Vergessen organisiert, aufgenommen und fixiert werden. Die andere Zeitlichkeit gehört den Maschinen und versetzt uns in eine Zeit, die außerhalb der Zeit liegt, in eine virtuelle oder »uchronische« Zeit, in der das Ereignis der Eventualität weicht. Was wird aus unserer Welt, wenn die Schrift, die bis jetzt die Permanenz der Geschichte garantiert hat, sich dem Modell des Hypertexts anpasst und sich spaltet? Wann wird der rote Faden, den die Geschichte zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spannt, unter dem Druck der »uchronischen« Zeit abreißen? Müssen wir unsere Beziehung zur Zeit neu erfinden? Was sind die Folgen dieser Veränderung der Zeitlichkeit für die Konservierung digitaler Kunst und für die Kunst allgemein? Ursprünglich bildender Künstler, schafft Edmond Couchot seit den sechziger Jahren interaktive kybernetische Installationen, die auf Klang reagieren und die Teilnahme des Betrachters erregen.
"Die Zeit ist kurz" (1 Kor 7, 29) - Besinnliche Gedanken zur Zeit und zur menschlichen Zeitlichkeit.
Ref.: Weihbischof Dr. Heiner Koch, Köln
TVW#09 - Previously on ... Zur Ästhetik der Zeitlichkeit neuerer TV-Serien Konferenz des Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs »Medien und kulturelle Kommunikation« MIT: Benjamin Hahn, Felix Raczkowski INTERVIEWS: Oliver Fahle: Die Simpsons und der Fernseher (The Simpsons) Kay Kirchmann: Neue Tendenzen in us-amerikanischen Serien (House M.D. & Gilmore Girls) Isabell Otto: Countdown der Krankheit (House M.D.) Tanja Weber/Christian Junklewitz: »To Be Continued ...« – Funktion und Gestaltungsmittel des Cliffhangers in aktuellen Fernsehserien Arno Meeting: Super Heroes. Differenz, Wiederholung und Temporalität in Comic und Fernsehen (Heroes) Michael Cuntz: Harry’s Dirty Nightmare. Nächtliche Serientäterschaft als kontrolliertes Nichtnormalsein in Dexter (Dexter)
Zeitlichkeit und mystische Erfahrung
Sun, 1 Jan 1989 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/4311/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/4311/1/4311.pdf Brück, Michael von Brück, Michael von (1989): Zeitlichkeit und mystische Erfahrung. In: Evangelische Theologie, Vol. 492: pp. 142-160. Evangelische Theologie
Zeitlichkeit und mystische Einheitserfahrung
Sun, 1 Jan 1989 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/4309/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/4309/1/4309.pdf Brück, Michael von Brück, Michael von (1989): Zeitlichkeit und mystische Einheitserfahrung. In: Dürr, H.-P. (Hrsg.), Geist und Natur. Scherz: München, pp. 262-278. Evangelische Theologie