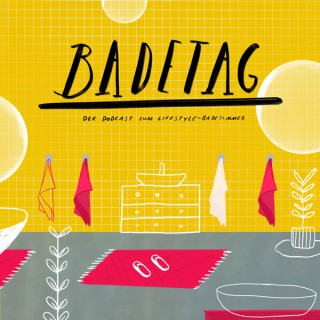Podcasts about die modelle
- 25PODCASTS
- 30EPISODES
- 32mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Oct 23, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about die modelle
Latest news about die modelle
- Taktische Zeichen Nummerierung für Kartenmarkierung, Schadenskonto und Memo mit Magnet / ... Thingiverse - Newest Things - Mar 21, 2025
- Reduzierung von Bias bei der Kreditwürdigkeitsprüfung mit generativer KI MongoDB | Blog - Feb 20, 2024
Latest podcast episodes about die modelle
Extra: Expected Goals im Check: Wie funktionieren die Modelle?
Expected Goals sind im Fußball in aller Munde. Auch wir bei Bohndesliga sprechen häufig über Expected Goals. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff? Bohndesliga-Analyst Tobi hat eine kleine Präsentation vorbereitet, in der er Niko und Nils darüber aufklärt, was hinter dem Begriff steckt. Er erklärt, warum gute Expected-Goals-Modelle zahlreiche Faktoren berücksichtigen. Ihr lernt, warum zwei Modelle selten die gleichen Daten ausspucken. Zugleich beleuchtet Tobi, worin sich ein gutes Modell von einem schlechten unterscheidet. Am Ende seid ihr (hoffentlich) ein wenig fitter in Sachen Expected Goals als vorher! Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Maximal zwei Stück pro Kunde: Letzte Chance auf günstige Fire-TV-Fernseher bei Amazon
Bei Amazon sind aktuell die Fire TV 4-Serie in Größen von 43 bis 55 Zoll stark reduziert. Die Modelle bieten eine gute Ausstattung und sind in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie sich gut an verschiedene Raumgrößen und Anforderungen anpassen. Da das Angebot nur noch bis heute Abend gilt, lohnt es sich, zeitnah vorbeizuschauen.
Später wird teuer: fokussierte Piloten für den Mittelstand
In dieser Folge sprechen Oliver und Alois über KI im Mittelstand und die Lücke zwischen Hype und tatsächlicher Nutzung. Der Mittelstand bleibt Rückgrat der Wirtschaft, kämpft aber mit Legacy-Systemen und Generationenwechsel. Ihr Vorschlag: nicht im Kernprozess starten, sondern in begleitenden Bereichen wie Service oder Vertrieb einen klaren Schmerzpunkt wählen, diesen als 12-Wochen-Pilot mit Vorher-nachher-Messung testen und daraus lernen. Die Modelle werden iterativ reifer, kleine spezialisierte Varianten reichen oft; entscheidend sind saubere Abläufe, verlässliche Daten, klare Verantwortlichkeiten und einfache Regeln für Qualität und Sicherheit. Technisch pragmatisch bleiben: offene Modelle dort betreiben, wo es sinnvoll ist, für komplexere Fälle APIs nutzen, Kosten, Datenschutz und Lock-in im Blick. Europa bietet genügend Bausteine und Partner – Abwarten ist keine Strategie. Fazit: jetzt starten, klein und messbar vorgehen, den eigenen KI- und Datenmuskel aufbauen und Schritt für Schritt Wirkung erzielen.Wesentliche Learnings• Nicht warten, jetzt starten – klein, risikoarm, messbar• Erst außerhalb des Kernprozesses beginnen (z. B. Service, Vertrieb)• Drei KPIs definieren (Antwortzeit, Lösungsquote, Zufriedenheit) und Vorher-nachher vergleichen• 12-Wochen-Pilot: erst Mitarbeitende unterstützen, dann Routinefälle teilautomatisieren• Qualität vor Größe: kleines Senior-Kernteam, das KI-Werkzeuge souverän nutzt• Governance früh klären: Datenzugriffe, Verantwortlichkeiten, Review/Freigaben• Abhängigkeiten reduzieren: Hybrid fahren, Tokenkosten und Lock-in aktiv managen• KI- und Datenkompetenz zur Chefaufgabe machen und regelmäßig trainieren• Europäische Optionen prüfen und Partner einbinden statt auf „das eine“ Modell zu warten• Iteration akzeptieren: kein Big Bang, sondern stetige, messbare Verbesserungen
Lexus zeigt den neuen, vollelektrischen RZ
Auto - Rund ums Auto. Fahrberichte, Gespräche und Informationen
Noch kann man ihn nicht bestellen, aber Lexus hat schon die meisten Informationen dazu veröffentlicht. Über den neuen, vollelektrischen RZ. Ein paar wissenswerte Details können wir Ihnen daher schon verraten. Auch wenn die technischen Daten noch nicht endgültig feststehen, weil das Fahrzeug noch nicht homologiert ist – da wird sich nicht mehr viel ändern! Bei den Preisen für den überarbeiteten RZ hält sich Lexus noch bedeckt. Der Marktstart ist aber auf Herbst 2025 datiert. Somit werden auch die Preise bald bekannt sein! Darum geht es diesmal!Lexus präsentiert den neuen, vollelektrischen RZ. Und der bekommt mehr Leistung, mehr Fahrdynamik und, was für mich besonders relevant ist, mehr Reichweite und hebt so das vollelektrische Fahren auf ein neues Niveau. Das Crossover-Modell wurde umfassend weiterentwickelt und verbindet die Vorzüge des batterieelektrischen Antriebs mit den markentypischen Eigenschaften der Lexus Driving Signature – Komfort, Kontrolle und Vertrauen.Power und Drive! Den neuen Lexus RZ wird man in drei verschiedenen Leistungsvarianten ordern können, noch sind die Daten vorläufig und vorbehaltlich der ausstehenden Homologation. Die Modelle tragen die Typenbezeichnungen RZ 350e FWD, also Frontantrieb, RZ 500e AWD und RZ 550e AWD, das Kürzel steht bekanntlich für Allradantrieb. Die Leistungsausbeute dürfte bei 165/224 (kW/PS), 280/380 (kW/PS) und 300/408 (kW/PS) liegen. Die Beschleunigungswerte von 0-100 km/h liegen zwischen 7,5 und 4,4 Sekunden. Interessant ist der Blick auf die Reichweite! Sie liegt je nach Motorisierung zwischen 450 und 568 Kilometern. Der Elektroantrieb wurde deutlich verbessert. So kommt eine neue Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh Kapazität und Vorkonditionierung zum Einsatz, das sorgt für optimierte Ladezeiten bei jeder Wetterlage. Zu den wichtigsten Änderungen gehören zudem die Einführung einer neuen e-Achse mit verbesserter Motorleistung, gesteigerter Effizienz des Inverters und einer deutlichen Reduzierung der Energieverluste. Navigation mit EV-RoutenplanungNeue Technik – hier Elektroantriebe – verlangt auch nach neuen Lösungen. So berücksichtigt die neue EV-Routenplanung des Navigationssystems bei der Berechnung der Strecke auch den jeweils aktuellen Ladestand der Fahrzeugbatterie. Die Routen werden dann inklusive der erforderlichen Ladestopps und der Auswirkungen auf die Gesamtfahrzeit geplant. Das System zeigt auch alternative Ladestationen mit Angaben zur voraussichtlichen Wartezeit und einer angepassten Ankunftszeit an. Diese werden nach der Entfernung in Luftlinie vom Standort des Fahrzeugs priorisiert.Das Gesamtbild! Natürlich gibt es über den neuen Lexus RZ noch viel mehr zu berichten, aber Sie kennen das ja. Uns fehlt dazu leider die nötige Sendezeit. Aber keiner Sorge, das holen wir nach. Zu gegebener Zeit! Alle Fotos: © Toyota Deutschland GmbH Diesen Beitrag können Sie nachhören oder downloaden unter:
Robin Alexanders Letzte Chance, Realität vs Resonanz, Salon-Teaser
Sat, 05 Jul 2025 04:00:00 +0000 https://feed.neuezwanziger.de/link/21941/17075154/a9d6ef39-1f90-4234-8676-2ed2d782ad20 173d9691e6cc2ce1c5a3e9284072aa7d Wolfgang und Stefan treffen sich vorm Salon Live-Termine 2025 Fr. 19.09. / Fr. 19.12. Tickets per Mail: neuezwanziger@diekaes.de SOMMERSALON am 23. August! Tickets gibts hier Alles hören Komm' in den Salon. Es gibt ihn via Webplayer & RSS-Feed (zum Hören im Podcatcher deiner Wahl, auch bei Apple Podcasts und Spotify). Wenn du Salon-Stürmer bist, lade weitere Hörer von der Gästeliste ein. Literatur Springer-Journalist Robin Alexander erzählt in „Letzte Chance. Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie“ das Scheitern der Ampel nach und versucht sich an Erklärungen für den ganz auf Migration ausgerichteten Wahlkampf. Das Sittenbild der Politik ist unfreiwillig auch eines des Journalismus. penguin.de Der große Regisseur Dominik Graf legt mit „Sein oder Spielen. Über Filmschauspielerei“ ein anekdotenreiches Erinnerungsbuch über seine Arbeit mit Schauspielern vor, das zugleich ein Kompendium über Schauspielerei und ein persönlich gehaltenes Lexikon großer Momente der Filmgeschichte ist. chbeck.de Sam Altman verkauft uns seine KI als „Gentle Singularity“. Wenn die Versprechen so gut aufgehen wie alle vorherigen des Silicon Valley, wird es schlimm. blog.samaltman.com Wie ist es, wenn man plötzlich durch Krypto-Investments einen Klassensprung vollzieht? In seinem Buch „Tausendmal so viel Geld wie jetzt“ trifft sich der Schriftsteller Juan S. Guse mit ungewöhnlichen Krypto-Millionären: Sie protzen nicht in Dubai oder auf Yachten, sie sind Sleeper. fischerverlage.de In der NYT diskutieren die Demoskopen Nate Silver und Kristen Soltis Anderson über Trumps Umfragewerte. Wir ziehen auch Lehren für die Bundesregierung daraus. nytimes.com Die Schriftstellerin Barbi Marković nennt ihre Poetikvorlesungen „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ und erklärt ihr Schreiben so geistreich wie amüsant. rowohlt.de MIT-Forschung zu KI als Assistenz im Schreibprozess zeigt das Phänomen kognitiver Verschuldung. Was sich einfach anfühlt, wird doch recht schnell belastend. media.mit.edu Tausende indische Studenten liefern auf Fahrrädern Essen aus: Ein Abkommen zwischen Deutschland und Indien hat vielen ein Studium in Berlin und in anderen Städten ermöglicht. Nina Scholz erzählt in der „taz“ unglaubliche, aber wahre Geschichten der Ausbeutung. taz.de Apple hat sich kritisch mit LLMs befasst. Es gebe „fundamentale Grenzen“ für die neuen KIs, die offensichtlich die Produktentwicklung erschweren. machinelearning.apple.com Wozu noch Journalismus, wenn doch alles offensichtlich ist? Tyler Pager mit einem sehr wichtigen Pointen-Kommentar zu Donald Trump. nytimes.com Das preisgekrönte Simply Quartet interpretiert furios Streichquartette von Mendelssohn und Dvořák. genuin.de Shownotes 00:00:00 Vor dem Salon Wolfgang und Stefan beginnen den Podcast mit einer Diskussion über die sommerliche Hitzewelle und die unterschiedlichen Strategien, damit umzugehen – von der heimischen Klimaanlage bis hin zur KI-gestützten Planung des perfekten Schattenplatzes im Freibad. Diese Alltagsbeobachtung leitet über zur zentralen Frage, wo Technologie wirklich hilft und wo sie unnötig verkompliziert. Das Hauptthema der Folge wird vorgestellt: eine kritische Auseinandersetzung mit dem Buch „Letzte Chance“ des Journalisten Robin Alexander. Die Gastgeber kritisieren bereits im Vorfeld den von Alexander repräsentierten Politikjournalismus, der auf Emotionalisierung und personalisierte Storys setzt, anstatt strukturelle Probleme zu analysieren. Anhand eines Vergleichs von Alexanders Auftritten bei „hart aber fair“ und „Table Media“ wird dessen argumentativer Opportunismus aufgezeigt. Ein Exkurs zum Magier Penn Jillette dient als philosophische Grundlage, um über Wahrheit, Erinnerung und die Notwendigkeit von Vertrauen zu reflektieren. Diese Kritik wird auf die mediale Berichterstattung zu Ereignissen wie den Attentaten in Magdeburg und Aschaffenburg ausgeweitet, bei denen die emotionale Reaktion von Politikern wie Friedrich Merz im Mittelpunkt steht, während die Rolle der Medien, insbesondere des Springer-Verlags, unreflektiert bleibt. 00:57:15 Robin Alexander: Letzte Chance Im Hauptteil der Folge sezieren Wolfgang und Stefan das Buch „Letzte Chance“. Sie kritisieren die narrative Strategie, Politik als eine Abfolge von persönlichen Krisen und emotionalen Reaktionen darzustellen. Als zentrales Beispiel dient die Szene, in der Friedrich Merz durch das Video von Selenskyjs Demütigung im Oval Office angeblich zur Reform der Schuldenbremse bewegt wird – eine Darstellung, die die Gastgeber als vorgeschobene Rechtfertigung für einen längst geplanten Politikwechsel entlarven. Das Buch, so die Kritik, biete keine tiefgehende Analyse, sondern eine oberflächliche Chronik der Ampel-Koalition, um Friedrich Merz als alternativlose Führungsfigur zu inszenieren. Dabei werden wichtige politische und soziale Themen wie die Kindergrundsicherung oder die tatsächliche Substanz des CDU-Wirtschaftsprogramms komplett ausgeblendet. Auch die Darstellung der Greichen-Affäre und des Heizungsgesetzes wird als beispielhaft für einen Journalismus kritisiert, der die Rolle der eigenen Medien bei der Skandalisierung ignoriert. Ein besonderer Fokus liegt auf der undurchsichtigen Rolle der FDP beim Bruch der Koalition und der bemerkenswerten Zusammenarbeit der Union mit der Linkspartei, um Merz' Kanzlerwahl zu sichern. Die Analyse gipfelt in der Feststellung, dass das Buch ein Paradebeispiel für einen Journalismus ist, der in seiner eigenen Blase gefangen ist und durch seine Fixierung auf Insider-Geschichten die eigentlichen Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Probleme verschleiert. 02:58:40 Dominik Graf: Sein und Spielen Wolfgang stellt das Buch „Sein oder Spielen“ des Regisseurs Dominik Graf vor. Es ist keine systematische Abhandlung, sondern ein sehr persönliches Kompendium und eine Sammlung von Anekdoten und Beobachtungen zur Kunst der Filmschauspielerei. Graf teilt seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Schauspielern wie Götz George und analysiert die Techniken von Ikonen wie James Dean oder Alain Delon. Dabei werden gegensätzliche Ansätze wie Method Acting und reines Handwerk gegenübergestellt. Ein zentraler Gedanke ist die Bedeutung von Verletzlichkeit und emotionaler Instabilität als kreative Ressource, die durch moderne Tendenzen zur Selbstoptimierung und „Resilienz“ verloren zu gehen droht. Das Buch wird als eine Fundgrube für Film- und Schauspiel-Enthusiasten beschrieben, die Lust darauf macht, die besprochenen Filme und Szenen neu zu entdecken. 03:11:46 Sam Altman: The Gentle Singularity Stefan analysiert einen Text von OpenAI-CEO Sam Altman, in dem dieser seine Vision einer „sanften Singularität“ skizziert. Stefan äußert von Beginn an fundamentale Skepsis gegenüber Altmans optimistischem Zukunftsbild. Altman prophezeit, dass künstliche Superintelligenz bald zur Routine gehören und enorme Fortschritte in Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen wird, angetrieben von einem Überfluss an Intelligenz und Energie. Stefan kritisiert diese Vorhersage als naiv und gefährlich, da sie die realen Probleme der Machtkonzentration, der wirtschaftlichen Ungleichheit und der gesellschaftlichen Verwerfungen, die durch KI entstehen könnten, völlig ausblendet. Der Text dient als Dokumentation einer bedenklichen Ideologie aus dem Silicon Valley. 03:31:39 Juan S. Guse: Tausendmal so viel Geld wie jetzt Wolfgang bespricht das Buch von Juan S. Guse, eine literarische Reportage über die verborgene Welt der Kryptomillionäre. Guse porträtiert nicht die lauten Neureichen, sondern die sogenannten „Sleeper“ – Menschen, die im Stillen durch Krypto-Investitionen reich geworden sind und oft mit der daraus resultierenden Perspektivlosigkeit und Verunsicherung kämpfen. Das Buch ergründet die Motivationen junger Menschen, die in alternativen Vermögensbildungen eine letzte Chance sehen, den ökonomischen Abstieg zu verhindern. Besonders eindrücklich schildert Guse die Atmosphäre einer Kryptokonferenz in Barcelona, die er als quasi-religiöses Ereignis für eine Gemeinschaft von Eingeweihten beschreibt, die an einen bevorstehenden technologischen und gesellschaftlichen Umbruch glauben. 03:48:51 Nate Silver und andere zu Trumps Umfragewerten Stefan fasst eine Diskussion aus der New York Times mit den Analysten Nate Silver und Kristen Soltis Anderson über die politische Lage von Donald Trump zusammen. Obwohl Trumps Zustimmungswerte relativ stabil sind, zeigen sich deutliche Schwächen bei zentralen Wirtschaftsthemen wie der Inflation. Das Thema Einwanderung hingegen ist eine Stärke, da er hier von vielen als entscheidungs- und handlungsstark wahrgenommen wird. Die Experten diskutieren mögliche Strategien für die Demokraten, die sich von ihrem Image des „Insider-Spiels“ lösen und mit jüngeren, radikaleren Kandidaten und Themen punkten müssten, um eine Chance zu haben. 03:56:59 Barbi Marković: Stehlen, Schimpfen, Spielen Wolfgang stellt begeistert die Poetikvorlesungen der Schriftstellerin Barbi Marković vor. Das Buch ist humorvoll als Countdown zur Abgabe der Vorlesung gestaltet und reflektiert auf brillante Weise den Schreibprozess selbst. Marković demonstriert ihren spielerischen Umgang mit Sprache und Literatur, etwa durch einen Remix eines Thomas-Bernhard-Textes oder die Verwendung von Disney-Figuren als universelle Identifikationsfiguren für ihre Alltagsbeobachtungen in Wien. Im Kern des Buches steht die komplexe Beziehung zwischen Realität, Fiktion und der subjektiven Wahrheit des Textes, was es zu einer intelligenten und unterhaltsamen Lektüre über das Wesen des Schreibens macht. 04:10:55 MIT: Your Brain on ChatGPT Stefan diskutiert eine Studie des MIT Media Lab, die die neuronalen Auswirkungen der Nutzung von ChatGPT beim Verfassen von Texten untersucht. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Probanden, die KI-Hilfe nutzten, zeigten eine geringere Gehirnaktivität und eine stärkere Entfremdung vom eigenen Text. Originalität und Vielfalt der Texte nahmen ab, während die Konformität stieg. Die Studie legt nahe, dass die Bequemlichkeit von KI-Werkzeugen einen kognitiven Preis hat und die tiefere Auseinandersetzung mit einem Thema behindern kann. Interessanterweise wird in der Studie die Google-Suche, einst selbst als oberflächlich kritisiert, nun als positiver Vergleichsmaßstab zur LLM-Nutzung herangezogen. 04:22:19 Nina Scholz: Das Geschäft mit den Studis Wolfgang fasst eine umfangreiche Recherche der Journalistin Nina Scholz für die taz zusammen. Der Artikel beleuchtet das Geschäft mit indischen Studierenden in Deutschland. Diese werden von privaten Hochschulen wie der IU mit hohen Studiengebühren und dem Versprechen auf eine exzellente Ausbildung nach Deutschland gelockt. Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Die Studierenden landen in teuren, überfüllten möblierten Wohnungen und müssen hauptsächlich an Online-Kursen teilnehmen. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, arbeiten viele unter prekären Bedingungen als Lieferfahrer. Der Text kritisiert die mangelnde Verantwortung von Bildungsinstitutionen und Politik. 04:31:14 Apple: The Illusion of Thinking Stefan bespricht ein bemerkenswertes Forschungspapier von Apple, das die Grenzen der aktuellen KI-Modelle aufzeigt. Entgegen dem Hype um die „Reasoning“-Fähigkeiten von LLMs demonstriert Apple, dass diese Systeme bei neuartigen und komplexen Problemen oft versagen. Die Modelle neigen zu „Overthinking“ oder geben bei schwierigen Aufgaben vorschnell auf. Mit dieser Veröffentlichung positioniert sich Apple als ein Unternehmen, das auf robuste und verlässliche technologische Lösungen abzielt, anstatt auf die unberechenbaren „Gimmicks“ der Konkurrenz. Es ist eine deutliche Kritik an der aktuellen Praxis, unausgereifte KI-Produkte auf den Markt zu bringen. 04:41:14 NYT: Online and IRL, Trump Offers a Window Into His Psyche Stefan verweist kurz auf einen Artikel der New York Times, der argumentiert, dass man für das Verständnis von Donald Trumps Politik keine tiefschürfenden Deutungsbücher brauche. Alles Wesentliche sei direkt in seinen öffentlichen Äußerungen und Handlungen sichtbar. 04:41:42 Simply Quartet: Streichquartette von Mendelssohn und Dvořák Zum Abschluss empfiehlt Wolfgang eine Aufnahme des Simply Quartet. Im Mittelpunkt steht Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichquartett Nr. 6 in f-Moll, op. 80. Das Werk entstand als direkte Reaktion auf den plötzlichen Tod seiner geliebten Schwester Fanny und ist ein Ausdruck tiefsten Schmerzes. Es ist ein dramatisches, leidenschaftliches und fragmentiertes Stück, das mit den klassischen Konventionen bricht und in seiner harmonischen Kühnheit bereits auf das 20. Jahrhundert vorausweist. Wolfgang lobt die außergewöhnliche Dynamik und Präzision der Interpretation durch das Simply Quartet. full Wolfgang und Stefan treffen sich vorm Salon no Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmitt 3377
DeepSeek, 100 GW Photovoltaik, Mond-Rechenzentrum | #heiseshow
Markus Will, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und Malte Kirchner sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Tiefe Verunsicherung: Mischt DeepSeek den KI-Markt wirklich auf? Das chinesische KI-Startup DeepSeek sorgt mit seinen Sprachmodellen für Aufsehen im Silicon Valley. Die Modelle sollen in Benchmarks teilweise besser abschneiden als GPT-4. Was bedeutet der Einstieg chinesischer KI-Firmen für den globalen Markt? Was macht DeepSeek anders? Welche Rolle spielen dabei geopolitische Spannungen? Und wie reagieren etablierte Player wie OpenAI und Anthropic? - Sonnige Aussichten: 100 Gigawatt Photovoltaik installiert – Deutschland erreicht einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die installierte Photovoltaikleistung überschreitet erstmals die 100-Gigawatt-Marke. Reicht das Tempo beim Ausbau für die Klimaziele? Welche Rolle kann Photovoltaik spielen? Wie können Lieferengpässe und Fachkräftemangel bewältigt werden? - Trabantenträume: Stehen künftig Rechenzentren auf dem Mond? Ein Prototyp für das erste Rechenzentrum auf dem Mond soll im Februar starten. Die Vision: Datenverarbeitung im Weltall könnte Energie sparen und neue Möglichkeiten eröffnen. Welche technischen Herausforderungen gilt es zu meistern? Ist ein Rechenzentrum auf dem Mond mehr als eine teure Marketing-Aktion? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
DeepSeek, 100 GW Photovoltaik, Mond-Rechenzentrum | #heiseshow
Markus Will, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und Malte Kirchner sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Tiefe Verunsicherung: Mischt DeepSeek den KI-Markt wirklich auf? Das chinesische KI-Startup DeepSeek sorgt mit seinen Sprachmodellen für Aufsehen im Silicon Valley. Die Modelle sollen in Benchmarks teilweise besser abschneiden als GPT-4. Was bedeutet der Einstieg chinesischer KI-Firmen für den globalen Markt? Was macht DeepSeek anders? Welche Rolle spielen dabei geopolitische Spannungen? Und wie reagieren etablierte Player wie OpenAI und Anthropic? - Sonnige Aussichten: 100 Gigawatt Photovoltaik installiert – Deutschland erreicht einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die installierte Photovoltaikleistung überschreitet erstmals die 100-Gigawatt-Marke. Reicht das Tempo beim Ausbau für die Klimaziele? Welche Rolle kann Photovoltaik spielen? Wie können Lieferengpässe und Fachkräftemangel bewältigt werden? - Trabantenträume: Stehen künftig Rechenzentren auf dem Mond? Ein Prototyp für das erste Rechenzentrum auf dem Mond soll im Februar starten. Die Vision: Datenverarbeitung im Weltall könnte Energie sparen und neue Möglichkeiten eröffnen. Welche technischen Herausforderungen gilt es zu meistern? Ist ein Rechenzentrum auf dem Mond mehr als eine teure Marketing-Aktion? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
DeepSeek, 100 GW Photovoltaik, Mond-Rechenzentrum | #heiseshow
Markus Will, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und Malte Kirchner sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Tiefe Verunsicherung: Mischt DeepSeek den KI-Markt wirklich auf? Das chinesische KI-Startup DeepSeek sorgt mit seinen Sprachmodellen für Aufsehen im Silicon Valley. Die Modelle sollen in Benchmarks teilweise besser abschneiden als GPT-4. Was bedeutet der Einstieg chinesischer KI-Firmen für den globalen Markt? Was macht DeepSeek anders? Welche Rolle spielen dabei geopolitische Spannungen? Und wie reagieren etablierte Player wie OpenAI und Anthropic? - Sonnige Aussichten: 100 Gigawatt Photovoltaik installiert – Deutschland erreicht einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die installierte Photovoltaikleistung überschreitet erstmals die 100-Gigawatt-Marke. Reicht das Tempo beim Ausbau für die Klimaziele? Welche Rolle kann Photovoltaik spielen? Wie können Lieferengpässe und Fachkräftemangel bewältigt werden? - Trabantenträume: Stehen künftig Rechenzentren auf dem Mond? Ein Prototyp für das erste Rechenzentrum auf dem Mond soll im Februar starten. Die Vision: Datenverarbeitung im Weltall könnte Energie sparen und neue Möglichkeiten eröffnen. Welche technischen Herausforderungen gilt es zu meistern? Ist ein Rechenzentrum auf dem Mond mehr als eine teure Marketing-Aktion? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
#47 - Social (to) Commerce 2.0: Das uninspirierte Amazon Inspire, die EU Rückkehr von TikTok Shops, die Modelle der Zukunft und wie "social" kann KI sein? Mit Jochen Krisch | Social Commerce Chat #4
In dieser Folge sprechen Jochen und ich (Kristina) über den Begriff "Social to Commerce" und darüber, ob eine neue Terminologie im Social Commerce notwendig ist. Wir diskutieren wie sich der Point of Sale, die Verkaufsumgebung und die Schnittstellen verändern. Auch Amazon's (fast schon amüsante) Versuch, Nutzern mit Amazon Inspire einen TikTok-ähnlichen Shopping Feed zu bieten, sowie die Partnerschaft mit TikTok Shop werden unter die Lupe genommen. Während Amazon traditionell die Plattform der Wahl für Affiliate-Influencer und kleinere Marken ist, stellen das nahtlose Einkaufserlebnis, der Entertainment-Faktor und die Influencer-Community von TikTok natürlich eine zunehmend große Bedrohung dar - die allerdings auch kein deutscher Händler so richtig wahrhaben will. Schon mal vorweg: TikTok's Aggressivität im eCommerce ist keinesfalls zu unterschätzen. Viel Spaß beim Hören! Über unseren Gast Jochen Krisch > Exciting Commerce > Exchanges Podcast > Jochen auf LinkedIn wieCommerce? Social Links > Instagram > LinkedIn > Weitere Plattformen Timestamps (00:00) Intro (02:48) Social Commerce, Social to Commerce, Commerce to Social - Brauchen wir eine neue Begriffswelt? (10:51) Anyjoi & co. - Welches Modell macht das Rennen? (17:38) Amazon's semi-gelungene Antwort auf TikTok - Amazon Inspire (27:22) Marktplatz Inception - TikTok's Partnerschaften mit Amazon, Meta & co. (40:45) Wie social ist KI Content? (56:44) Dating-Apps als Inspirationsquelle for Social Commerce Interface Designs? (1:09:15) Was bringt die Zukunft? (1:12:18) Social Commerce Conference in Berlin - 10.10.2024 Logo Design: Naim Solis Intro & Jingles: Kurt Woischytzky Fotos: Stefan Grau Intro-Video: Tim Solle
#690 Inside Wirtschaft - Tolle Immo Talk: Digitale Daten in der Immo-Branche - Interviews A. Sanftenberg/ N. Mehrafshan
Inside Wirtschaft - Der Podcast mit Manuel Koch | Börse und Wirtschaft im Blick
Zwar schreitet die Digitalisierung voran, aber noch immer liegen ganz viele entscheidende Informationen nicht abrufbar vor. So sind auch digitale Daten in der Immobilienbranche noch zu wenig vorhanden. “Es gibt in vielen Bereichen noch zu wenig Digitalisierung, z.B. die Daten, die wir aus Kaufverträgen sammeln können - grundstücksbezogen, Wohnungsgrößen usw. Für Käufer und Verkäufer wären diese Daten nützlich. Und es geht auch um Steuerthemen”, sagt Corvin Tolle (Geschäftsführer Tolle Immobilien). Prof. Anne Sanftenberg entwickelt im Rahmen eines Forschungsprojektes mit PriceHubble zusammen einen KI-gestützten Bewertungsalgorythmus für Mehrfamilienhäuser. “Mehrfamilienhäuser sind klassische Rendite-Liegenschaften. Unsere Datenbasis sind echte Transaktionsdaten des Berliner Gutachter-Ausschusses seit 1990”, so Prof. Sanftenberg (DSI Data Science Institut). "Die Modelle die wir daraus entwickeln, können wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Bisher hat Deutschland viele Daten nicht öffentlich, das ist z.B. in Frankreich anders. Wir könnten deutlich mehr Transparenz schaffen", so Dr. Nima Mehrafshan (PriceHubbe). Alle Details im Tolle Immo Talk und auf https://tolle-immobilien.de
Die Modelle von Tesla gehören zu den beliebtesten E-Autos weltweit – im letzten Jahr lag das Model 3 mit 3697 Zulassungen und großem Abstand vorne. Ob der Hype um den amerikanischen Hersteller unter der Leitung von Elon Musk begründet ist, können Interessenten mit einer Probefahrt selbst herausfinden. Wie das funktioniert, lest ihr hier.
VW etabliert die Marke Scout in den USA für Elektro-Pick-Ups
Der VW-Konzern gründet in den USA die neue Marke Scout. Mit Scout will VW einen vollelektrischen Pickup-Truck und einen robusten SUV speziell für den amerikanischen Markt produzieren. Die Modelle werden nächstes Jahr vorgestellt und sollen den Wolfsburgern in den USA mehr Marktanteile verschaffen. Mehr auf energyload.eu >>> https://energyload.eu/elektromobilitaet/elektroauto/vw-scout/
Wer kennt es nicht – da kauft man sich neue Schuhe, damit man trockenen Fußes durch die Schmuddel-Wetter-Zeit kommt und die Schuhe halten nicht was sie versprechen??? Ja das kennt jeder, egal ob bei konventionellen oder Minimal-Schuhen. Und der Bedarf ist groß bei Minimalschuhträgern – drum haben wir tolle Modelle getestet. Die Firma Xero kommt mit einem leichten veganen Boot auf den Markt – Xero Denver. Dieser ist aus Canvas und veganen Leder-Applikationen gefertigt und erhältlich in braun und in schwarz. Alex ist begeistert von dem angenehmen weichen Material was den Fuß umschmeichelt und nicht begrenzt auch wenn die Sohle (nach wie vor) recht schmal und ungerade geschnitten ist. Das Flanell- Innenfutter macht ein tolles Klima, so dass es bei ungemütlichen kalten Temperaturen warm bleibt. Das Obermaterial ist wasserabweisend bzw. bis zu den ersten Ösen, wasserdicht. Allerdings ist die Zunge seitlich nicht angenäht, so dass hier ab dem Mittelfuß Wasser schnell eindringt – sehr schade. Auch die relativ steife Sohle wird auf feuchtem Untergrund rutschig. Xero darf da echt noch nachlegen. Die Modelle von Freet Barefoot können sich mal wieder im Härtetest beweisen. Alex hat den Tundra in der Ostsee baden lassen und meine Modelle haben den Teutoburger Wald-Matsch kennengelernt. Tundra und Ibex sind zwei fast identische Boots, die sich nur im Obermaterial unterscheiden: Tundra im schwarzen veganen Leder und Ibex aus braunem weichen Echtleder. Beide werden als wasserabweisend angepriesen, sind aber absolut wasserdicht. Die Zunge ist bis oben angenäht und das Material – egal ob veganes oder echtes Leder – ist dicht. Die Ostsee und der Matsch perlten einfach wieder ab und die Füße blieben trocken. Zusätzlich finden wir die hochflexible und rutschfeste Sohle sehr spannend. Beide Schuhmodelle können sich echt sehen lassen – nicht nur als Wanderschuh, auch für Alltag zur Jeans oder Leggings/Rock machen sie sich gut. Was will man mehr? [goFree Concepts](https://gofreeconcepts.de/discount/BARFUSSIMPOTT) Affiliate Link mit 5% Rabatt [Xero Denver](https://gofreeconcepts.de/collections/xero-shoes/products/xero-shoes-denver-boot-braun) Rabattcode "Barfussimpott" [Freet](https://freetbarefoot.com/de/) Rabattcode „barfussimpott“ für 10% [Freet Ibex](https://freetbarefoot.com/eu/de/product/freet-ibex/) [Freet Tundra](https://freetbarefoot.com/eu/de/product/freet-tundra/) [Facebook Gruppe](https://www.facebook.com/groups/370125074000880) [Barfuss im Pott](https://barfuss-im-pott.de/) [Körper Dynamik](http://koerper-dynamik.de/) [Knitido](https://www.knitido.de/) 10% Rabatt mit “POTT10”
Und: Die Modelle der Task Force, warum lagen sie daneben? Zudem: Kontroverse um Windturbinen als Gefahr für Vögel 1) Nanomedizin befasst sich mit Teilchen die grösser sind als Moleküle, aber doch winzig klein. Nach Jahrzehntelanger Forschung sind jetzt erste Anwendungen marktreif, beispielsweise Therapien mit Nanopartikeln gegen Krebs. Ein «Nano-Leim» wird derzeit in Tierversuchen geprüft; mit diesem antibakteriellen Leim könnten Gewebe nach Operationen verschlossen werden. Auch Nanoroboter sind Teil der «Medizin der Zukunft»; sie könnten eingesetzt werden, um verstopfte Gefässe zu reinigen. 2) Die Modelle der Covid-19 Science Task Force haben für jetzt einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen gezeigt. Warum lagen sie so falsch? Interview mit Tanja Stadler. 3) Immer mehr Windkraftanlagen werden in ganz Europa gebaut, auch in der Schweiz. Ein offener Punkt ist die Verträglichkeit für Fledermäuse und Vögel, die bei Kollisionen sterben. Eine Studie aus Grossbritannien gibt zumindest für Zugvögel teilweise Entwarnung. Wir ordnen ein und beleuchten die Situation in der Schweiz.
Heute geht es um das beste Krafttrainingsprogramm! Falls es das überhaupt gibt. Und wir erklären, wie du es an deine Umstände anpassen kannst. Viel Spaß! 1:30 Was motiviert dich morgens aus dem Bett zu kommen? 3:45 Ein letztes Wort zu den Open 6:10 Einstieg ins Thema Kraft 9:18 Status Quo in der Physiotherapie 11:36 Was ist Krafttraining - ein Review 13:20 Klassifizierung 18:00 Der Einfluss des Alters 19:30 Das Trainingsniveau 23:08 Ein-Satz vs. Mehr-Satz Training 27:15 Training mit wenig Zeit 31:00 Der Wendler 38:13 Der genetische Einfluss 43:40 Krafttraining nach der Weihnachtszeit 36:30 Die Modelle der Gewichtssteigerung 50:45 RPE - Skala 59:00 Fazit Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden. Abonniert uns bei Spotify und Apple Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Startet gut in die Woche! Instagram ToL: https://www.instagram.com/trainingohnelimit Instagram Silvan: https://www.instagram.com/silvanschlegelpt Instagram Hendrik: https://www.instagram.com/hendrik_senf
Wirtschaftsnews vom 13. Juli 2020
Thema heute: Peugeot bietet breites Angebot an e-Bikes Peugeot bietet eine breite Facette an e-Bikes für die Stadt und für das Offroad-Gelände an, die gleichzeitig praktisch, bequem und vielseitig sind. Die Modelle werden vom Peugeot Design Lab entworfen und in der CYCLEUROPE-Fabrik im französischen Romilly sur Seine produziert. Mit ihren e-Bikes, Elektroautos und Plug-In Hybriden treibt die Löwenmarke die Elektrifizierung der Mobilität weiter voran. Erhältlich sind die e-Bikes aktuell nur in Frankreich über die Website cycles.peugeot.fr. e-Bikes wichtiger denn je In der aktuellen Situation sind e-Bikes mehr denn je die Alternative zum öffentlichen Nahverkehr. Sie tragen zur Gesundheitssicherheit bei, indem sie es ermöglichen, soziale Distanzen einzuhalten, Staus in den Städten zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern. Durch die Unterstützung des Elektromotors kommen e-Bikerinnen und Biker zudem erholt und pünktlich im Büro an – denn Stau oder Parkplatzprobleme sind kein Thema. Fahrräder mit Elektroantrieb haben zudem einen geringen Stromverbrauch, so fallen im Schnitt weniger als 10 Cent pro Batterieladung an Kosten an. Peugeot e-Bikes – diese Modelle sind sofort verfügbar Das kompakte e-Bike Peugeot eLC01 verbindet klassisches Design mit modernen Technologien: Seine 400 Watt starke Batterie ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 70 Kilometern. Ideal für die Stadt eignet sich das e-Bike eCO2. Mit einer 300-Watt-Batterie ausgestattet, fährt das Modell rein elektrisch bis zu 80 Kilometer. Wer die Variante mit einer 400-Watt-Batterie wählt, kann 110 Kilometer zurücklegen. Die beiden Trekking-e-Bikes eT01 D8 und eT01 Sport sind jeweils mit einem sportlichen Diamant- oder Trapezrahmen erhältlich. Dank der Batteriekapazität von 400 Watt liegt die Reichweite der Modelle bei bis zu 110 Kilometern. Das eT01 FS PowerTube überzeugt mit einem schlanken Design, da die Batterie direkt im Rahmen verbaut wurde. Ausgestattet mit vorderen und hinteren Stoßdämpfern, fährt sich das Modell in der Stadt und auf Offroad-Gelände gleichermaßen komfortabel. Die 500-Watt-Batterie sorgt für eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern. PEUGEOT e-Bikes für jeden Geschmack PEUGEOT konzipiert seine Fahrräder, ob elektrisch oder traditionell, je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck: Stadt, Offroad, gemischtes Terrain oder speziell für Kinder. Dies lässt sich auch im Namen der Modelle erkennen, die die Linie und die Klasse widerspiegeln. Diesen Beitrag können Sie nachhören oder downloaden unter:
Im asiatischen, südeuropäischen oder auch US-amerikanischen Raum ist das Thema Po-Hygiene etwas ganz Alltägliches. Hier gilt das Dusch-WC als zeitgemäße Antwort auf ein gesteigertes Hygieneempfinden. In Asien findet sich in so ziemlich jedem Hotelbadezimmer im gehobenen Segment ein WC mit Duschfunktion, und so langsam schwappt dieser Ausstattungstrend auch nach Nord-Europa. Die Reinigung des Pos mit Wasser ist die wohl schonendste und zugleich effektivste Methode der Intimhygiene. Die innovativen Dusch-WCs kommen als Aufsatz oder als integrative Lösung nun auch in unsere privaten Bäder. Individualfunktionen machen das Dusch-WC für Frauen und Männer gleichermaßen zum Hygienezentrum Nr. 1 im Lifestyle-Badezimmer. Die Modelle werden nicht nur immer kleiner und designiger, sondern auch preiswerter. Marion und Jens von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) unterhalten sich heute über die intimeren Momente im Badezimmer. Die Intim-Hygiene gestaltet sich mit einem modernen Dusch-WC ganz einfach und sehr hygienisch. Marion will vor allem wissen, wie ein Dusch-WC denn überhaupt funktioniert und was beim Kauf und der Badplanung beachtet werden muss. Wie ist ein Dusch-WC aufgebaut? Was hat ein Dusch-WC mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun? Und mit welchen Kosten ist beim Kauf rechnen? Das Fazit: Ein Dusch-WC muss man ausprobiert und schätzen gelernt haben. Die Po-Reinigung mit warmem Wasser ist der Hygienevorsprung einer modernen Gesellschaft. Weitere Informationen: www.badetag.online und www.gutesbad.de
Gudrun traf im November 2019 Jan Richter. Er ist einer der Gründer der Batemo GmbH in Karlsruhe. Mit den Kollegiaten von SiMET hatte Gudrun das Unternehmen kurz vorher in der Technologiefabrik besucht und dabei das Podcast-Gespräch vereinbart. Batemo ist noch ein recht junges Unternehmen. Es wurde im März 2017 von Michael Schönleber und Jan Richter gegründet. Die beiden haben an der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik promoviert. Sie hatten sich schon länger mit der Idee auseinandergesetzt, im Anschluss an die Promotionszeit den Schritt zur Unternehmensgründung zu wagen. Es war klar, dass sie sich mit einem Thema beschäftigen möchten, das Ihnen ermöglicht, die Entwicklung von Akkus zu beeinflussen. Außerdem wollten sie gern ohne finanzielle Fremdmittel auskommen, um in jedem Moment die volle Kontrolle zu behalten. Inzwischen ist das gut gelungen und die Firma ist auf Simulationssoftware für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Für beliebige Lithium-Ionen-Zellen erstellen sie einen digitalen Zwilling, also ein Modell im Computer. Dass sie damit glaubwürdig für zahlungsfähige Kunden sind, liegt daran, dass sie auch die Validität dieser Modelle im gesamten Betriebsbereich nachweisen. Die Modelle sind sehr komplexe und stark nichtlinear gekoppelte Systeme aus algebraischen und partiellen Differentialgleichungen, die die physikalischen, chemischen und thermodynamische Prozesse abbilden. Sie sind auch dafür geeignet, das Verhalten der Akkus über die Lebenszeit der Zellen hin nachzubilden. Es ist besonders herausfordernd, da die Prozesse in unterschiedlichen Längen- und Zeitskalen ablaufen. Zwei Fragen, die beim Besuch mit den SiMET-Kollegiaten im Mittelpunkt des Gespräches standen, sind: Mit welchen Betriebsstrategien wird die Lebensdauer der Zellen erhöht? Wie werden innovative Schnellladeverfahren entwickelt, die die Zellen nicht zu schnell altern lassen? Im Gespräch berichtet Jan auch davon, wieso er sich für ein Studium der Elektrotechnik entschieden hat und wie er den Weg in die Selbstständigkeit von heute aus bewertet. Literatur und weiterführende Informationen A. Latz, J. Zausch: Thermodynamic consistent transport theory of Li-ion batteries, Journal of Power Sources 196 3296--3302, 2011. M. Maier: The Mathematical Analysis of a Micro Scale Model for Lithium-Ion Batteries. PhD Thesis KIT 2016 M. Kespe, H. Nirschl: Numerical simulation of lithium-ion battery performance considering electrode microstructure, International Journal of Energy Research 39 2062-2074, 2015. Podcasts A. Jossen: Batterien, Gespräch mit Markus Völter im Omega Tau Podcast, Folge 222, 2016. J. Holthaus: Batterien für morgen und übermorgen, KIT.Audio Podcast, Folge 2, 2016. D. Breitenbach, U. Gebhardt, S. Gaedtke: Elektrochemie, Laser, Radio, Proton Podcast, Folge 15, 2016. M. Maier: Akkumulatoren, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 123, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. V. Auinger: Optimale Akkuladung, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 160, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. S. Carelli, G. Thäter: Batteries, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 211, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019.
Gudrun spricht in dieser Folge mit Simone Göttlich über Verkehrsoptimierung. Die Verabredung zum Gespräch war im März am Rande einer Tagung in Bonn erfolgt. Am 23. Mai 2019 war Gudrun dann einen Tag zu Gast in der Arbeitsgruppe von Simone an der Universität in Mannheim. Im Sport starten sie gemeinsam unter dem doppeldeutigen Namen "Team Göttlich". Verkehr erleben wir täglich zu Fuß, im Auto, auf dem Fahrrad oder im ÖPNV. Wir haben oft das Gefühl, dass einiges besser geregelt sein könnte, um den Verkehrsfluss zu verbessern. In der Stadt vermischen sich viele unterschiedliche Fragen sehr komplex, da viele unterschiedliche Verkehrsmittel um den Raum konkurrieren. Auf der Autobahn kann man sich auf den Autoverkehr konzentrieren. Aber auch dort muss das unterschiedliche Verhalten von schnell fahrenden Autos und langsamen Lastwagen berücksichtigt werden. Außerdem beeinflussen auch Auf- und Abfahrten die Durchlässigkeit der Autobahnspuren. Es gibt also viele Fragen und Probleme im Zusammenhang mit Verkehr. Ihre Beantwortung kann allen das Leben erleichtern und Kosten erheblich senken. Das Gespräch mit Simone beginnt beim Thema Daten. Wie viele Autos, Personen und Fahrräder bestimmte Strecken zu bestimmten Zeiten nutzen, wird stichprobenhaft recht genau gezählt. Zu einigen Zeiten fließt der Verkehr gut, aber z.B. zur sogenannten Rushhour kommt er ins stocken. Die gezählten Daten fließen in Verkehrsprognosemodelle beispielsweise für Routenplanung ein. Wir rufen dann einfach eine App auf und lassen uns die besten Routen vorschlagen. Für jede wird von der App eine voraussichtliche Reisedauer geschätzt. Für Autobahnverkehr werden außerdem auch ganz aktuelle Daten ergänzt. Um gemeldete Staus aber auch um die Verkehrsdichte auf besonders wichtigen Autobahnabschnitten, wo das automatisiert beobachtet wird. Als ein Beispiel dient im Gespräch von Gudrun und Simone die Autobahn A5 in der Nähe von Frankfurt, wo schon lange Jahre eine Anzeige gute Dienste leistet, die bei Einfahrt in den Ballungsraum die aktuell zu erwartende Fahrtzeit zu markanten Punkten wie beispielsweise dem Flughafen angibt. Als jemand, der sein Flugzeug erreichen muss, kann man dann ruhiger durch den dichten Verkehr reisen und sich an die reduzierte Höchstgeschwindigkeit halten, da man Planungssicherheit hat. Als Nebeneffekt senkt dies die Unfallwahrscheinlichkeit, weil auf hektische Überholmanöver verzichtet wird. Effekte, die man mit Verkehrsflußmodellen simulieren möchte sind erwartbare Engpässe beim Einziehen von Fahrspuren oder auch der sogenannte Stau aus dem Nichts, der bei hoher Verkehrsdichte auftreten kann. Wir alle wissen, dass auf Autobahnen Geschwindigkeitseinschränkungen auf Baustellen vorbereiten, um das Einfädeln der Spuren zu vereinfachen. Wenn der Verkehr dicht genug ist, breitet sich die Störung, die beim Einfädeln entsteht, entgegen der Fahrtrichtung wie eine Schockwelle aus. Das ist eine Beobachtung, die sicher alle schon einmal gemacht haben. Für das Modell heißt das aber, dass es geeignet sein muss Schockwellen als Lösungen zuzulassen. Traditionell gibt es sogenannte mikroskopische und makroskopische Modelle für Verkehr. In den Ersteren schaut man die Fahrzeuge einzeln in ihrem typischen Verhalten an. Die Modelle beruhen auf der Idee des zellulären Automaten. In den makroskopischen Modellen sieht man als wesentlichen Vorgang das Fließen und charakterisiert das Verkehrsgeschehen mit den Variablen Dichte und Fluss. Man kann recht schnell ein erstes Modell aufstellen, indem man folgende elementare Beobachtungen: wenn kein Verkehr ist, ist der Fluß Null (Dichte Null -> Fluß Null) wenn die Dichte maximal ist, stehen alle im Stau und der Fluß Nullmit Hilfe einer konkaven Funktion des Flusses in Abhängigkeit von der Dichte verbindet. Diese hat ein Maximum für eine gewisse Dichte. Die entspricht auch einer Geschwindigkeit des Verkehrsgeschehens, die man mit Bezug auf den besten Fluß als Optimum ansehen kann. Komplexere Modelle nehmen die Masseerhaltung als Grundlage (Autos bleiben in der Summe erhalten) und führen auf die sogenannte Transportgleichung, die hyperbolisch ist. Hyperbolische Gleichungen haben auch unstetige Lösungen, was dem Verkehrsgeschehen entspricht, aber ihre Behandlung schwieriger macht. In der Numerik muss auf die besonderen Eigenschaften Rücksicht genommen werden. Das erfolgt beispielsweise über die sogenannte CFL-Bedingung, die Zeit- und Raumdiskretisierung koppelt. Oder man benutzt Upwind-Schemata für finite Differenzen. Am besten angepasst an hyperbolische Probleme sind jedoch Finite Volumen Verfahren. Sie arbeiten mit der Approximation des Flusses über deren Ränder von Zellen. Simone hat Wirtschaftsmathematik in Darmstadt studiert und anschließend in Kaiserslautern promoviert. Als Akademische Rätin blieb sie einige Jahre in Kaiserslautern und hat sich dann dort auch habilitiert. Seit 2011 ist sie Mathematikprofessorin an der Universität Mannheim am Institut für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik. Literatur und weiterführende Informationen J. Kötz, O. Kolb, S. Göttlich - A combined first and second order traffic network model - preprint, March 2019. M. Burger, S. Göttlich, T. Jung - Derivation of second order traffic flow models with time delays Networks and Heterogeneous Media, Vol. 14(2), pp. 265-288, 2019. U. Clausen, C. Geiger: Verkehrs- und Transportlogistik VDI-Buch, 2013. ISBN 978-3-540-34299-1 M. Treiber, A. Kesting: Verkehrsdynamik Springer, 2010. ISBN 978-3-642-32459-8 Podcasts P. Vortisch, G. Thäter: Verkehrsmodellierung I, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 93, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. U. Leyn, G. Thäter: Verkehrswesen, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 88, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. K. Nökel, G. Thäter: ÖPNV, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 91, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. T. Kretz, G. Thäter: Fußgängermodelle, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 90, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016.
Die Modelle aus der Stark Heldenbox II werden vorgestellt und erste strategische Gedanken formuliert: Wie könnt ihr die neuen Modelle sinnvoll in eure Listen integrieren?
Gudrun sprach im Janur 2019 mit Mark Bangert vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er arbeitet dort seit vielen Jahren als Physiker in der medizinischen Physik. Sein Thema ist die Optimierung von Bestrahlungstherapien. Der Punkt, an dem sich die Arbeit von Mark und Gudrun seit Ende 2018 berühren, ist eine Masterarbeit von Alina Sage in der Bestrahlungsplanung. Ein Gespräch mit ihr werden wir ebenfalls bald veröffentlichen. Es gibt viele und unterschiedliche Betätigungsfelder für Physiker in der medizinischen Physik, unter anderem in der Strahlentherapie oder Radiologie (CT- und MRI-Bildgebung). Marks Hauptaufgabe ist die Simulation und Optimierung von Strahlungsdosen die Tumor-Kranke appliziert bekommen, um die Nebenwirkungen zu minimieren und die Wirkung zu maximieren. Die Modelle hierfür haben eine geometrische Basis und berücksichtigen den Strahlungstransport. Hier geht es um die Abschwächung und Auffächerung in Interaktion mit Haut und inneren Organen. Die Therapie an und für sich ist schon stark digitalisiert. Jede Krebstherapie startet mit einem CT-Bild. Basierend darauf wird ein digitales Patientenmodel entwickelt und segmentiert, um den Tumor abzugrenzen. Das Abgrenzen des Tumors leisten hauptsächlich die Mediziner, Methoden der automatischen Bilderkennung halten hier nur sehr langsam Einzug. Anschließend wird entschieden: Wo soll bestrahlt werden und wo soll möglichst viel Energie absorbiert werden - gleichzeitg aber auch: Wo muss man vorsichtig sein (z.B. Herz, Speiseröhre, Niere, Rektum usw.). Anschließend wird dann simuliert, wie Strahlung auf das digitale Modell des Patienten wirkt. Man kann die Dosis und die zeitliche, räumliche Verteilung der Strahlung variieren und optimieren. Das führt auf eine patientenspezifische Optimierung der Dosis-Gabe, die nur für häufig auftretende Tumore gut standardisierbar und automatisierbar ist. Zeitlich hat sich bewährt, dass die Strahlung über 30 Tage in 6 Wochen verteilt verabreicht wird, da sich gesundes Gewebe so besser von der Strahlungsbelastung erholen kann. Aber viele Probleme bleiben offen: Unter anderem können Patienten nicht ganz still halten, sondern müssen beispielsweise atmen. Deshalb bewegt sich der Tumor während der Bestrahlung. Der momentane Ausweg ist, dass man ein größeres Volumen rings um den Tumor markiert. Eine bessere Variante wäre, wenn die Strahlung nur eingeschaltet ist, sobald der Tumor im optimalen Fenster ist oder wenn der Strahl der Tumorbewegung folgt. Dadurch würden die Nebenwirkungen stark verringert. An solchen Fragen forscht Marks Gruppe bevor nach ausführlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen derartige Neuerungen zur Standardbehandlung werden. Bestrahlungshard- und Software werden zusammen entwickelt und mit vorhandener Bildgebung integriert. Auch diese Tools müssen verbessert werden, um immer genauer zu werden. Der kranke Mensch ändert sich über den langen Behandlungszeitraum von bis zu 6 Wochen oft sehr stark und der Tumor erst recht. Es wäre also denkbar, den Bestrahlungsplan wöchentlich oder sogar täglich zu aktualisieren. Mark hat in Heidelberg Physik studiert und promoviert und leitet eine Nachwuchsgruppe. N. Wahl, P. Hennig, H.-P. Wieser, M. Bangert: Smooth animations of the probabilistic analog to worst case dose distribution, https://github.com/becker89/ESTRO2018 Literatur und weiterführende Informationen M. Bangert, P. Ziegenhain: Bestrahlungsplanung In: W. Schlegel e.a. (eds.): Medizinische Physik, Springer 2018. H. Gabrys e.a.: Design and selection of machine learning methods using radiomics and dosiomics for NTCP modeling of xerostomia, Frontiers in Oncology, Mar 5;8:35, 2018. doi: 10.3389/fonc.2018.00035. J. Unkelbach e.a.: Optimization of combined proton–photon treatments, Radiotherapy and Oncology, 128(1):133-138, 2018. doi: 10.1016/j.radonc.2017.12.031. Podcasts L. Adlung, G. Thäter, S. Ritterbusch: Systembiologie, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 39, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. Resonator-Podcast 015: DKFZ-Forscher Christof von Kalle, Resonator-Podcast von Holger Klein/Helmholtz-Gemeinschaft, 2013. Resonator-Podcast 014: Das DKFZ in Heidelberg, Resonator-Podcast von Holger Klein/Helmholtz-Gemeinschaft, 2013. Resonator-Podcast 069: Krebsmythen, Resonator-Podcast von Holger Klein/Helmholtz-Gemeinschaft, 2015.
Die Modelle sehen toll aus und es gibt jede Menge Bikes die einem zur Verfügung stehen. Ebenso gibt es eine Vielzahl an Strecken durch die man mit den unterschiedlichen PS-Monster heizen darf. Am schönsten sind die Strecken die der Realität nachempfunden sind und nicht eine Rundstrecke abbilden. Laguna Seca mit der CorkScrew Corner ist zwar cool, aber die Strecke um den Garda See ist dann doch um einiges netter. Wie schon bei MotoGP 18 ist die Fahrphysik wirklich gut gelungen. Zum Glück gibt es auch wieder die Möglichkeit die Schwierigkeit anzupassen, denn nicht jeder will wirklich extrem Simulationslastig fahren. Leider ist es aber in den einzelnen Klassen und Gruppen oft nicht so wirklich erkennbar warum man gewonnen oder verloren hat. Zu unterschiedlich ist hier die Gegner KI und das Balancing, und das, obwohl nichts verändert wurde. Es scheint auch so als ob die angegebenen Leistungspunkte oft keine Relevanz haben. Diese kann man zwar durch Tunen erhöhen aber nicht immer führen sie zu dem was man sich erhofft hat. Sehr nett ist die Möglichkeit die Bikes auch ein bisschen zu personalisieren mit anderen Rückspiegeln, Gabeln oder auch dem Editor für die Lackierung. Bei diesem ist wie bei GT auch die Community ein wichtiger Bestandteil. Kaum auf den Markt gab es z.B. schon Lackierungen in so gut wie allen MotoGP Varianten. Auch der Multiplayer macht Spaß, fehlen ihm doch zum Glück die Anfangsprobleme die es bei MotoGP 18 gab. Warum man aber die Ladezeiten nicht in den Griff bekommt verstehe ich nicht ganz. Und der Verantwortliche für das Entfernen des Splitscreen-Koop-Modus sollte am besten seinen Hut nehmen. Insgesamt wurde mit Ride 3 jetzt sicher das Rad nicht neu erfunden, es ist aber für Motorrad-Fans auf alle Fälle ein gutes, abwechslungsreiches Spiel um eben nicht immer nur auf MotoGP Rennstrecken virtuell Gas zu geben.
Wie schon die letzten Jahre üblich, war ich gespannt auf die neueste Version des offiziellen Spiels der Formel 1. Und wie jedes Jahr habe ich mir gewisse Dinge gewünscht die nicht eingetreten sind. Doch zuerst einmal das Positive. Die Grafik sieht wieder sehr hübsch aus. Die Autos, Strecken und Fahrer sind natürlich die des Jahres 2018. Die Modelle sind detailliert und auch an den Fahrern gibt es optisch nichts auszusetzen. Die Umgebung während dem Rennen ist zwar trotz voller Zuschauerränge immer noch sehr emotionslos, aber alles läuft sehr flüssig und ohne Ruckler ab. Auch die Wiederholungen und verschiedenen Kamerapositionen zeigen, dass man sich Mühe gegeben hat. Die Cockpit Perspektive und die leicht erhöhte Variante sehen einfach sehr gut aus. Und wie beim Vorgänger finde ich es schade, dass es keinen VR Modus gibt. Mir ist schon bewusst, dass man ein Renen nicht 1 zu 1 auf die VR bringen kann, aber eine abgespeckte Version (z.B. weniger Autos, etc.) sollte drin sein. Die Karriere läuft eigentlich ziemlich identisch zum Vorgänger ab. Hinzugefügt wurden Interviews, die jetzt auch Einfluss auf die Entwicklungsteams und den Stand des Fahrers im Team haben. z.B. bekommt man für Lob die Entwicklungen der gelobten Abteilung etwas günstiger. Das alles macht nach wie vor viel Spaß, wobei dieser auch durch weitere Spielmodi ergänzt wird. So gibt es natürlich wieder einen Onlinemodus, bei dem man Rennen gegen Mitspieler fahren kann, und es wurden diesmal mehr klassische F1 Autos ins Spiel integriert, mit welchen man auch die Pisten unsicher machen kann. Natürlich wurde aber auch wieder auf einen Splitscreen-Modus verzichtet. Ich glaube den sehe ich so schnell nicht mehr in einem F1 Spiel. Aber alles in allem hat es einige sinnvolle Neuerungen gegeben, womit man wieder einmal ein tolles Rennspiel für F1 Fans, und ein sehr gutes Rennspiel für Racing Fans allgemein auf den Markt gebracht hat.
In dieser Ausgabe von «Gamester spielt» nehmen Raphael und Thomas die Remakes von «Resident Evil 4», «Resident Evil 5» und «Resident Evil 6» für Xbox One, PC und PlayStation 4 besonders scharf unter die Lupe. Dies dank den «Gunnar»High-Tech Computer- und Gamingbrillen. Nach der Gamebesprechung könnt Ihr mehr von den Brillen in unserem Testbericht erfahren. Nun aber zu den Games: «Resident Evil 4» ist nicht der vierte, sondern der sechste Teil der gleichnamigen Serie. 2005 erschien das Game zuerst exklusiv für Nintendos GameCube und sorgte mit einer radikalen Neuausrichtung (viel mehr Action als die Vorgänger, anstatt klaustrophobischem Horror ging es hier um Überlebenshorror – sprich: Deutlich mehr Gegner, weniger Rätsel, eine neue Perspektive. Das Game hauchte der Serie neues Leben ein und war anno 2005 ein super Hit. Dies kann man heute nicht mehr sagen: zu hakelig ist die Steuerung, zu konfus das Geschehen – trotzdem: Für Fans, die damals schon viel Freude am Game hatten, ist die Neuauflage auch heute noch spielenswert. In «Resident Evil 5» kehrt Chris Redfiled zurück und wird von Sheva Alomar unterstützt. In «Resident Evil 6» hat Neo-Umbrella durch einen Terrorakt das bösartige C-Virus weltweit in Umlauf gebracht. Menschen verwandeln sich in Zombies und Mutanten. Mit in-Game-Geld konnte man in «Resident Evil 5» Waffen aufleveln, Munition kaufen und mehr. In «Resident Evil 6» ist das Levelsystem auf die Spieler bezogen und nicht auf Charaktere. Einige Skills können erst nach einmaligen Durchspielen gekauft werden. Online gibt es auch viel zu tun. Seit Teil 4 und dann verstärkt ab Teil 5 hat sich der Fokus von Horror hinüber zu Action verfrachtet. Dies gefiel alten Serienhasen nicht, dem Verkauf hat es nur teilweise geschadet. Der erste «Resident Evil»-Teil verkaufte sich knapp 8.5 Millionen Mal, der fünfte Teil sogar noch etwas mehr, beim sechsten Teil ging es dann doch deutlich nach unten mit knapp 5.2 Millionen verkauften Units. Und wer sich auf das Action vollgepackte neue Spielprinzip einstellt, der wird belohnt. In der Gamester.tv-Redaktion wurde auf jeden Fall mit den letzten Teilen sehr viele spassige Stunden verbracht und der fünfte und sechste Teil machen in der HD-Fassung eine gute Figur. Alle Spiele kommen neu in 1080p und besserer Framerate daher. Alle bisher veröffentlichten Erweiterungen (Story, Figuren, Kostüme) sind auch dabei. Wer sich also auf den Release von «Resident Evil 7» (24. Januar 2017) einstimmen will, macht mit diesen günstigen Varianten nichts falsch. «Gunnar»-Gamingbrillen Wir haben vier aktuelle Modelle von «Gunnar» getestet, Anime, MLG Phantom, PPK und Enigma. Die Modelle sind sehr facettenreich, jeder Geschmack wird fündig. Die Brillengläser können auch angepasst werden, Brillenträger sehen also doppelt klar. Besonders Vorteile haben Kontaktlinsenträger. Bei längerem Tragen hatte ich weniger trockene Augen, ein grosses Plus. Auch das verbesserte und angenehmere Sichtfeld ist einerseits am PC, wie auch beim Zocken auf einer grossen Leinwand wahrnehmbar. Der Überblick ist gewährt und ich bin über die Erhöhung des Kontrastes positiv überrascht. Die Linsenbeschichtung sorgt dafür, dass Spiegelungen minimiert werden. Auch der Tragekomfort ist hoch, die Brillen sind sehr leicht, und die Passform sehr ergonomisch. Das Ganze ist kurzum sehr wertig, sieht gut aus und der positive Nutzen für ein besseres Spielerlebnis und Gesundheit sind unverkennbar. Kurzum: Ein Topprodukt für Gamer und PC-Vielnutzer. Das Beste: Gamester.tv verlost exklusiv zwei Vouchers im Wert von 80 Euro! Der Wettbewerb dazu findet Ihr auf www.gamester.tv. (raf)
Ich gebe es zu, ich bin Rennsportsüchtig. Und natürlich verfolge ich jedes Rennen der F1, egal um welche Uhrzeit und spiele seit Formel 1 (1995) auf der PS jedes verfügbare Spiel zur Königsklasse. Der neueste Ableger macht schon einiges besser als die Vorgänger, leider geht man aber auch bei einigen Punkten wieder mehrere Schritte zurück. Warum? Die Grafik und die Fahrphysik sind wirklich gut geworden und gemeinsam mit der leicht erlernbaren Steuerung und den Einstellungsmöglichkeiten kommen sowohl Anfänger als auch Rennspielprofis auf ihre Kosten. Die Modelle sehen sehr schön aus und der interaktive Boxenfunk verbreitet zusätzliches Rennfeeling. Aber es gibt fehlende Features die eigentlich bei so einer starken Lizenz schon selbstverständlich waren und auch sein sollten. Man bietet zwei volle Saisons als Lizenz, hat aber keinen Karrieremodus mehr. Auch die beliebten Klassiker sucht man vergebens. Wo zur Hölle ist mein Lotus 78?! Und warum zum Teufel gibt es kein (Virtual) Safety Car? Des Weiteren gibt es Bugs bei den Strafen und das Schadensmodell kann zufälliger gar nicht sein. Seit wann überlebt ein Frontflügel eine Berührung mit 200 km/h im Tunnel von Monaco? Diese und einige andere Punkte zehren natürlich an den Nerven der Fans. Macht das Spiel Spaß? Ja, das macht es trotz aller Mankos. Die Umsetzung für die neue Konsole ist gut gelungen, es gibt aber auch Vieles das im nächsten Spiel unbedingt verbessert oder implementiert werden muss.
Auswirkungen der Aufgabenschwierigkeit auf altersabhängige Aktivierungsmuster in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter spielt eine zentrale Rolle für die Gesellschaft der Zukunft und bildet das Hauptaugenmerk dieser Studie. Obwohl einige kognitive Funktionen konstant bleiben (z.B. Wortflüssigkeit) bzw. bis ins hohe Alter kontinuierlich ansteigen (z.B. verbales Wissen), nimmt die Mehrzahl der kognitiven Funktionen im Laufe des Erwachsenenalters ab. Von dieser Tendenz am stärksten betroffen sind die Verarbeitungsgeschwindigkeit und das Arbeitsgedächtnis. Diese Veränderungen werden begleitet von strukturellen Alterungsprozesses der grauen und weißen Hirnsubstanz. Sowohl eine Volumenminderung der grauen Substanz als auch eine verminderte Integrität der Faserverbindungen wird mit verringerten kognitiven Leistungen assoziiert. Studien der funktionellen Bildgebung deuten auf unterschiedliche Aktivierungsmuster bei jüngeren und älteren Probanden hin. Überaktivierung, verminderter Inhibierung und Dedifferenzierung führen bei älteren Probanden zu schlechterer Performanz. Auch eine geringere Effizienz und/ oder Kapazität der neuronalen Netzwerke wird berichtet. Allerdings treten auch kompensatorische zusätzliche (De-)Aktivierungen auf, die zum Erhalt oder zur Steigerung der Leistung beitragen. Der Alterungsprozess zeichnet sich aber auch durch große interindividuelle Unterschiede aus. Zur Beschreibung der Ursachen und Wirkmechanismen werden bio- psycho-soziale Modelle herangezogen, zu denen auch die Theorie der Kognitiven Reserve gezählt wird. Die Theorien der Reserve sind aus der Beobachtung entstanden, dass strukturelle Veränderungen des Gehirns, die durch Krankheiten, Verletzungen aber auch durch normale Alterungsprozesse bedingt sind, nicht bei allen Personen zwangsläufig zu Einbußen in der Kognition führen müssen. Die Modelle der Kognitiven Reserve führen aus, dass diese über das Leben hinweg erworben wird und bei Bedarf aktiviert werden kann. Als Operationalisierungen der Kognitiven Reserve wurden meist die Stellvertretervariablen hohe Bildung, hohe prämorbide Intelligenz, Herausforderungen im Beruf und bei Freizeitaktivitäten und gute Einbindung in soziale Netzwerke herangezogen. Einen Teilbereich der Kognitiven Reserve stellt die Neuronale Reserve dar, welche in der effizienteren oder flexibleren Nutzung neuronaler Netzwerke besteht. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Leistung in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe und ihrer funktionellen Aktivierungsmuster und dem Konstrukt der Kognitiven Reserve bei Berücksichtigung des Alters. Hierzu wurden 104 ältere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 60 und 75 Jahren (M = 68,24 Jahre) und 40 jüngere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren (M = 21,15 Jahre) untersucht. Die Studie beinhaltete eine umfassende neuropsychologische Testung am ersten Tag, in der Teilbereiche der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der exekutiven Funktionen erfasst wurden. Zudem wurde die Kognitive Reserve durch eine wiederholte Durchführung des Zahlen-Symbol-Tests und die Ermittlung der Zugewinne (Testing-the-limits-Verfahren) erhoben. Diese dynamische Testungsmethode weicht von den vielfach verwendeten Methoden der Stellvertretervariablen bewusst ab, da das so erhobene Maß der Definition der Kognitiven Reserve als Leistungspotential besser gerecht wird. Am zweiten Tag folgte die Durchführung einer Arbeitsgedächtnisaufgabe (n-back-Aufgabe) mit drei (bei den jüngeren Probanden vier) unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen während mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztherapie die Aktivierungsmuster des Gehirns aufgezeichnet wurden. Ergänzend wurden strukturelle MRT-Aufnahmen erhoben, welche zur Eruierung der Integrität der weißen Hirnsubstanz herangezogen wurden. Wie erwartet nahmen mit höherer Aufgabenschwierigkeit die Genauigkeit in der Arbeitsgedächtnisaufgabe ab und die Reaktionszeiten zu. Im Vergleich zu jüngeren Probanden reagierten ältere Probanden signifikant langsamer, wiesen mehr Fehler auf und wurden stärker von der Aufgabenschwierigkeit beeinflusst. Überraschend war die Tatsache, dass die Bearbeitung der Aufgabe bei Älteren und Jüngeren mit sehr unterschiedlichen kognitiven Funktionen zusammen hing: Alleine die Verarbeitungsgeschwindigkeit nahm in beide Gruppen eine zentrale Rolle ein. Mit steigender Aufgabenschwierigkeit zeigte sich bei beiden Gruppen eine steigende (De-) Aktivierung in den relevanten Bereichen, jedoch wurde bei älteren Probanden vor allem eine schwächere Deaktivierung des Ruhenetzwerks um den Precuneus beobachtet. Zusätzlich wurden Regionen identifiziert, in denen ein Zusammenhang zwischen der (De-)Aktivierung und dem Leistungsabfall zur Bedingung mit der höchsten Aufgabenschwierigkeit bestand. Während bei den Älteren eine geringere frontale Deaktivierung und höhere Deaktivierung im Precuneus mit einem Leistungserhalt einherging, bewirkte bei den Jüngeren eine höhere frontale Deaktivierung den Leistungserhalt. Die Kognitive Reserve wies in beiden Gruppen jeweils nur einen Zusammenhang mit der Leistung der schwierigsten Aufgabenbedingung auf, was einen Nachweis der externen Validität der verwendeten Operationalisierung, als Leistungspotential, welches bei Bedarf herangezogen werden kann, darstellt. Eine höhere Aktivierung im mittleren und inferioren frontalen Cortex korrelierte positiv mit der Kognitiven Reserve und war leistungsförderlich. Es zeigte sich eine Mediation des Zusammenhangs zwischen der Aktivierung und der Leistung durch die Kognitive Reserve. Dies deutet auf die Vermittlerrolle hin, welche durch die Reserve eingenommen wird. Einen Moderationseffekt der Kognitiven Reserve auf den Zusammenhang der strukturellen Integrität der weißen Substanz des gesamten Gehirns und der Leistung in der Arbeitsgedächtnisaufgabe konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse legen zusammengenommen nahe, dass den älteren Probanden hauptsächlich durch gescheiterte Deaktivierung Leistungseinbußen entstanden, dass sie aber in der Lage waren, kompensatorisch weitere Regionen zur Bearbeitung der Aufgabe hinzuzuziehen. Die Kognitive Reserve bildet das Bindeglied zwischen Aktivierung und Leistung und sollte somit in mögliche Modelle mit aufgenommen werden. Insgesamt liefern die Ergebnisse dieser Arbeit einen Beitrag zur Grundlagenforschung im Bereich des kognitiven Alterns und der Kognitiven Reserve. Besonders der Zusammenhang der Kognitiven Reserve mit den fordernden Bedingungen und die Mediation des Zusammenhang zwischen Aktivierung und Leistung zeigen, dass die hier gewählte Operationalisierung ein valides Testinstrument für zukünftige Studien darstellt.
Zwischen Elternhaus und Partnerschaft
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung und Bereitstellung von unterschiedlichen Skalen, die die Beziehungen junger Erwachsener zu ihren Eltern und zu ihren Partnern aus einem modernen individuationstheoretischen Blickwinkel erfassen. Zunächst erfolgt daher eine Betrachtung der Lebensphase junges Erwachsenenalter aus unterschiedlichen theoretischen Blickrichtungen. Dass auch in diesem Altersbereich die Beziehung zu den Eltern bedeutsam ist kann beispielsweise bindungstheoretischer begründet werden. Die Verbundenheit in Beziehung zu den Eltern besteht weiterhin, wobei die jungen Leute in immer mehr Bereichen Autonomie entwickeln und erhalten. Parallel werden eigene Partnerschaften zunehmend wichtiger. Sie lassen sich ebenfalls durch eine Mischung aus Autonomie und Verbundenheit charakterisieren. Es zeigen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und Entwicklungen bei jungen Männern und Frauen, aber auch in Beziehung zu Müttern und Vätern. Ein Blick auf äußere Kontextfaktoren zeigt, dass sich einerseits aktuelle europaweite Entwicklungen auf das Leben der jungen Erwachsenen auswirken und zu einer Verlängerung der Jugendphase führen. Andererseits beeinflussen länderspezifische wohlfahrtsstaatlichen Strukturen konkrete Lebensbereiche der jungen Erwachsenen und führen zu Unterschieden insbesondere zwischen nordischen und südeuropäischen Staaten, die vom Auszugsalter bis zu den Familien¬gründungen reichen und die somit wiederum gesamtgesellschaftliche Folgen haben. In vorliegender Arbeit wird mittels kulturvergleichender Validierungsstudie die Äquivalenz der Skalen des Network of Relationship Inventory (NRI), des Münchner Individuationstest der Adoleszenz (MITA) und der Filial Responsibility Scale (FRS) überprüft. In einer Fragebogenstudie wurden junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren aus den drei europäischen Großstädten München (Deutschland), Mailand (Italien) und Göteborg (Schweden) zu wesentlichen Themen des jungen Erwachsenenalters befragt (YAGISS-Studie). Für die vorliegenden Analysen wurden Daten von rund 600 Studierenden aus den drei Städten berücksichtigt. Es erfolgt eine schrittweise Testung auf Äquivalenz bzw. Bias im Kulturvergleich durch konfirmatorische Multigruppenanalysen im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen. Es werden gemeinsame Multigruppenmodelle für die Länder getestet, die Modellanpassungen über verschiedene Fit-Indizes überprüft. Die Modelle sind durch zunehmende Identitätsrestriktionen genestet und erlauben Differenztests der Modellanpassung. Es konnten inhaltlich basierte und sinnvolle Modelle für alle drei Instrumente umgesetzt werden, in allen Beziehungen und für alle Länder, wobei teilweise Originalskalen übernommen werden konnten, teilweise aber auch tiefgreifende Modifikationen notwendig wurden. Die Berücksichtigung der Länder erwies sich bei allen Instrumenten als wesentlich. Es konnten schließlich für alle Instrumente Modelle mit metrischer Invarianz zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend sind Vergleiche auf Skalenebene innerhalb der Länder zulässig, zwischen den Ländern nur begrenzt. Schließlich werden Anwendungsempfehlungen zu den Instrumenten NRI, MITA und FRS gegeben, sowie alle relevanten Statistiken zur Verfügung gestellt. Länder-, aber insbesondere auch beziehungsspezifische Unterschiede in der Struktur der Instrumente konnten nachgewiesen werden. Diese bestätigte sich in den anschließenden instrumentenübergreifenden Analysen der Zusammenhänge der Skalen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Beziehungen vor allem zu den Müttern und Partnern nicht nur nach Land, sondern insbesondere nach Geschlecht der jungen Erwachsenen deutlich. Vor allem für junge Erwachsene in Schweden konnten Effekte der Wohnsituation auf die Beziehungen nachgewiesen werden.
Made-to-measure particle models of intermediate-luminosity elliptical galaxies
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/05
Dynamische Modelle sind wichtige Hilfsmittel, um aus projizierten Beobachtungsdaten auf die Massenverteilung und die Phasenraumstruktur von Galaxien zu schließen, und dabei ihre Entstehungs- und Entwicklungsprozesse zu verstehen. Eine relativ neue und vielversprechende Technik, dynamische Modelle zu konstruieren, ist die “made-to-measure” Methode, bei der ein System von Teilchen sukzessive einer beobachteten Lichtverteilung und gemessenen projizierten stellaren Kinematik angeglichen wird. Da die intrinsische, dreidimensionale Struktur der Modelle dann bekannt ist, können sie verwendet werden, um die Massenverteilung und Bahnstruktur der Galaxie zu verstehen. In dieser Arbeit verwenden wir den “made-to-measure particle” Code NMAGIC, um die spezielle Klasse der schwach im Röntgenbereich strahlenden elliptischen Galaxien von mittlerer Leuchtkraft zu erforschen, deren Geschwindigkeitsdispersionsprofile stark mit dem Radius abfallen, was auf sehr diffuse dunkle Materie Halos hindeutet, die möglicherweise in Konflikt zu Vorhersagen von Galaxienentstehungsmodellen stehen. Im ersten Teil der Arbeit führen wir eine “moving prior” Regularisierungsmethode in NMAGIC ein, welche eine korrekte und von systematischen Fehlern freie Rekonstruktion der dynamischen Struktur der beobachteten Galaxie ermöglicht. Im sphärischen Fall, in welchem theoretisch eine eindeutige Invertierung der Daten möglich ist, zeigen wir, dass NMAGIC mit der neuen Regularisierungsmethode die Verteilungsfunktion und intrinsische Kinematik einer Zielgalaxie (mit idealen Daten) mit hoher Genauigkeit reproduziert, unabhängig von der ursprünglich als Startmodell gewählten Teilchenverteilung. Weiterhin untersuchen wir, wie sich unvollständige und verrauschte kinematische Daten auswirken, und kommen zu dem Schluss, dass die Zuverläßigkeit der Modelle auf Gebiete mit guten Beobachtungsdaten beschränkt ist. Schließlich werden mit einer Version der moving-prior Regularisierung für axialsymmetrische Systeme die am besten passenden NMAGIC Modelle der zwei elliptischen, mittelstark leuchtenden Galaxien NGC 4697 und NGC 3379 aus früheren Arbeiten rekonstruiert, um einen glatteren Fit an die Beobachtungsdaten zu erhalten. Im zweiten Teil der Arbeit untersuchen wir die rätselhafte elliptische Galaxie NGC 4494 mittlerer Leuchtkraft. Wir konstruieren axialsymmetrische NMAGIC Modelle mit unterschiedlichen dunkle Materie Halos und Inklinationen, um etwas über ihre Massenverteilung und Bahnstruktur zu erfahren. Die Modelle werden eingegrenzt durch Radialgeschwindigkeiten von planetarischen Nebeln und kinematischen Absorptionsliniendaten in “slitlets”, was uns ermöglicht, zu erforschen, bei welchen Radien die dunkle Materie anfängt zu dominieren bzw. Spuren des Entstehungsmechanismus sichtbar werden. Mit geeigneten Monte-Carlo-Simulationen bestimmen wir mit NMAGIC die ��Werte verschiedener Konfidenzniveaus für die Schätzung der Parameter der dunklen Halos und finden andere Werte, als in der Literatur über dynamische Modellierung normalerweise verwendet. Unsere best-fit NMAGIC Modelle für NGC 4494 innerhalb dieser Konfidenzniveaus schließen einen diffusen dunklen Halo aus; sie haben einen Anteil dunkler Materie von ungefähr 0, 6±0, 1 bei 5 Effektivradien und eine näherungsweise flache (konstante) totale Kreisgeschwindigkeit von � 220 km/s außerhalb des Effektivradius. Die Anisotropie der Sternbahnen ist mässig radial. Diese Ergebnisse sind unabhängig von der angenommenen Inklination der Galaxie, aber edge-on Modelle werden bevorzugt. Schließlich vergleichen wir die dunklen und stellaren Halos von den bisher modellierten elliptischen Galaxien mittlerer Leuchtkraft und folgern, dass ihre Kreisgeschwindigkeiten ähnlich sind. Die genaue Wechselwirkung zwischen dunkler und leuchtender Materie war während der Entstehung jeder Galaxie wahrscheinlich unterschiedlich – und NGC 4494 zeigt einen besonders hohen Anteil an dunkler Materie, speziell im Zentrum, was vielleicht das Ergebniss vergangener Verschmelzungsereignisse sein könnte.
Dreidimensionale Modelle zur Planung komplexer Eingriffe in der kardiovaskulären Chirurgie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Ziel dieser Arbeit war, mit Hilfe von dreidimensionalen, plastischen Modelle komplexe anatomische Situation zu veranschaulichen und die chirurgische Planung zu vereinfachen. Die durchgeführte Routinediagnostik ist im Allgemeinen ausreichend, um kardiale Pathologien exakt zu veranschaulichen, Diagnosen zu stellen und Behandlungsstrategien zu entwerfen. Bei sehr komplexen anatomischen Situationen mit vaskulären und kardialen Fehlbildungen und zusätzlicher Narbenbildung ist es jedoch mitunter schwierig die kardiale Anatomie vollständig zu verstehen und die relevanten Strukturen zu identifizieren. Unter diesen Umständen kann eine dreidimensionale Darstellung hilfreich sein. Zusätzlich zu virtuellen 3D-Rekonstruktionen, die lediglich am Computer betrachtet werden können, bieten plastische Modelle die Möglichkeit, Eingriffe zu simulieren, Devices zu testen und die Modelle zur intraoperativen Orientierung mit in den Operationssaal zu nehmen. Fortschritte in der medizinischen Bildgebung und der Bildbearbeitungssoftware haben die Anwendung von anatomischen Modellbau-Verfahren in der Herzchirurgie ermöglicht. Basierend auf routinemäßig erstellter Diagnostik, wie CT, MRT und MR-Angiographie gelang es für unterschiedliche Indikationen in der Herzchirurgie mittels spezieller Software und dem 3D-Printing Verfahren dreidimensionale Modelle zu erstellen. Die in dieser Arbeit realisierten Indikationen umfassen Pathologien aus den Bereichen der Kinderherzchirurgie, Transplantationschirurgie, Erwachsenenherzchirurgie und der interventionellen Kardiologie. Die Modelle wurden zur präoperativen Planung und intraoperativen Orientierung im Operationssaal eingesetzt. Anhand der Modelle konnten maßgeschneiderte Devices für die interventionelle Kardiologie entwickelt werden und deren Einbringen präoperativ getestet werden. Es hat sich gezeigt, dass die Anwendung von plastischen Modellen zusätzlich zur Routinediagnostik in komplexen Fällen gerechtfertigt ist und dem behandelnden Team die Operationsplanung und die Orientierung im Situs vereinfachen kann.
Identitäten im 21. Jahrhundert - Statement Diedrich Diederichsen
"Die Modelle zur Identitätskonstruktion sind dabei sich umzudrehen." Statements von Diedrich Diederichsen (Poptheoretiker), aufgezeichnet auf dem Festival intermedium 2, das vom 22.-28.03.2002 am ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) in Karlsruhe veranstaltet wurde.