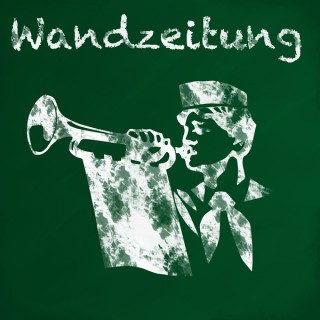Podcasts about bundesstiftung
- 26PODCASTS
- 91EPISODES
- 1h 11mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Dec 16, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about bundesstiftung
Latest news about bundesstiftung
- Bundesstiftung Bauakademie Fonts In Use - Aug 15, 2022
Latest podcast episodes about bundesstiftung
Integration in Hohenahr, Gute Stube in Marburg, Tierheim Wetterau zu teuer für Reichelsheim, Auszeichnung für Butzbach
In Hohenahr-Erda gibt es seit einem halben Jahr eine Geflüchtetenunterkunft, die besonder schnell integrieren will, mit Hilfe aus der Wirtschaft sollen die Bewohner schnell Arbeit finden. Die gute Stube in Marburg ist voll! Die Marburger Kirchen bieten wieder jeden Tag eine warme Mahlzeit, Kekse und Getränke im Philippshaus an - für alle, die Gesellschaft und etwas warmes im Bauch brauchen. Die Stadt Reichelsheim kündigt die Mitgliedschaft im Tierheim Wetterau und gibt damit auch kein Geld mehr. Jetzt könnte sich der Neubau des Tierheims verzögern. Und: Butzbach ist jetzt "Ort der Deutschen Demokratiegeschichte". Den Ehrentitel hat die gleichnamige Bundesstiftung verliehen.
"Passt auf, dass Deutschland immer eine Demokratie bleibt"
Neutral geht gar nicht - Debattenpodcast der Politischen Meinung
Ein Podcastgespräch mit Minister a.D. Rainer Eppelmann anlässlich des 35. Jahrestages der Deutschen Einheit über erlittenes SED-Unrecht, deutsch-deutsche Aufarbeitung und die geteilte Erinnerung im vereinten Deutschland. Die Lebensstationen von Reinhard Eppelmanns sind eng mit der friedlichen Revolution von 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands verbunden. Als evangelischer Pfarrer in Ostberlin war er einer der wichtigsten Köpfe der DDR-Opposition. Er überlebte zwei Anschlagsversuche der Staatssicherheit. Im Oktober 1989 war Reinhard Eppelmann Mitbegründer des Demokratischen Aufbruchs. Nach der ersten und einzigen freien Wahl zur Volkskammer im März 1990 wurde er Minister für Abrüstung und Verteidigung. Bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 trug er einen Titel, den es so nie wieder geben sollte. Im wiedervereinigten Deutschland wurde Reinhard Eppelmann für die CDU viermal in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort leitete er die beiden Enquete-Kommissionen zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit und des SED-Unrechts. In 32 Bänden und auf 29.000 Seiten ist dieser dunkle Teil der deutschen Teilung nachzulesen. Seit 1999 ist er ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Im Podcast Menschenrechte: nachgefragt der Zeitschrift Die Politische Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung sprechen wir mit Reinhard Eppelmann über sein Leben im geteilten und im geeinten Deutschland. Und wir erfahren, warum er noch mindestens ein Jahrzehnt länger leben möchte: Weil er dann länger in der Demokratie als in der Diktatur gelebt hat!
Tierisch geteilt?! Waschbär, Hase und Co. und die innerdeutsche Grenze
Über 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze trennten Familien, Freunde, S- und U-Bahnnetze, Dörfer und ganze Landschaften. Bis heute spüren wir die Folgen der Teilung in Politik und Gesellschaft. Doch was bedeuteten Stacheldraht und Todesstreifen eigentlich für die Tierwelt rund um Mauer und Grenze? Vom »Grünen Band« über Ost-West-Waschbären bis hin zu den berühmten Mauerhasen nehmen wir die Bedeutung der Teilung für Wildtierpopulationen und Artenvielfalt in den Blick. Und erfahren Überraschendes darüber, wie sie auch bei Waschbär, Hase und Co. bis heute nachwirkt. Die Wissenschaftsjournalistin Julia Vismann spricht mit Berlins Wildtierreferenten Derk Ehlert, der früheren Bundesumweltministerin Steffi Lemke sowie dem Zeithistoriker Dr. Clemens Maier-Wolthausen auf der Veranstaltung „Tierisch geteilt?! Waschbär, Hase und Co. und die innerdeutsche Grenze“, die am 16.09.2025 im Tierpark Berlin statt fand. Sie wurde in Kooperation zwischen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem Tierpark Berlin und dem Zoo Berlin organisiert.
Mit ihrem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis möchte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur das Engagement derjenigen sichtbar machen, die sich über Jahrzehnte weltweit mit Zivilcourage und Mut gegen Diktaturen und autoritäre Herrschaft sowie für demokratische Rechte und Freiheiten eingesetzt haben und einsetzen. Ausgezeichnet werden mit dem von Dr. Burkhart Veigel gestifteten Preis Einzelprojekte, Persönlichkeiten und Initiativen, die mit ihrer Arbeit das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage stärken. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk. Die Jury würdigt damit sein langjähriges Engagement für eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit und seine aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Die Laudatio hält der DDR-Bürgerrechtler und Publizist Wolfgang Templin. Der Sonderpreis geht an das Neiße Filmfestival. Das Festival findet 2025 zum 22. Mal im Dreiländereck Deutschland–Polen–Tschechien statt und bringt mit Filmen, Ausstellungen und Konzerten Menschen grenzüberschreitend zusammen. Veranstalter ist der Verein Kunstbauerkino e.V. Die Laudatio hält die Autorin und Filmemacherin Dr. Grit Lemke. Die Initiative „(K)Einheit“ erhält den Nachwuchspreis für ihre fünfteilige Filmreihe mit ostdeutschen Perspektiven junger Erwachsener. Die Filme stoßen Diskussionen zu Erinnerung, Identität und Teilhabe an und fördern den Dialog zwischen Generationen. Die Laudatio hält die Autorin und Sprecherin des Netzwerks „3te Generation Ost“ Jeannette Gusko. Der Jury des Preises unter der Leitung der ehemaligen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Marianne Birthler gehören die russische Menschenrechtlerin Prof. Dr. Irina Scherbakova, der Schriftsteller Marko Martin, der Preisspender Dr. Burkhart Veigel und die Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung Dr. Anna Kaminsky an.
Aufarbeitung einer Diktatur: Was Syrien von Deutschland lernen kann
In Syrien geht es nach dem Sturz des grausamen Assad-Regimes um die Aufklärung der Verbrechen. Anna Kaminsky leitet die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Was würde sie der syrischen Bevölkerung raten?
Zeitlose Jahre: Frauen zwischen Repression und Freiheit in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR
Das „Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der SBZ/SED-Diktatur e. V.“ und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur laden Sie anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember 2024 herzlich ein zur Buchpräsentation, Lesung und Gespräch.
Erinnerungskultur - Bundesstiftung Aufarbeitung begrüßt Gedenkort für SED-Opfer
Nach langer Suche wurde nun ein Ort für die Opfer des SED-Regimes gefunden. Anna Kaminsky von der Bundesstiftung Aufarbeitung begrüßt das: Der Standort in der Nähe des Bundeskanzleramts sei sehr gut, er liegt in der Mitte des politischen Berlins. Kaminsky, Anna www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit
Zweiter Weltkrieg, Opposition und die Erinnerung: Herausforderung für die Demokratie heute
Anlässlich des 85. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges möchten wir in diesem Rahmen die zentrale Bedeutung der Erinnerungskultur für die Demokratie heute diskutieren. Moderiert von Robert Parzer debattieren Anne Delius (Historikerin und Publizistin, Bundeszentrale für Politische Bildung), Markus Meckel (Theologe, Außenminister der DDR a.D., Ratsvorsitzen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) und Jacek Kubiak (Polnischer Historiker und Journalist, Spezialist für deutsch-polnische Beziehungen, Oral History Archive Posnania)
Islam - Wie sich Moscheen in Deutschland finanzieren
Wie sich deutsche Moscheen finanzieren, darüber wird seit Jahren diskutiert. Während die Politik über Moscheesteuer, Bundesstiftung und Gelder aus dem Ausland als Geldquelle streitet, setzen Moscheevereine vor allem auf Spenden und Mitgliedsbeiträge. Röther, Christianwww.deutschlandfunk.de, Hintergrund
Was Jugendliche über die DDR im Schulunterricht lernen sollten
Das Jahr 2023 markierte einen Kulminationspunkt in der erinnerungskulturellen Debatte um die gegenwärtige Einordnung und Bewertung der DDR-Geschichte. Es erschienen zahlreiche Publikationen mit großer gesellschaftlicher Resonanz und kontroversen Reaktionen, die das Spannungsfeld von Alltag und Diktatur einerseits sowie der Transformationszeit in ihren Auswirkungen bis heute andererseits neu vermessen wollten. Diese historischen Aushandlungsprozesse machen auch vor den Schulen nicht Halt: Zwar ist die Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte Bestandteil aller Curricula der 16 Bundesländer, die thematischen Schwerpunktsetzungen fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Die Folgen der Deutschen Einheit, Umbruchszeit sowie erinnerungskulturelle Perspektiven kommen dabei oft zu kurz. Abhängig vom Standort, Alter und der Sozialisation der Lehrkraft sowie dem Hintergrund der Schülerinnen und Schüler entstehen mitunter Widersprüche zwischen dem familiären Gedächtnis und den schulischen Lernzielen, schulspezifischen Curricula oder den Rahmenlehrplanvorgaben. Diese Widersprüche können und sollen nicht aufgelöst, aber sollten für einen multiperspektivischen Blick auf die DDR-Geschichte fruchtbar gemacht werden. Wie wollen wir die deutsch-deutsche Teilungs- und Einheitsgeschichte künftig unterrichten? Wie können neue Fragen und Themenfelder in einen lebendigen erinnerungskulturellen Diskurs aufgenommen werden, ohne in eine Weichzeichnung der kommunistischen Diktaturen zu verfallen? Bilden Alltag und Diktatur zwei Pole oder sind diese nicht vielmehr integriert zu betrachten? Die Veranstaltung in der Reihe „Wir müssen reden!“ möchte kontroverse erinnerungskulturelle Fragen auf den Tisch bringen und mit Lehrkräften unterschiedlicher Generationen, Fachdidaktikerinnen und Historikern sowie dem Publikum ins Gespräch kommen. Eine Kooperationsveranstaltung des Landesverbandes der Geschichtslehrer Berlin e. V. mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Nicht einen Schritt weiter nach Osten von Mary Elise Sarotte | Buchvorstellung und Diskussion
Zeitgeschichte erleben. Der Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung
„Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Amerika, Russland und die wahre Geschichte der Nato-Osterweiterung“ – so lautet der Titel der neuen Publikation von Mary Elise Sarotte. Am 9. November 2023 stellte sie ihr Buch im Forum Willy Brandt Berlin vor und diskutierte im Anschluss mit Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF). Das Buch von Mary Elise Sarotte nimmt Lesende mit auf eine Reise in das entscheidende Jahrzehnt zwischen dem Mauerfall und dem Aufstieg Putins. Die Autorin hat Unmengen von Archivmaterial durchforstet und viele Interviews geführt, um einer der großen politischen Streitfragen unserer Zeit nachzugehen. Wurde damals tatsächlich versprochen, keine ost- und mitteleuropäischen Staaten in das Bündnis aufzunehmen? Wie kam es dann zu dem NATO-Betritt ehemaliger Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts und der UdSSR? Und warum kam es nicht zu einer gänzlich neuen Sicherheitsarchitektur für Europa? Mary Elise Sarotte ist Expertin für die Geschichte der Internationalen Beziehungen und Inhaberin des Marie-Josée und Henry R. Kravis Distinguished Professorship of Historical Studies an der Johns Hopkins University. Zudem gehört sie dem Center for European Studies der Harvard University an und ist Mitglied des Council on Foreign Relations. Zu ihren zahlreichen Veröffentlichungen zählen u.a. die Bücher „Collapse: The accidental opening of the Berlin Wall“ (2015) und „1989: The struggle to create post-cold war Europe“ (2014). Eine gemeinsame Veranstaltung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online: Webseite: https://www.willy-brandt.de/ Newsletter: https://www.willy-brandt.de/newsletter/ Instagram: https://www.instagram.com/bwbstiftung/ Facebook: https://www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/ Mastodon: https://social.bund.de/@BWBStiftung Twitter: https://www.twitter.com/bwbstiftung/ YouTube: https://www.youtube.com/@BWBStiftung
Deutsch-deutsche Dolmetscher. 50 Jahre Westkorrespondenten in der DDR
Im September 1973 wird Dietmar Schulz als dpa-Journalist in der DDR akkreditiert. Bald sind das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der Rundfunk und die großen westdeutschen Zeitungen mit Journalisten im anderen Deutschland vertreten. Fünf von ihnen haben wir zu einem Zeitzeugengespräch eingeladen: Neben Dietmar Schulz, der bis 1979 in der DDR arbeitete, sind am Freitag, 13. Oktober, ab 14 Uhr Peter Pragal (1974 bis 1979 für die Süddeutsche Zeitung, 1983 bis 1991 für den stern), Harald Schmitt (1977 bis 1983 als Fotograf für den stern), Hendrik Bussiek (1977 bis 1985 für den ARD Rundfunk) und Monika Zimmermann (ab 1987 für die FAZ) in der Bundesstiftung zu Gast. Unser Kollege Dr. Ulrich Mählert wird mit den Westkorrespondenten in lockerer Runde und ohne Zeitvorgabe über ihren Alltag in der DDR sprechen. Wie war es, zum Teil mit der ganzen Familie, in der DDR zu leben? Wie gestaltete sich die Arbeit vor Ort? Wie war das eigene Selbstverständnis und wie hat es sich verändert? Wie versuchten die „Dienste“ in Ost, aber auch in West, die Journalisten abzuschöpfen, zu manipulieren oder gar für sich einzuspannen?
#diepodcastin über FRAUENkrankheiten: Isabel Rohner & Regula Stämpfli über Endometriose & wie Geschichte Frauen krank macht sowie den wegweisenden Bundesfinanzhof-Entscheid zur Leihmutterschaft.
#diepodcastin über Frauenkrankheiten: Isabel Rohner & Regula Stämpfli über Endometriose & wie Geschichte Frauen krank macht, die frauenverachtende Bundesstiftung für Gleichstellung (sic!) sowie den wegweisenden Bundesfinanzhof-Entscheid zur Leihmutterschaft.
25 Jahre Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Mit etwa 400 Gästen beging die Bundesstiftung Aufarbeitung am 30. August im Rahmen der Zeitgeschichtlichen Sommernacht ihr 25-jähriges Jubiläum. In der Villa Elisabeth in Berlin-Mitte blickte Direktorin Dr. Anna Kaminsky mit Wegbegleitern, Mitarbeitern und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft nicht nur auf die vergangenen 25 Jahre zurück, sondern ordnete die Stiftung und ihre Arbeit auch in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext ein. Den Festvortrag „Von der Notwendigkeit und Kunst des Erinnerns“ hielt die Regionalbischöfin der Ev.-luth. Landeskirche Hannover und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Dr. Petra Bahr. Ebenso sprachen Katrin Göring-Eckart, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und Maria Bering, Abteilungsleiterin „Erinnerungskultur“ bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von „The Swingin‘ Hermlins“ unter der Leitung von Andrej Hermlin.
Erinnerungsdebatten. Vom Umgang mit der Vergangenheit 1989–1992
Mit dem neuen Online-Portal www.erinnerungsdebatten.de stellt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine umfangreiche Dokumentation der parlamentarischen Debatten über den Umgang mit der NS- und der SED-Vergangenheit zur Verfügung, die von 1989 bis 1992 geführt wurden. Das Portal dokumentiert die Diskussionen der Vertreterinnen und Vertreter des Zentralen Runden Tisches in der DDR, der letzten und zugleich frei gewählten DDR-Volkskammer sowie des Deutschen Bundestages vor und nach Herstellung der deutschen Einheit. Hinzu kommen historische Dokumente, Fotos, Videos und Tonmitschnitte. Herzstück der Seite sind zahlreiche Interviews mit den damaligen politischen Akteurinnen und Akteuren.
Apple ante Portas: Was die Expansionspläne des Tech-Riesen für die Münchner Stadtgesellschaft bedeuten
Ungebetener Gast: Ex-Pink-Floyd Roger Waters will juristisch gegen Konzert-Absagen in Deutschland vorgehen / Die Verwandlung Münchens in eine Digitalmetropole durch Apple und mögliche Folgen / In welcher Stadt wollen wir leben? Moderationsgespräch mit dem Architekten und Stadtplaner Reiner Nagel von der Bundesstiftung für Baukultur / "Zuschauer in der ersten Reihe. Erinnerungen". Die erzählte Autobiografie des Kunstliebhabers Herzog Franz von Bayern erscheint heute im C.H. Beck Verlag
#107 »Die Fotografie ist die Schnittstelle der Kulturen.«
Dr. Peter Pfrunder. Direktor der Fotostiftung Schweiz in Winterthur. Wir sprechen über die Fotostiftung Schweiz und natürlich auch zum Schluss über die Bundesstiftung, die in Deutschland gerade gegründet wurde. Zitate aus dem Podcast: »Das Lesen von Bildern betrachte ich immer wieder als Schlüssel zur Fotografie.« »Ich bin kein Fotograf. Ich bin ein Bildbetrachter, der aus der Analyse heraus Zusammenhänge zu erschließen versucht.« »Das Archiv ist Ausdruck einer Kultur, einer Gesellschaft und einer Zeit.« »Frei nach Siegfried Giedion: Auch in einem Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne.« »Heute ist das, was Fotografie sein kann, nicht mehr eingebettet in einen kunsthistorischen Diskurs. Diese Befreiung ist nötig gewesen.« »Man kann heute Fotografie nicht mehr verstehen, wenn man sie von der sozialen Praxis abkoppelt.« »Das Kriterium für ein gutes Bild liegt nicht im Bild selbst.« »Als die Stiftung gegründet wurde 1971 ging es darum, Bilder zu retten, weil man Angst hatte, die gehen verloren.« »Heute sollten wir vielleicht eher darüber nachdenken, welche Bilder müssen wir wieder los werden, wie können wir uns schützen vor zu viel Bildern.« »In der Regel benutzen wir gesamtgesellschaftlich heute Fotografie als Kommunikationsmittel. Und nur in wenigen Fällen geht es um Bilder, die darüber hinaus einen Wert haben.« »Das entscheidende Merkmal ist der Stillstand, den wir mit Fotografie erzeugen können.« Dr. Peter Pfrunder wurde 1959 in Singapur geboren und wuchs in der Schweiz auf. Er studierte Germanistik, europäische Volksliteratur und englische Literatur in Zürich, Berlin und Montpellier. Er promovierte 1984 an der Universität Zürich. 1998 wurde er Direktor der »Schweizerischen Stiftung für die Photographie« im Kunsthaus Zürich, die 2003 in »Fotostiftung Schweiz« umbenannt wurde. In dieser Funktion entwickelte er zusammen mit Martin Gasser ein neues Konzept für die Aktivitäten der Stiftung, beruhend auf einer engen Kooperation mit dem Fotomuseum Winterthur. Seit 2017 ist Peter Pfrunder alleine für die administrative und künstlerische Leitung sowie für den Ausbau der Stiftung verantwortlich. Die Stiftung betreut heute rund 100 Archive, Teilarchive und Nachlässe von Schweizer Fotografinnen und Fotografen sowie eine umfassende Sammlung von herausragenden Werken aus der Geschichte der Schweizer Fotografie, von ca. 1840 bis heute. Analog zur »Cinémathèque Suisse« für den Film oder zum »Schweizerischen Literaturarchiv« für die Literatur kümmert sie sich im Auftrag des Bundes um das fotografische Erbe der Schweiz. Peter Pfrunder hat zahlreiche Monografien und Bücher zum Schweizer Fotoschaffen veröffentlicht, u.a. über Albert Steiner, Monique Jacot, Theo Frey, Gotthard Schuh, Roberto Donetta, Walter Bosshard, Pia Zanetti, Georg Aerni. Zu den wichtigsten thematischen Publikationen gehören: Schweizer Fotobücher. Eine andere Geschichte der Fotografie (2011); Adieu La Suisse. Bilder zur Lage der Nation (2013); Belichtete Schweiz. Was Fotografien über ein Land erzählen. DVD mit 20 Kurzfilmen von Heinz Bütler und Peter Pfrunder (2012); Kindheit in der Schweiz (2015); 99 Fotografien (2021); https://www.fotostiftung.ch Aktuelle Ausstellung bis Mitte Februar https://www.fotostiftung.ch/ausstellungen/aktuell/peter-knapp/ https://www.fotostiftung.ch/e-shop/ Publikationen https://www.lars-mueller-publishers.com/99-fotografien https://www.lars-mueller-publishers.com/bild-für-bild https://www.lars-mueller-publishers.com/schweizer-fotobücher-1927-bis-heute - - - Episoden-Cover-Gestaltung: Andy Scholz Episoden-Cover-Foto: Privat Wer regelmäßig gut informiert sein möchte über das Festival, den deutschen Fotobuchpreis und den Podcast Fotografie Neu Denken, der trägt sich in den Newsletter ein. https://festival-fotografischer-bilder.de/newsletter/ Idee, Produktion, Gestaltung, Redaktion, Moderation, Schnitt, Ton, Musik: Andy Scholz
Demokratien im Dialog: Demokratischer Wandel und Menschenrechte in Taiwan
Taiwan ist eine der dynamischsten und modernsten Demokratien Asiens. Taiwan hat in seiner wechselvollen Geschichte aus eigener Kraft in einem mühevollen und friedlichen Prozess etwas geschaffen, das modellhaft für die ganze südostasiatische Region ist. Taiwan ist heute ein Leuchtturm für Demokratie und Menschenrechte. Gleichzeitig erleben wir in diesen Monaten eine sich stetig aufbauende Bedrohung Taiwans. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte und als Zeichen für die Ausstrahlungskraft und geopolitische Bedeutung der lebendigen Demokratie Taiwans begrüßen die Deutsch-Taiwanische Gesellschaft und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Chen Chu als Vorsitzende der Nationalen Menschenrechtskommission Taiwans. Die Begrüßung halten Dr. Anna Kaminsky, Dr. Marcus Faber und Prof. Jhy-Wey Shieh. Es referieren Chen Chu und Prof. Dr. Eibe Riedel. Auf dem Podien diskutieren Dr. Renate Müller-Wollermann und Dr. Rong-Jye Lu sowie Peter Heidt, Dr. Gudrun Wacker und Martin Aldrovandi.
Bundesstiftung "Frühe Hilfen" - mehr Geld für Eltern und Familien
Geuther, Gudulawww.deutschlandfunk.de, Dlf-MagazinDirekter Link zur Audiodatei
Jahresbericht Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU: mehr Tempo bei Energieeffizienz
Die DBU hat 2021 fast 300 Projekte mit insgesamt 60 Mio. Euro unterstützt. Vor allem beim Energiesparen will die DBU mehr Tempo machen, weiß Werner Eckert
139 - Eine DDR-Schulstunde in 360°
In eine Schulstunde der DDR eintauchen und sie beinahe real miterleben mit Hilfe eines 360° Videos. Diese Möglichkeit bietet ein Projekt des Zeitbild-Verlages mit vielen zusätzlichen Materialien für die Gestaltung deines Unterrichtes. Gefördert wird dieses Projekt durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung und bietet sich vor allem für Schüler/innen ab der 9. Klasse an. Du erfährst in dieser Podcast-Folge wie genau eine möglich Einbettung im Unterricht aussehen könnte und welche Situationen des Schulalltags aus dem Jahr 1981 durch das 360° Video für die Schüler/innen erfahrbar sind. Viel Spaß dabei! Hier findest Du das gesamte Material zu dem Video:https://www.zeitbild.de/eine-ddr-schulstunde-das-360-video/Diese Episode ist eine Audio-Datei aus der Reihe des Teacher Talk Podcast.Du kannst Dir hier alle Folgen online anhören und herunterladen.Mehr Infos zum Angebot von Sebastian Nüsse findest Du hier.Sichere Dir jetzt mein Buch "60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht":www.sebastian-nuesse.de/toolsSebastian bei InstagramSebastian bei LinkedIn
Ulm wartet mit einer großen Überraschung auf. Die Stadt lässt jetzt einen Kultursommer förmlich explodieren: An sechs Wochenenden und an acht Off-Locations wird im Rahmen des Möglichen gefeiert. Los geht's schon Mitte Juli! Wer hätte es gedacht? Ulm bekommt doch noch einen dicken Sommer vollgepackt mit Veranstaltungen, Musik und Tanz. Möglich macht das eine großzügige Förderung von 364.300 Euro der Bundesstiftung für Kultur. Insgesamt gibt die Stadt 450.000 Euro aus. Das Konzept haben die beiden Ulmer Kulturzentren Roxy und Gleis 44 zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt Ulm erarbeitet. 6 Wochenenden, 20 Veranstaltungen, 8 Locations Neben verschiedenen Veranstaltungen der Kulturabteilung selbst, werden auch das Roxy, das HfG-Archiv, das Museum Ulm und natürlich das Gleis 44 zum Programm beitragen. „Mit dem Kultursommer wollen wir die gesamte Branche direkt unterstützen, aber auch den immateriellen Wert der Kulturarbeit für die Bürgerinnen und Bürger hervorheben, indem wir sie direkt in den öffentlichen Raum tragen“, so Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Von Seiten der Ulmer Kulturabteilung sind sechs Wochenenden und über 20 größere Veranstaltungen unterschiedlichen Charakters an acht verschiedenen Open-Air Locations geplant. Die Leitung übernimmt Samuel Rettig, Gründer des Gleis 44. „Im Liederkranz haben wir letztes Jahr erlebt, welche schönen Effekte es hat, wenn man Kultur an Orte bringt, an denen zuvor noch keine war.", sagt Rettig. Das Programm soll deshalb alle Sparten und Interessengruppen ansprechen. „Da wird man richtig wach.“ Doch noch ein "gscheids" Schwörwochenende? Der Anfang wird zum Schwörwochenende Mitte Juli gemacht. „Da wir gerade mitten in den Realisierungsmöglichkeiten im Rahmen von Regelungen stecken, will ich noch nicht zu viel verraten. Aber der Ort, an dem wir planen ist jeder Ulmerin und jedem Ulmer ein Begriff“, berichtet Rettig. Kulturschaffende und Gastronomen sind eingeladen, das Programm mitzugestalten. Anfragen werden über kultursommer@ulm.de entgegengenommen. Vielseitiges Rahmenprogramm Schon Mitte Juli startet von Seiten des Roxy das Open-Air-Tanz-Spektakel BALAGAN! Auf einer fahrenden Bühne (Marke Piaggo Ape) werden auf verschiedenen öffentlichen Plätzen Tanzeinlagen aufgeführt. Außerdem veranstaltet das Kulturzentrum bis in den September hinein Lesungen und Kulturwanderungen zu spannenden Locations, berichtet Christian Grupp, der Geschäftsführer des Roxy. „Es ist toll zu sehen, dass die Stadt Ulm die freie Szene in der aktuellen Zeit damit unterstützt und wir gemeinsam an einem Strang ziehen, Kultur in Ulm groß zu schreiben.“ More to come! Das sagt der Macher Die Leitung übernimmt Samuel Rettig, Gründer des Gleis 44. Er hat sich mit DONAU 3 FM Reporter Paolo Percoco über den kommenden Kultursommer unterhalten.
Ende der Stasi-Unterlagenbehörde - Meckel (SPD): "Die Akten sind in schlechtem Zustand"
Der Stasi-Unterlagenbehörde habe es an Klarheit und Konzeption gefehlt, sagte Markus Meckel (SPD), Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, im Dlf. Beim Übergang der Akten in das Bundesarchiv müssten neue Akzente gesetzt werden. Markus Meckel im Gespräch mit Christoph Heinemann www.deutschlandfunk.de, Interview Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
30 Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt - Generalsekretär Bonde: Umweltprobleme sind komplexer geworden
"Wir sind ein bisschen Bob der Baumeister der Umweltbewegung", beschreibt Generalsekretär Alexander Bonde die vor 30 Jahren gegründeten Bundesstiftung Umwelt. Innovationsföderung für Natur-, Umwelt und Klimaschutzschutz, stehe weiter im Fokus, sagte er im Dlf - die Probleme aber seien massiver geworden. Alexander Bonde im Gespräch mit Georg Ehring www.deutschlandfunk.de, Umwelt und Verbraucher Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
30 Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt: Solche Projekte fördert sie
Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 1,9 Milliarden Euro in mehr als 10.000 Projekte zum Schutz der Umwelt gesteckt. Zum Geburtstag stellt SWR2 Impuls beispielhaft drei aktuelle Projekte vor.
30 Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Markus Meckel war eine der zentralen Figuren der Oppositionsbewegung in der DDR, Akteur der Friedlichen Revolution von 1989 und Gestalter des Prozesses zur deutschen Einheit. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker engagiert sich bis heute aktiv für eine europäisch orientierte Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Diktaturen des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt als Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Am 10. September 2020 stellte er sein Buch „Zu wandeln die Zeiten“ in der Bundesstiftung Aufarbeitung vor, gemeinsam im Gespräch mit Klara Geywitz, Nikolaus Schneider und Jörg von Bilavsky.
Der Tag der Deutschen Einheit fand 2020 in Potsdam nicht mit einem Bürgerfest statt, wie es in den zurückliegenden Jahren üblich war. Anstelle dessen wurden am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt mit der „Einheits-Expo“ in gläsernen Kuben einzelne Installationen präsentiert, die die Geschichte des vereinten Deutschlands abbilden. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ist daran mit zwei Kuben vertreten. In ihnen wird die Ausstellung „Militär und Gesellschaft in Deutschland seit 1945“ präsentiert, die das ZMSBw mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erarbeitet hat. Ergänzt wird die Tafelausstellung mit zeitgenössischen Exponaten und der Darstellung von Soldatenstuben aus Nationaler Volksarmee und Bundeswehr. Diese Inszenierung wird mit Musik umrahmt, aber nicht Marschmusik, wie mancher vermuten möchte. Stabsfeldwebel Guido Rennert, Komponist und Klarinettist im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg, hat vor fünf Jahren eine Freiheitssinfonie komponiert und dabei Musikstücke und Zitate von Personen aus dem Wendeprozess 1989/90 eingebunden. Mit ihm spricht Kapitän zur See Dr. Jörg Hillmann im 10. Podcast des ZMSBw über dieses einzigartige Musikstück. Ein Filmportrait von Stabsfeldwebel Guido Rennert – und seiner Freiheitssinfonie – finden Sie hier. Mehr zu Guido Rennert finden Sie auch auf www.guidorennert.de. Bei der Uraufführung der Freiheitssinfonie in Köln im Jahr 2015 war mit Bundesaußenminister a.D. Hans-Dietrich Genscher (+) ein maßgeblicher Gestalter des „Wendeprozesses 1989/90“ Gast des Konzerts.
Wer nach der Geschichtlichkeit von Gefühlen fragt, handelt sich ungläubige Nachfragen ein. Sind Gefühle nicht etwas Allgemein-Menschliches und damit Überzeitliches? Kannten nicht schon die Menschen der Antike Angst, Zorn, Neid und Liebe? Gingen Bürger und Bürgerinnen nicht schon 1848 oder 1918 aus Wut und Empörung auf die Straße und forderten, ähnlich wie 1989 in der DDR, einen politischen Regimewechsel? Und wie lassen sich Gefühle überhaupt dingfest machen, so dass sie für Historiker fassbar und deutbar sind? Die Historikerin Prof. Dr. Ute Frevert ist Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, wo sie seit 2008 den Forschungsbereich „Geschichte der Gefühle“ leitet. Ihr Vortrag wurde umrahmt von der Ausstellung „Die Macht der Gefühle. Deutschland 19|19“, die sie gemeinsam mit Bettina Frevert für die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur unter der Schirmherrschaft von Bundesaußenminister Heiko Maas erarbeitet hat.
30 Jahre Freiheit: Eine Bilanz der Träume und Erwartungen Mitteleuropas
Aufnahme des Tschechischen Zentrum Berlin aus dem Kinosaal der Botschaft der Tschechischen Republik vom 18.11.2019 Die Podiumsdiskussion beleuchtete die Ereignisse des Novembers 1989 aus den Blickwinkeln aktiv Beteiligter aus der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen. Wie blicken die Menschen in diesen drei Ländern auf die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre und auch auf die Feierlichkeiten in diesem Jahr? Es diskutierten Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Daniel Herman und Robert Grünbaum, Moderation: Tomáš Sacher. Eine gemeinsame Veranstaltung von: Tschechisches Zentrum Berlin, Polnisches Institut Berlin, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin.
Unter dem Titel „Voll der Osten“ wurde heute in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Ausstellung mit Fotos von Harald Hauswald und Texten von Stefan Wolle. https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/voll-der-osten-6611.html
Rainer Eppelmann - Unser Weg der Selbstbefreiung von der Diktatur in die Demokratie
Rainer Eppelmann - am 9.11.2015 im Hayek-Club Frankfurt Ehrenamtlicher Vorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur "Unser Weg der Selbstbefreiung von der Diktatur in die Demokratie – eine Herausforderung für uns alle im vereinten Deutschland"
20 Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Zum 20-jährigen Bestehen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erinnert Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens. Die Stiftung fördert Projekte des Naturschutzes, die Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke und neue umweltfreundliche Technologien.
20 Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Zum 20-jährigen Bestehen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erinnert Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens. Die Stiftung fördert Projekte des Naturschutzes, die Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke und neue umweltfreundliche Technologien.
Internationale Konferenz: Dealing with the Past (Teil 1)
Die internationale Konferenz „Dealing with the Past – Erinnerung und Aufarbeitung nach Systemumbrüchen im späten 20. Jahrhundert“ widmete sich am 18./19.August der stets aktuellen Frage nach Systemumbrüchen sowie Aufarbeitungsprozessen und -modellen in unterschiedlichen historischen und nationalen Kontexten. Verschiedene Ansätze von „Transitional Justice“ – auch „Übergangsgerechtigkeit“ genannt – wurden im internationalen Vergleich vorgestellt und diskutiert. 1. Dealing with the Past Tag 1 Teil 1: • Begrüßung und Einführung durch Dr. Anna Kaminsky, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur • Keynote von Prof. Dr. Jan Eckel, Eberhard Karls Universität Tübingen • Podium I: Zeiten des Umbruchs: Systemwechsel in internationaler Perspektive Es diskutieren: Prof. Dr. Aurel Croissant, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Prof. Dr. Sabine Kurtenbach, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, Hamburg Prof. Dr. Carola Lentz, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Prof. Dr. Gwendolyn Sasse, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, Berlin Moderation: Harald Asel, rbb Inforadio, Berlin
Mit ihrem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis möchte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur das Engagement derjenigen sichtbar machen, die sich über Jahrzehnte weltweit mit Zivilcourage und Mut gegen Diktaturen und autoritäre Herrschaft sowie für demokratische Rechte und Freiheiten eingesetzt haben und einsetzen. Ausgezeichnet werden mit dem von Dr. Burkhart Veigel gestifteten Preis Einzelprojekte, Persönlichkeiten und Initiativen, die mit ihrer Arbeit das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage stärken.
Menschenrechte und Frauenrechte standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion, die aus Anlass des »Tags der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden« am 6. März 2014 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur stattfand. Es diskutierten: Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International; Markus Löning, ehemaliger Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung; Kathrin Oxen, Leiterin des Zentrums für evangelische Predigtkultur Wittenberg; Almut Ilsen, Mitglied der Gruppe "Frauen für den Frieden" in der DDR sowie Prof. Irina Scherbakova von Memorial Moskau. Das Gespräch moderierte Dr. Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.
Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung der deutschen Sozialdemokratie
Die Oktoberrevolution stellte für die deutsche Sozialdemokratie eine besondere Herausforderung dar. Mit den Bolschewiki hatte erstmals in der Geschichte eine Arbeiterpartei die Macht ergriffen. Dass es sich dabei - konträr zur Vorhersage von Karl Marx - um einen industriell unterentwickelten Staat handelte, stellte auch die theoretische Grundlage der Sozialdemokratie infrage. Das gewaltsame Vorgehen der neuen Machthaber führte zu weiteren Verwerfungen zwischen dem radikalen und reformistischen Flügel der Sozialdemokratie. Mit der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands kam es schließlich zum Bruch der deutschen Arbeiterbewegung. Vortrag "Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung der deutschen Sozialdemokratie" von Prof. Dr. Detlef Lehnert (Freie Universität Berlin). Begrüßung und Moderation: Dr. Ulrich Mählert (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur).
Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e.V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Das erste Panel der Konferenz wurde durch Martin Gutzeit, den Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit eingeleitet. Es folgten Kurzvorträge zum Themenkomplex "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948." Bei der von Oberst Prof. Dr. Winfried Heinemann moderierten Podiumsdiskussion zum Thema "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948" diskutierten Prof. Dr. Bernd Greiner, Dr. Christian Ostermann, Prof. Dr. Vladimir Pechatnov sowie Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz.
Das diplomatische und völkerrechtliche Endes des Kalten Krieges / Markus Meckel
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e. V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Am zweiten Tag der Konferenz hielt der ehemalige Außenminister der DDR, Markus Meckel einen halbstündigen Vortrag zur diplomatischen und völkerrechtlichen Tragweite des Ende des kalten Krieges.
We all lost the cold war: Erblasten und Folgen des Kalten Krieges
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e. V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz 'Krieg der Welten: Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges' in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Den Abschluss der zweitägigen Konferenz bildete die von Dr. Jacqueline Boysen moderierte Podiumsdiskussion "We all lost the cold war": Erblasten und Folgen des Kalten Krieges. Es diskutierten: Marieluise Beck, Mitglied des Deutschen Bundestages Elmar Brok, Mitglied des Europaparlaments György Dalos, Schriftsteller aus Berlin un Dr. Jackson Janes, Präsident des American Institute for Contemporary German Studies in Washington D.C.
Verschleppt, Verschwiegen, Vergessen? Die Deportation von Zivilpersonen in die Sowjetunion vor 70 Jahren
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges deportierte die sowjetischen Besatzungsmacht Tausende deutscher Zivilisten von östlich der Oder und Neiße zur Zwangsarbeit in die UdSSR. Als sogenannte »reparation in kind« gemäß des Jalta-Abkommens mussten sie als »lebende Reparationen« in Sibirien und nördlich des Polarkreises Zwangsarbeit leisten. Insbesondere Frauen, Mädchen und Jungen sowie ältere Menschen waren von den Deportationen betroffen und wurden teilweise erst Anfang der 1950er Jahre aus den Arbeitslagern entlassen. Unzählige Menschen überlebten den Transport in Viehwaggons sowie die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, z. B. beim Straßen- und Bergbau, nicht. 70 Jahre danach berichten die letzten Zeitzeuginnen über ihre Erlebnisse, ihren weiteren Lebensweg und den zermürbenden Kampf um gesellschaftliche Anerkennung und Wiedergutmachung. Begrüßung: Horst Schüler | Ehrenvorsitzender der UOKG e. V. Arnold Vaatz | MdB, stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Filmpräsentation mit einer Einleitung von Filmemacherin Daniela Hendel: »Mit 17 nach Sibirien. Die Deportationen deutscher Frauen und Mädchen in die Sowjetunion 1944 / 1945« Dokumentarfilm von Daniela Hendel und Ivo Smolak, gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2007. Zeitzeugengespräch mit: Gisela Strauss | Zeitzeugin Lea Kubale | Zeitzeugin Dr. Meinhard Stark | Moderation
Aufbruch und Einheit. Präsentation der Webseite www.deutsche-einheit-1990.de
5 Jahre, nachdem die letzte und einzige frei gewählte DDR-Regierung am 12. April 1990 ihre Amtsgeschäfte aufgenommen hat, präsentierte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin die erste multimediale Dokumentation der Regierungsarbeit. Die Webseite "Aufbruch und Einheit. Die letzte DDR-Regierung" bietet umfassende Einblicke in die Arbeit der letzten DDR-Regierung und ihrer Protagonisten. Unter www.deutsche-einheit-1990.de sind ab sofort über 100 Originaldokumente, etwa 200 Fotos sowie 50 Videos und Zeitzeugeninterviews online verfügbar. Das Angebot wird für alle Ministerien kontinuierlich erweitert und ausgebaut. In ihrem Grußwort würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Regierungsarbeit. Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung Anna Kaminsky hob hervor, dass es bisher keine vergleichbare Internetressource gibt, die die Arbeit dieser Regierung darstellt. Wichtig sei neben den Bildern und Dokumenten nicht zuletzt die bilanzierende Rückschau, mit der viele der damals Beteiligten deutlich machten, was gut gelungen ist, aber auch, was man im Nachhinein anders machen würde. Im Podiumsgespräch sprachen Ministerpräsident a.D. Lothar de Maizière, der damalige Außenminister Markus Meckel, der ehemalige Abrüstungs- und Verteidigungsminister Rainer Eppelmann und Kulturminister a.D. Herbert Schirmer über die Eindrücke und Herausforderungen ihrer kurzen, aber intensiven Regierungsarbeit.
Die Stimme des Gulag: Neuer Archivbestand der Bundesstiftung Aufarbeitung
Seit Ende 1989 hat der Historiker Dr. Meinhard Stark mehr als 250 ehemalige Lagerhäftlinge bzw. ihre Kinder in Russland, Polen, Kasachstan, Litauen und Deutschland interviewt sowie vielfältige Dokumente und Überlieferungen zu ihren Lebenswegen zusammengetragen. Sie berichten vom Leben und Überleben im Gulag, aber auch davon, wie die Gulag-Haft das Leben der Familien geprägt hat. Auf dieser Grundlage sind mehrere Monographien über den Gulag erschienen. Im Rahmen eines von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geförderten Projektes der Abteilung für Osteuropäische Geschichte der Universität Bonn sind die über 1.200 Stunden umfassenden Gespräche ebenso wie die schriftlichen Unterlagen im Umfang von mehr als 46.000 Blatt digitalisiert und in einer Datenbank erfasst worden. Aus Anlass der Übergabe dieses einmaligen Quellenfundus an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird dieser Bestand vorgestellt.
Die DDR als Chance. Neue Perspektiven auf ein altes Thema
Seit 1990 sind im vereinigten Deutschland fast 7000 Bücher zur DDR-Geschichte erschienen. Und die Zahl der neuen Titel bleibt alljährlich nahezu konstant. Immer wieder diskutieren Historiker die Frage, ob die DDR mittlerweile überforscht sei. Tatsächlich sagt die Zahl der Bücher mehr über das anhaltende öffentliche Interesse an der SED-Diktatur aus als über den Stellenwert des Themas in der Geschichtswissenschaft. In einer umfassenden Expertise beschreiben die Historiker Dierk Hoffmann, Michael Schwartz und Hermann Wentker die Perspektiven des Themas DDR für künftige historische Forschungen. 18 Autoren nehmen dazu kontrovers Stellung und formulieren zugleich neue Fragen an das alte Thema. Der von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur initiierte Sammelband lud zur Diskussion und zu einer Neubewertung des Forschungsfeldes DDR ein. Einführung: Richard Schröder (HU Berlin). Im Anschluss diskutierten Katja Wildermuth (mdr), Frank Bösch (ZZF-Potsdam), Thomas Großbölting (Uni Münster), Dierk Hoffmann (IfZ München-Berlin), Andrew I. Port (Detroit/ FRIAS Freiburg) und Richard Schröder. Moderation: Ulrich Mählert (Bundesstiftung Aufarbeitung).
Die Oktoberrevolution und ihre Rezeption in den Vereinigten Staaten: Revolutionspanik und First Red Scare
Die Oktoberrevolution löste in den Vereinigten Staaten eine bis dato kaum gekannte Angst vor kommunistischer Unterwanderung im Innern und einer Ausbreitung des Kommunismus im Äußeren aus. Eine Folge hiervon war der US-amerikanische Kriegseintritt auf der Seite der "Weißen" gegen die bolschewistische Regierung Russlands. Soziale Unruhen, wilde Streiks und schließlich die Gründung der Communist Party USA schienen die Befürchtungen der Kritiker zu bestätigen und führten zu massiven Gegenmaßnahmen der US-Regierung. Der Vortrag zeichnete diese bis in eine Hysterie gesteigerte Angst nach, aber verdeutlichte auch die Hoffnungen auf Seiten US-amerikanischer Arbeiter. Vortrag "Die Oktoberrevolution und ihre Rezeption in den Vereinigten Staaten: Revolutionspanik und First Red Scare" von Dr. Helke Rausch (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Begrüßung und Moderation: Dr. Nikolas Dörr (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur).
Wem gehört der Osten? Bauern, Rote Barone und Agrarkonzerne auf dem Land
Die Strukturen der DDR-Agrarwirtschaft prägen bis heute die ländlichen Räume in Ostdeutschland. Betriebe sind dort durchschnittlich fünfmal größer als im Westen und stärker agrarindustriell geprägt, Familienbetriebe und bäuerliche Landwirtschaft hingegen sind kaum vorhanden. In der SED-Diktatur wurde die Landwirtschaft nach sowjetischem Modell und ideologischen Vorgaben umgestaltet. Bodenreform, Enteignungen und Zwangskollektivierung hatten die flächendeckende Proletarisierung der Bauern und die Einrichtung Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften (LPG) zum Ziel. Im Zuge der deutschen Vereinigung profitierten oft alte DDR-Agrarkader von der Privatisierung der agrarindustriellen Betriebe und Flächen. Die übernommenen Strukturen sind heute attraktiv für große Konzerne und Kapitalanleger. Die fünfte Veranstaltung der Reihe »Deutschland 2.0« im Jahr 2017 fragte nach den Spuren der DDR in der ostdeutschen Landwirtschaft. Es wurde unter anderem untersucht, wie sich personelle und strukturelle Kontinuitäten auf die ländliche Wirtschaft und Gesellschaft auswirken, wie die aktuelle politische Debatte darüber verläuft und welche Zukunft der ländliche Raum im Osten zu erwarten hat.
Preisverleihung des ersten Preis der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Diktatur für herausragendes Engagement für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage an Karl Wilhelm Fricke
Am 15. Juni 2017 wurde Dr. h. c. Karl Wilhelm Fricke mit dem ersten Aufarbeitungspreis der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wie kein Zweiter hat sich der Journalist und Publizist der Opposition und dem Widerstand gegen die kommunistische Diktatur in SBZ und DDR gewidmet. Den von Dr. Burkhart Veigel gespendeten Preis nahm die Tochter, Dr. Julia Fricke, entgegen. Der Preisträger selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Preisverleihung teilnehmen. Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung, hielt die Laudatio. Prof. Dr. Horst Köhler, Bundespräsident a. D. übergab den Preis, der fortan Karl-Wilhelm-Fricke-Preis heißen wird.
Marsha Siefert: Appraising the “Propaganda State”: Soviet Media from 1917 to the Present
Beyond Eisenstein's cinematic images and online websites of old Bolshevik posters, what is lasting and significant about the Soviet conceptualization of propaganda and its operationalization through mass media, both domestic and international, over the course of the twentieth century?
Vom Kalten zum Heißen Krieg: Korea 1950 bis 1953 - Vietnam 1955 bis 1975 / Prof. Dr. Bernd Greiner
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e.V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Das erste Panel der Konferenz wurde durch Martin Gutzeit, den Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit eingeleitet. Es folgten Kurzvorträge zum Themenkomplex "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948." In seinem Vortrag "Vom Kalten zum Heißen Krieg: Korea 1950 bis 1953 - Vietnam 1955 bis 1975" ging der Historiker und Politologe Prof. Dr. Bernd Greiner umfassend auf die große Bedeutung dieser beiden Stellvertreterkriege für die zunehme Zuspitzung der Konflikte im Kalten Krieg ein.
Der Kommunismus - Ideologie und Utopie eines Gesellschaftsmodells
Die Deutsche Gesellschaft e. V. und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begaben sich auf einer Konferenz anlässlich des 100. Gedenkjahres auf Spurensuche nach der europäischen Erfahrung mit dem Kommunismus im 20. Jahrhundert.
Zeit für Visionen? Von der Aktualität utopischer Gesellschaftsmodelle
Die Deutsche Gesellschaft e. V. und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begaben sich auf einer Konferenz anlässlich des 100. Gedenkjahres auf Spurensuche nach der europäischen Erfahrung mit dem Kommunismus im 20. Jahrhundert.
Ausstellungseröffnung Voll der Osten. Leben in der DDR
OSTKREUZ Agentur der Fotografen und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur laden zur Premiere der Ausstellung »Voll der Osten. Leben in der DDR« ein, die auf 20 Tafeln über 100 bekannte und unbekannte Fotografien von Harald Hauswald präsentiert. Sie zeigen eine ungeschminkte DDR, an die sich heute selbst Zeitzeugen kaum mehr erinnern. Die Ausstellungstexte hat der Historiker Dr. Stefan Wolle verfasst, der wie der Fotograf in der DDR aufgewachsen ist. In die Ausstellung führt der ehemalige »stern«-Fotoreporter Harald Schmitt ein. Der mehrfach mit dem World Press Photo Award ausgezeichnete Fotograf war von 1977 bis 1983 stern Fotoreporter in der DDR. Im Anschluss findet eine Diskussion mit den beiden Fotografen und dem Autor statt.
Traumjob Treuhand? Akteure im Dialog mit der Forschung
>Die Arbeit der Treuhandanstalt wird bis heute kontrovers diskutiert. Vor allem für Ostdeutsche gilt sie als Symbol für die Schattenseiten der Wiedervereinigung. Ihr Personal verantwortete zwischen 1990 und 1994 den radikalen Umbau der DDR-Planwirtschaft in eine liberale Marktwirtschaft. Dieser Prozess ging mit erheblichen gesellschaftlichen Spannungen und politischen Konflikten einher. Der Bochumer Historiker Marcus Böick hat mit Die Treuhand. Idee Praxis Erfahrung. 1990 bis 1994 (Göttingen: Wallstein 2018) die erste zeithistorische Untersuchung zum Personal sowie zum vielschichtigen Arbeitsauftrag der Privatisierungsbehörde vorgelegt. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur luden zu einer Diskussionsveranstaltung über die Ergebnisse der Untersuchung ins Detlev-Rohwedder-Haus ein.
Anlässlich des Europäischen Tages des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus am 23. August gehen wir der Frage nach, wie heute mit Denkmälern und Erinnerungszeichen, in Gedenkstätten und Museen an die kommunistischen Diktaturen weltweit erinnert wird. Anna Kaminsky stellt exemplarisch einige der Erinnerungsorte vor, die in der soeben erschienenen Publikation dokumentiert sind. Anschließend diskutieren der Botschafter der Republik Litauen, Darius Jonas Semaka, und Markus Meckel, der Vorsitzende des Stiftungsrates der Bundesstiftung, über die Erfahrungen ihrer Familien im Nationalsozialismus und Kommunismus sowie über Formen des Erinnerns in europäischer Perspektive.
Vor 20 Jahren beendete die zweite Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in der SBZ / DDR ihre Arbeit. Nach 69 Sitzungen und 68 öffentlichen Anhörungen mit über 600 Zeitzeugen sowie mehr als 300 Gutachten und Expertisen veröffentlichten die beiden Kommissionen in 32 Bänden einen bis heute grundlegenden, umfangreichen Wissensstand über die SBZ / DDR. Mit der parlamentarischen Auseinandersetzung übernahm der Deutsche Bundestag die Verantwortung für die Aufarbeitung der Geschichte und wies zugleich auf die gesamtdeutsche und gesamtstaatliche Bedeutung hin. Ein zentrales Ergebnis der Kommissionen war die Errichtung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die vor 20 Jahren am 2. November 1998 ihre Arbeit aufnahm und seitdem mit eigenen Angeboten und der Unterstützung der dezentralen Aufarbeitungslandschaft in Deutschland zur Beschäftigung mit Diktatur und Demokratie beiträgt. Enquete Online Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble Anlässlich dieses Doppeljubiläums hat die Bundesstiftung Aufarbeitung am 2. November 2018 um 11 Uhr zu einer Festveranstaltung eingeladen. Nach einem Grußwort von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble sprachen Rainer Eppelmann, Hartmut Koschyk, Markus Meckel und Gerd Poppe sowie weitere Protagonisten von damals und heute über Stand und Perspektiven der Erinnerungskultur in Deutschland und Osteuropa. Neues Themenportal enquete-online vorgestellt Im Rahmen der Festveranstaltung wurde das Themenportal »Enquete-Online« der Öffentlichkeit vorgestellt. Es präsentiert erstmals online die mit 29.000 Druckseiten umfangreichen Ergebnisse der beiden Kommissionen sowie zahlreiche Hintergrundinformationen, Zeitdokumente, Fotos sowie Audio- und Videomaterialien.
Unsere Politik wird, so scheint es, zunehmend von Gefühlen bestimmt. Hier setzt die Ausstellung Die Macht der Gefühle. Deutschland 19 | 19 an, die die Historikerinnen Ute und Bettina Frevert gemeinsam mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erarbeitet haben. Am 5. März 2019 wurde die Ausstellung im Philip-Johnson-Haus in Berlin erstmals öffentlich vorgestellt. Nach einem Grußwort von Andreas Eberhardt, Geschäftsführer der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft diskutierte Dr. Anna Kaminsky, Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, mit den Autorinnen der Ausstellung, Ute und Bettina Frevert, sowie Andreas Görgen, Leiter der Kultur- und Kommunikationsabteilung im Auswärtigen Amt. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Journalistin Andrea Thilo.
Wenn Strafe zur Qual wird - physische und psychische Folter in DDR und Gegenwart
Das Verbot der Folter und grausamer, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Strafe gehört zu den wichtigsten Menschenrechten. Dass diese Rechte in der DDR massiv verletzt wurden, wird unter anderem in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen deutlich. Am 13. Februar 2020 haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen in Berlin zur Podiumsdiskussion „Wenn Strafe zur Qual wird Physische und psychische Folter in DDR und Gegenwart“ eingeladen
Zwischen 1935 und 1955 waren in den Straflagern der UdSSR schätzungsweise fünf Millionen Frauen inhaftiert. Darunter befanden sich junge Mädchen, Mütter und Hochbetagte aus allen sozialen Schichten und Nationalitäten der Sowjetunion sowie Europas. Am 5. März 2020 hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin zum Zeitzeugengespräch "Frauen im Gulag 1938-1955. Zwei Generationen" eingeladen
Kurzbeiträge Prof. Dr. Bernd Greiner, Dr. Christian Ostermann, Prof. Dr. Vladimir Pechatnov
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e.V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Das erste Panel der Konferenz wurde durch Martin Gutzeit, den Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit eingeleitet. Es folgten Kurzvorträge zum Themenkomplex "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948." Die Kurzbeiträge waren wie folgt: "Nachkriegssituation, Systemkonflikt und Atombombe" von Prof. Dr. Bernd Greiner "Die USA" von Dr. Christian Ostermann und "Die UdSSR" von Prof. Dr. Vladimir Pechatnov
Mit der Veranstaltung "Die Kraft des Wortes" wurde am 16. September 2014 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur die christliche Opposition in der DDR und ihre Bedeutung für die Friedliche Revolution 1989 gewürdigt. In diesem Zusammenhang wurde auch über die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR diskutiert. Nach einer Begrüßung durch den stellvertretenden Geschäftsführer der Bundesstiftung Aufarbeitung, Dr. Robert Grünbaum, führte der ehemalige Generalsuperintendent Martin Michael Passauer mit einem Vortrag in das Thema des Abends ein. Darauf folgte eine erste Podiumsrunde, in der die Zeitzeugen Almuth Berger, Dr. Christian Halbrock und Dr. Christoph Demke von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in und mit der kirchlichen Opposition in der DDR berichteten. In der anschließenden zweiten Gesprächsrunde wurde ausgehend von der Situation der evangelischen Kirchen 1989 danach gefragt, ob sich aus dem historischen Verdienst auch eine Verpflichtung für das heutige Wirken der Kirchen ableiten lässt. Darüber diskutierten neben Martin-Michael Passauer die Vikarin der Heilig-Kreuz-Passion-Gemeinde zu Berlin Jasmin El-Manhy, der ehemalige Bischof und Ratsvorsitzende der EKD Wolfgang Huber und die ehemalige Präses der EKD-Synode Barbara Rinke. Beide Gespräche wurden von Jacqueline Boysen von der Evangelischen Akademie zu Berlin moderiert.
Zehntausende Mädchen und Jungen kamen unter widrigsten Bedingungen im sowjetischen Gulag zur Welt. Im Rahmen einer groß angelegten Studie hat der Berliner Historiker Meinhard Stark mehr als 100 Gulag-Kinder sowie einige ihrer Mütter und Väter nach ihren biografischen Erfahrungen befragt. Bei der Veranstaltung "Vergessene Opfer: Kinder des Gulag" wurde die Studie am 24. September 2013 gemeinsam vom Berliner Metropol-Verlag und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vorgestellt. Beim Gespräch berichteten die Zeitzeugen Horst Hennig und Konrad Rayß von ihren persönlichen Erlebnissen im sowjetischen Gulag. Moderation: Dr. Jens Hüttmann (Bundesstiftung Aufarbeitung)
Zwischen Aufarbeitung und Nostalgie. Die DDR in der Erinnerungskultur
Die DDR gibt es nicht mehr, aber in der Erinnerung der Deutschen lebt sie fort. Dabei erscheint der SED-Staat vielen Ostdeutschen heute in einem milderen Licht als im revolutionären Herbst 1989: Voll Nostalgie erinnern sie sich an vermeintlich positive Aspekte ihres Lebens. Für andere stehen dagegen die Mauertoten, die politischen Unrechtsurteile oder die umfassende Überwachung der Menschen durch das Ministerium für Staatssicherheit im Vordergrund. Fast 25 Jahre nach der Friedlichen Revolution wurde am 8. April 2014 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur über die DDR in der heutigen Erinnerungskultur diskutiert. Das Podiumsgespräch bildete den Auftakt der Veranstaltungsreihe "Erinnerungsort DDR - Alltag, Herrschaft, Gesellschaft", die gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft, dem Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung ausgerichtet wird. Impulsvortrag: Prof. Dr. Peter Steinbach. Diskussion: Prof. Dr. Peter Steinbach, Claudia Rusch, Sergej Lochthofen und Saraya Gomis. Moderation: Dr. Ulrich Mählert.
Im roten Eis: Ein Familienschicksal zwischen Berlin, Moskau und Tel Aviv
Gemeinsam mit dem Aufbau Verlag präsentierte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur die Lebenserinnerungen von Sonja Friedmann-Wolf. Als Kind jüdischer Emigranten kam Friedmann-Wolf 1934 in die Sowjetunion und wurde nur wenige Jahre später in die Verbannung nach Kasachstan geschickt. Nach mehr als fünf Jahrzehnten erscheint der Band "Im roten Eis - Schicksalswege meiner Familie 1933-1958" 2013 erstmals im Aufbau Verlag. Aus dem Buch las die Schauspielerin Fritzi Haberlandt. Die Lesung wurde von einem Podiumsgespräch umrahmt, in dem die Herausgeber, Reinhard Müller und Ingo Way sowie die Tochter der Autorin, Ester Noter, vom Schicksal Sonja Friedmann-Wolfs und der Entstehungsgeschichte des Buches berichteten. Dr. Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung moderierte das Gespräch.
Am 4. September 2013 fand in Kooperation mit der asisi GmbH die mittlerweile 10. Zeitgeschichtliche Sommernacht der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. Sie stand unter dem Motto "ÜBER DIE MAUER...LEBENSWEGE - LEBENSTHEMEN". Inmitten des eindrucksvollen Panoramabildes "Die Mauer" von Yadegar Asisi sprachen im Panometer am Checkpoint Charlie die Schriftstellerin Annett Gröschner sowie die Künstler Yadegar Asisi und Thierry Noir darüber, wie das monströse Bauwerk ihr Leben und Schaffen geprägt hat und auch weiterhin bestimmt. Es moderierte Winfried Sträter (Deutschlandradio Kultur). Die Begrüßungsansprache hielt Dr. Anna Kaminsky, Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union
Am 10. Juli 2013 hatten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas der Humboldt-Universität Berlin zu einem Filmabend mit anschließendem Publikumsgespräch eingeladen. Gezeigt wurde David Satters Dokumentation "Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union", die auf dem gleichnamigen Buch basiert, das Satter bereits 2001 veröffentlichte. Nach der Filmvorführung hatte das Publikum die Gelegenheit mit dem Filmemacher ins Gespräch zu kommen. Durch den Abend führte Prof. Dr. Jörg Baberowski von der HU Berlin. Hinweis: Mitschnitt ist in englischer Sprache.
Zum 60. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 organisierte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 24. Mai 2013 eine Journalistenfahrt zu zentralen historischen Schauplätzen in Berlin. Eine Station führte zum ehemaligen RIAS-Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz, heute Sitz des Funkhauses von Deutschlandradio in Berlin. Professor Egon Bahr, im Juni 1953 Chefredakteur des RIAS, berichtete von seinen Erinnerungen an den Volksaufstand. Dabei ging es auch um die Rolle des RIAS bei der Ausbreitung des Aufstandes und dessen Wahrnehmung in West-Berlin und der Bundesrepublik. Das Gespräch wurde moderiert von Peter Lange, Chefredakteur von Deutschlandradio Kultur.
Innenansichten. Unveröffentlichte Videointerviews aus der Zeit des demokratischen Umbruchs in der DDR
Im Februar und März 1990 zeichnete das Ost-Berliner "Institut für Film, Bild und Ton" Interviews mit Protagonisten des demokratischen Umbruchs in der DDR auf, die später im DDR-Schulunterricht Verwendung finden sollten. Im Zuge des Vereinigungsprozesses bleib die Videoreihe unveröffentlicht und geriet in Vergessenheit. Sie wurde vor wenigen Jahren wiederentdeckt und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 2011 mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur transkribiert und digital gesichert. Das Projektergebnis wurde am 5.11.2012 im Deutschen Historischen Museum in Berlin in Ausschnitten der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus trafen einige der damals Interviewten im Rahmen einer Podiumsdiskussion zusammen. Es diskutierten: Tatjana Böhm (Ministerin a. D. und Referatsleiterin im brandenburgischen Arbeitsministerium), Rainer Eppelmann (Minister a. D. und Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung), Gerd Poppe (Minister a. D. und Vorstandsmitglied der Bundesstiftung Aufarbeitung) sowie der Regisseur und Publizist Konrad Weiss. Das Gespräch moderierte Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk.
Am 28. August 2012 fand die neunte Zeitgeschichtliche Sommernacht der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der St.-Elisabeth-Kirche in Berlin-Mitte statt. Der Theologe Prof. Dr. Sándor Fazakas von der Reformierten Theologischen Universität Debrecen in Ungarn analysierte in seinem Festvortrag das Verhältnis von Versöhnung und Aufarbeitung im internationalen Vergleich. Wissenschaftliche und gesellschaftliche Aufarbeitung seien die Grundlage für einen demokratischen Neuanfang, argumentierte Fazakas. Anschließend beantwortete er die Fragen der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wentzien. Die diesjährige Sommernacht der Bundesstiftung bot neben dem Vortrag und dem Gespräch auch die passende musikalische Begleitung: Der Bürgerrechtler und frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Stephan Hilsberg am Klavier und die junge Musikerin Angela Lasota de Andres an der Violine spielten vor, zwischen und nach den Wortbeiträgen Stücke von Ernest Bloch, Sergej W. Rachmaninoff und Edgar Fauré. Schlussrede: Rainer Eppelmann.
Die Förderung von Freiheit und Demokratie als Dimension europäischer Aussenpolitik
Eine Veranstaltung des Auswärtigen Amtes und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus Anlass des 60. Geburtstages von Markus Meckel. Vertreter der Politik und zivilgesellschaftlicher Organisationen diskutierten über Anspruch und Herausforderungen der Demokratieförderung, wie sie von Deutschland und der Europäischen Union betrieben wird. Podiumsteilnehmer: Dr. Joerg Forbrig, Alexander Graf Lambsdorff, Prof. Dr. Istvan Gyarmati, Markus Meckel, Dietmar Nietan. Moderation: Dr. Ulrich Mählert (Bundesstiftung Aufarbeitung)
1972 - Ein Schlüsseljahr für die innerdeutschen Beziehungen
Die Unterzeichnung des Grundlagenvertrags markierte 1972 eine neue Etappe im Verhältnis beider deutschen Staaten. Mit den Verträgen von Moskau und Warschau und dem Viermächte-Abkommen über Berlin war der Grundlagenvertrag Teil der entspannungspolitischen Bemühungen, mit denen sich die Bundesregierung unter Willy Brand die Normalisierung der Beziehungen zu den sozialistischen Staaten Osteuropas und zur DDR erhoffte. Angestrebt wurden menschliche Erleichterungen sowie eine Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls über die Mauer hinweg. Das Jahr 1972 stand im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung zur Reihe »2x Deutschland« über die innerdeutschen Beziehungen von der Teilung bis zur Einheit. Es diskutierten: Prof. Dr. Hermann Wentker (Leiter der Abteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte), Rainer Eppelmann (Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), Dr. Hans Modrow (Ministerpräsident a.D.), Dr. Hans Otto Bräutigam (Minister a.D.). Moderation: Sven Felix Kellerhoff (Journalist).
Was ist mit über achtzig Jahren für einen Schriftsteller zu tun? Den nächsten Roman beginnen? Warum noch einen - alle Geschichten sind erzählt. Doch was jeder Tag aufs Neue bringt, das sind Begegnungen und Erkenntnisse. Erich Loest hat sie notiert und ausgeformt zu Miniaturen voller Weisheit und trockenem Humor. Zwischen August 2008 und September 2010 hielt er fest, was ihn beschäftigte und bewegte: Politisches und Persönliches, Geschichten von unterwegs und von daheim. Heiter-gelassen beobachtet er auch sich selbst. Um das Leben von Tag zu Tag auf den Punkt zu bringen, ist das Tagebuch die ideale Form - für sein erklärtes »Letztbuch« bedient sich Erich Loest ihrer zum ersten Mal. Kurz vor seinem 85. Geburtstag präsentierten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Steidl Verlag Erich Loests »Man ist ja keine Achtzig mehr« in einer gemeinsamen Veranstaltung der Öffentlichkeit.
Demokratischer Aufbruch. Von der Bürgerbewegung zur Parteiendemokratie in der DDR
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete die Abendveranstaltung "Demokratischer Aufbruch. Von der Bürgerbewegung zur Parteiendemokratie in der DDR" in der Geschäftsstelle der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einem Grußwort. Merkel nahm beim Demokratischen Aufbruch (DA) im Februar 1990 ihr erstes politisches Amt an. In ihrem Grußwort erinnerte sich die Bundeskanzlerin an ihre Zeit beim DA als "von unendlicher Leidenschaft und Spontanität geprägte, sehr intensive Monate und an einen wilden Vereinigungsparteitag" mit der CDU. Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung und 1989 Mitgründer des DAs erinnerte an den Beitrag der Bürgerbewegung am Sturz des SED-Regimes und bei der Herstellung der Deutschen Einheit. Beim anschließenden Podiumsgespräch diskutierten die Mitbegründer des DAs Werner E. Ablaß, Margot Friedrich und Dr. Ehrhart Neubert sowie der ehemalige Bürgerrechtler Werner Schulz, MdEP (1989/90 Neues Forum) und der Politologe Prof. Dr. Eckhard Jesse.
»Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.«
Aus Anlass des Erscheinens des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung 2009 hatte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am Montag, dem 27. April zu einem Vortragsabend eingeladen. Trotz frühsommerlichen Wetters fanden über 140 interessierte Bürgerinnen und Bürger ihren Weg in die Kronenstraße 5, den Sitz der Bundesstiftung in der Berliner Mitte, wo sie im Namen der Herausgeber und der Beiräte des Jahrbuchs von Dr. Ulrich Mählert begrüßt wurden. Der Historiker und Journalist Sven-Felix Kellerhoff gab einen konzisen Einblick in die vielfältigen Beiträge des aktuellen Jahrbuches, um alsbald dem Hauptredner des Abends, Prof. Dr. Jörg Baberowski das Wort zu erteilen. In einem fulminanten, rund 40minütigen Vortrag, widmete sich Baberowski den "verwandten Feinden", Stalinismus und Nationalsozialismus in vergleichender Perspektive. Das anschließende, lebhafte Gespräch mit dem Publikum wurde von Sven-Felix Kellerhoff moderiert.
Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens zog die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in ihrer 5. Zeitgeschichtlichen Sommernacht eine Zwischenbilanz der Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen in Deutschland und Europa in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten seit dem Untergang dieser Regimes. Gibt es ein "zu viel" oder ein "zu wenig" an öffentlicher Beschäftigung mit dieser Thematik? Welchen Platz nehmen die Geschichte der DDR und der deutschen Teilung in der gesamtdeutschen Erinnerungskultur ein? Was war die DDR? Was wissen wir vom Leben im real existierenden Sozialismus und welche Folgewirkungen seiner Existenz sind bis heute zu registrieren? Wie geht unsere Gesellschaft mit Opfern und Tätern des SED-Staates um? Wie erinnern wir uns an die Friedliche Revolution von 1989/90? Wie hat sich das vereinte Deutschland seit 1990 verändert? Gibt es die viel beschworene "Mauer in den Köpfen" noch? Wann wird die deutsche Einheit vollendet sein? Rückblick und Ausblick standen im Mittelpunkt eines Podiumsgesprächs, das angesichts von Verdrängung und Verklärung, von Kontroversen und Deutungsstreit zum gemeinsamen Dialog einlud. Eröffnung: Rainer Eppelmann Grußwort: Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel Im Gespräch: Henryk M. Broder, Dr. Wolfgang Huber, Claudia Rusch und Prof. Dr. Richard Schröder, moderiert von Anke Hlauschka. Resümee: Markus Meckel
Schönfärber oder Klassenfeind? Die westdeutsche DDR-Forschung vor 1989
Nach der Wiedervereinigung wurde der westdeutschen DDR-Forschung nicht nur Versagen vorgeworfen, weil sie den Zusammenbruch der SED-Diktatur nicht vorhergesehen habe. Polemisch war auch von Schönfärberei die Rede. Die DDR-Forschung habe sich zumindest partiell zum Helfershelfer der Diktatur gemacht. Andere konstatierten nüchtern, dass die Grundlinien der DDR-Entwicklung vor 1989 auch ohne Archivzugang bereits recht präzise beschrieben worden seien. Die Gründung des Mannheimer Arbeitsbereiches DDR-Geschichte vor 25 Jahren, am 1. April 1981, ist Anlass, die Leistungen und Defizite der westdeutschen DDR-Forschung bis 1989 mit größerer Distanz zu erörtern, als dies Anfang der neunziger Jahre möglich war. Eine Veranstaltung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, des rbb inforadio gemeinsam mit und in der Vertretung der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und und für Europa. Es diskutierten: Prof. Dr. Sigrid Meuschel, Jens Hüttmann, Prof. Dr. Eckhard Jesse, Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Weber. Moderation: Alfred Eichhorn, rbb Inforadio
Konkurrierende Erinnerungen? Eine Zwischenbilanz im "Europäischen Jahr der Zeitgeschichte"
Zur 11. Zeitgeschichtlichen Sommernacht hatte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 11. September 2014 in das Kaiserin-Friedrich-Haus in Berlin geladen. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführerin der Stiftung, Dr. Anna Kaminsky, richtete die Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Professor Monika Grütters ein Grußwort an die Gäste des Abends. Unter dem Motto "Konkurrierende Erinnnerung? Eine Zwischenbilanz im Europäischen Jahr der Zeitgeschichte" diskutierten auf dem darauffolgenden Podium der ehemalige Außenminister der Tschechischen Republik, Karel Fürst zu Schwarzenberg, und der Historiker Dr. Gerd Koenen. Es moderierte Harald Asel vom Inforadio des rbb. Das abschließende Resümee zog Markus Meckel, Ratsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung.
15 Jahre deutsche Einheit: aus diesem Anlass hatte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu der Veranstaltung »Das ganze Deutschland« eingeladen. Präsentiert wurden - in Anwesenheit von Bundespräsident Horst Köhler - ein Sammelband mit Reportagen zur deutschen Einheit und die Preisträger des Plakatwettbewerbs »geschichts-codes: Wir sind ein Volk!«. Begrüßung: Rainer Eppelmann. Einführung in »Das ganze Deutschland. Reportagen zur Einheit«: Erich Böhme. Lesung: Axel Hacke, Nadja Klinger. Laudatio auf die Preisträger des Plakat-Wettbewerbs: Prof. Dr. Martin Sabrow. Preisverleihung in Anwesenheit von Bundespräsident Horst Köhler durch Rainer Eppelmann. Musikalische Begleitung: Tobias Morgenstern, Akkordeon
Zeit für Visionen? Von der Aktualität utopischer Gesellschaftsmodelle
Die Deutsche Gesellschaft e. V. und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begaben sich auf einer Konferenz anlässlich des 100. Gedenkjahres auf Spurensuche nach der europäischen Erfahrung mit dem Kommunismus im 20. Jahrhundert.
Der Kommunismus - Ideologie und Utopie eines Gesellschaftsmodells
Die Deutsche Gesellschaft e. V. und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begaben sich auf einer Konferenz anlässlich des 100. Gedenkjahres auf Spurensuche nach der europäischen Erfahrung mit dem Kommunismus im 20. Jahrhundert.
Marsha Siefert: Appraising the “Propaganda State”: Soviet Media from 1917 to the Present
Beyond Eisenstein's cinematic images and online websites of old Bolshevik posters, what is lasting and significant about the Soviet conceptualization of propaganda and its operationalization through mass media, both domestic and international, over the course of the twentieth century?
Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung der deutschen Sozialdemokratie
Die Oktoberrevolution stellte für die deutsche Sozialdemokratie eine besondere Herausforderung dar. Mit den Bolschewiki hatte erstmals in der Geschichte eine Arbeiterpartei die Macht ergriffen. Dass es sich dabei - konträr zur Vorhersage von Karl Marx - um einen industriell unterentwickelten Staat handelte, stellte auch die theoretische Grundlage der Sozialdemokratie infrage. Das gewaltsame Vorgehen der neuen Machthaber führte zu weiteren Verwerfungen zwischen dem radikalen und reformistischen Flügel der Sozialdemokratie. Mit der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands kam es schließlich zum Bruch der deutschen Arbeiterbewegung. Vortrag "Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung der deutschen Sozialdemokratie" von Prof. Dr. Detlef Lehnert (Freie Universität Berlin). Begrüßung und Moderation: Dr. Ulrich Mählert (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur).
Die Oktoberrevolution und ihre Rezeption in den Vereinigten Staaten: Revolutionspanik und First Red Scare
Die Oktoberrevolution löste in den Vereinigten Staaten eine bis dato kaum gekannte Angst vor kommunistischer Unterwanderung im Innern und einer Ausbreitung des Kommunismus im Äußeren aus. Eine Folge hiervon war der US-amerikanische Kriegseintritt auf der Seite der "Weißen" gegen die bolschewistische Regierung Russlands. Soziale Unruhen, wilde Streiks und schließlich die Gründung der Communist Party USA schienen die Befürchtungen der Kritiker zu bestätigen und führten zu massiven Gegenmaßnahmen der US-Regierung. Der Vortrag zeichnete diese bis in eine Hysterie gesteigerte Angst nach, aber verdeutlichte auch die Hoffnungen auf Seiten US-amerikanischer Arbeiter. Vortrag "Die Oktoberrevolution und ihre Rezeption in den Vereinigten Staaten: Revolutionspanik und First Red Scare" von Dr. Helke Rausch (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Begrüßung und Moderation: Dr. Nikolas Dörr (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur).
Die Stimme des Gulag: Neuer Archivbestand der Bundesstiftung Aufarbeitung
Seit Ende 1989 hat der Historiker Dr. Meinhard Stark mehr als 250 ehemalige Lagerhäftlinge bzw. ihre Kinder in Russland, Polen, Kasachstan, Litauen und Deutschland interviewt sowie vielfältige Dokumente und Überlieferungen zu ihren Lebenswegen zusammengetragen. Sie berichten vom Leben und Überleben im Gulag, aber auch davon, wie die Gulag-Haft das Leben der Familien geprägt hat. Auf dieser Grundlage sind mehrere Monographien über den Gulag erschienen. Im Rahmen eines von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geförderten Projektes der Abteilung für Osteuropäische Geschichte der Universität Bonn sind die über 1.200 Stunden umfassenden Gespräche ebenso wie die schriftlichen Unterlagen im Umfang von mehr als 46.000 Blatt digitalisiert und in einer Datenbank erfasst worden. Aus Anlass der Übergabe dieses einmaligen Quellenfundus an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird dieser Bestand vorgestellt.
Vom Kalten zum Heißen Krieg: Korea 1950 bis 1953 - Vietnam 1955 bis 1975 / Prof. Dr. Bernd Greiner
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e.V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Das erste Panel der Konferenz wurde durch Martin Gutzeit, den Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit eingeleitet. Es folgten Kurzvorträge zum Themenkomplex "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948." In seinem Vortrag "Vom Kalten zum Heißen Krieg: Korea 1950 bis 1953 - Vietnam 1955 bis 1975" ging der Historiker und Politologe Prof. Dr. Bernd Greiner umfassend auf die große Bedeutung dieser beiden Stellvertreterkriege für die zunehme Zuspitzung der Konflikte im Kalten Krieg ein.
Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948
Im Februar 2015 jährte sich die Konferenz von Jalta zum 70. Mal. Nach dem Kriegsende wurde die Welt abermals in zwei rivalisierende Lager geteilt und aus den Verbündeten der ehemaligen Anti-Hitler-Koalition wurden im kalten Krieg erbitterte Feinde. Zum Jahrestag der Konferenz von Jalta luden die Stiftung Berliner Mauer, der Berliner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Zentrum Kalter Krieg e.V. am 26. und 27. Februar 2015 zur Konferenz "Krieg der Welten - Wissenschaftliche Tagung zur Geschichte des Kalten Krieges" in die Vertretung des Freistaates Thüringen beim Bund ein. Das erste Panel der Konferenz wurde durch Martin Gutzeit, den Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit eingeleitet. Es folgten Kurzvorträge zum Themenkomplex "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948." Bei der von Oberst Prof. Dr. Winfried Heinemann moderierten Podiumsdiskussion zum Thema "Vom Verbündeten zum Feind: Das Verhältnis USA/Sowjetunion in den Jahren 1946 bis 1948" diskutierten Prof. Dr. Bernd Greiner, Dr. Christian Ostermann, Prof. Dr. Vladimir Pechatnov sowie Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz.
Zehntausende Mädchen und Jungen kamen unter widrigsten Bedingungen im sowjetischen Gulag zur Welt. Im Rahmen einer groß angelegten Studie hat der Berliner Historiker Meinhard Stark mehr als 100 Gulag-Kinder sowie einige ihrer Mütter und Väter nach ihren biografischen Erfahrungen befragt. Bei der Veranstaltung "Vergessene Opfer: Kinder des Gulag" wurde die Studie am 24. September 2013 gemeinsam vom Berliner Metropol-Verlag und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vorgestellt. Beim Gespräch berichteten die Zeitzeugen Horst Hennig und Konrad Rayß von ihren persönlichen Erlebnissen im sowjetischen Gulag. Moderation: Dr. Jens Hüttmann (Bundesstiftung Aufarbeitung)
Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union
Am 10. Juli 2013 hatten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas der Humboldt-Universität Berlin zu einem Filmabend mit anschließendem Publikumsgespräch eingeladen. Gezeigt wurde David Satters Dokumentation "Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union", die auf dem gleichnamigen Buch basiert, das Satter bereits 2001 veröffentlichte. Nach der Filmvorführung hatte das Publikum die Gelegenheit mit dem Filmemacher ins Gespräch zu kommen. Durch den Abend führte Prof. Dr. Jörg Baberowski von der HU Berlin. Hinweis: Mitschnitt ist in englischer Sprache.
»Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.«
Aus Anlass des Erscheinens des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung 2009 hatte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am Montag, dem 27. April zu einem Vortragsabend eingeladen. Trotz frühsommerlichen Wetters fanden über 140 interessierte Bürgerinnen und Bürger ihren Weg in die Kronenstraße 5, den Sitz der Bundesstiftung in der Berliner Mitte, wo sie im Namen der Herausgeber und der Beiräte des Jahrbuchs von Dr. Ulrich Mählert begrüßt wurden. Der Historiker und Journalist Sven-Felix Kellerhoff gab einen konzisen Einblick in die vielfältigen Beiträge des aktuellen Jahrbuches, um alsbald dem Hauptredner des Abends, Prof. Dr. Jörg Baberowski das Wort zu erteilen. In einem fulminanten, rund 40minütigen Vortrag, widmete sich Baberowski den "verwandten Feinden", Stalinismus und Nationalsozialismus in vergleichender Perspektive. Das anschließende, lebhafte Gespräch mit dem Publikum wurde von Sven-Felix Kellerhoff moderiert.
"Wir wollen freie Menschen sein!" Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 vor 56 Jahren
Anlässlich des 56. Jahrestages des Volksaufstandes lud die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu einem Podiumsgespräch mit Teilnehmern des Aufstands, die ihr Eintreten für demokratische Rechte und Freiheiten mit Haft und Verfolgung durch die SED-Diktatur bezahlten. Als Zeitzeugen waren Herbert Buley und Hardy Firl eingeladen.
"Fußball ist unser Leben!" - Fußballgeschichte im geteilten Deutschland
Sport und Politik - ein immer wieder gern zitiertes Wortpaar, dem zahlreiche Verbindungen und Wechselwirkungen zugeschrieben werden. Für die Zeit der deutschen Teilung wird man dies ohne Zweifel in verschiedener Weise konstatieren können. Sportliche Duelle zwischen Teams beider Staaten wurden andererseits gerne zu symbolträchtigen Kämpfen zwischen den politischen und gesellschaftlichen Systemen stilisiert. Dies betraf in besonderem Maße der Deutschen liebstes Kind in Ost und West - den Fußball. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 luden die Landeszentrale für politische Bildung und die Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt, Deutschlandradio Kultur und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur dazu ein, sich der Fußballgeschichte im geteilten Deutschland zu widmen und zu diskutieren, wie Fußball über die Systemgrenzen hinweg stattfand, wie Sportler und Fans mit der Teilung umgingen und wie trotz gefährlicher Begleitumstände Fußballanhänger aus Ost und West Kontakt hielten. Podiumsgespräch mit Jörg Berger, Fußballtrainer; Christoph Dieckmann, Journalist; Bernd Heynemann MdB, ehem. FIFA-Schiedsrichter und René Wiese, Sporthistoriker.