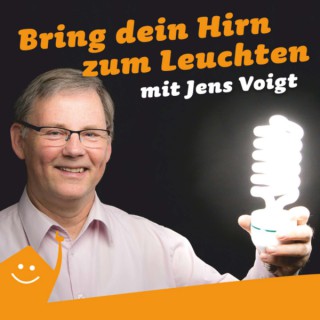Podcasts about funktionsf
- 86PODCASTS
- 106EPISODES
- 28mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Feb 7, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about funktionsf
Latest news about funktionsf
- Leybold Didactic Mobile-Cassy 2 Aufsteller/ Display stand Thingiverse - Newest Things - Apr 4, 2025
Latest podcast episodes about funktionsf
Maduro: Autoritäre Drift, ökonomischer Kollaps und externe Verantwortung (Serie zu Venezuela, Teil 4)
Seit dem Amtsantritt Nicolás Maduros im Jahr 2013 hat sich die politische, ökonomische und menschenrechtliche Lage Venezuelas deutlich verschärft. Zahlreiche nationale und internationale Organisationen dokumentieren seitdem einen wirtschaftlichen Einbruch, einen Rückgang institutioneller Funktionsfähigkeit sowie eine Zunahme staatlicher Eingriffe in politische und gesellschaftliche Prozesse. Gleichzeitig wuchs der internationale Druck auf die Regierung durch diplomatische Maßnahmen undWeiterlesen
Muss Harmonie unbedingt Einigkeit, Übereinstimmung und Konfliktfreiheit bedeuten? Oder kann sie auch dafür stehen, dass die Kommunikation nicht abbricht obwohl wir uns uneinig sind? Wie sieht Harmonie aus, wenn sie für die Funktionsfähigkeit von Kommunikation unter Dissens steht? Karin Barthelmes-Wehr und Irina Kummert über ein moralisches Ideal, das gar keinen moralischen Anspruch braucht, um zu funktionieren.
Wie oft hat man schon von der Leberzirrhose gehört, aber trotzdem weiss man als Laie gar nicht so genau, was das ist. Anhaltende Entzündungen schädigen die Leber, was zu einer Vernarbung derselben führt. Schlussendlich verliert die Leber ihre Funktionsfähigkeit. Die Leber ist ein regenerationsfähiges Organ. Allerdings bleiben die Narben, sagt Yves Borbély. Er ist Gastroenterologe am Berner Inselspital. Übergewicht, ein erhöhter Blutzucker und allen voran der Alkohol setzen der Leber zu, bis es eben zu einer Leberzirrhose kommen kann. Deshalb ist damit einhergehend stets eine Änderung der Lebensgewohnheiten geboten.
Folge 13: Medizinprodukte Frei Schnauze – Weihnachtsgeschenke?
In dieser Folge beleuchten wir aktuelle Veröffentlichungen der Europäischen Kommission, der EMA und von Team-NB und geben ein Update zum Stand der Benennungen der Benannten Stellen. Im Gespräch mit Frau Schuh widmen wir uns außerdem einem hochaktuellen Thema: dem Cyber Resilience Act und der Frage, inwiefern Medizinprodukte davon betroffen sind. Darüber hinaus berichten wir über die Funktionsfähigkeit der ersten vier Module von EUDAMED, informieren über den Verordnungsvorschlag zur Änderung der MDR und der IVDR sowie über weitere geplante Maßnahmen. Am Ende beleuchten wir zwei essenzielle Urteile.
#397: Kontrolle beim RBB und die Interne Revision
Wenn das Bundesverfassungsgericht vom Nutzen einer „gegenseitigen Kontrolle“ spricht und das Ende der "Intendanten-Herrlichkeit" einläutet, dann sollten wir aufhorchen. Das Bundesverfassungsgericht formuliert: „Eine [...] Kontrolle ist tauglicher Aspekt der Gestaltung der Binnenorganisation der Geschäftsleitung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und fördert die Funktionsfähigkeit der Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsleitungsfunktion.“ Heißt auf Deutsch: Die Begrenzung der Macht gewährleistet, dass die Geschäftsleitung ihre Aufgaben besser wahrnimmt. Oder umgekehrt ausgedrückt: Zu viel Macht beeinträchtigt die Geschäftsleitung darin, ihre Aufgaben optimal wahrzunehmen. Beobachten Sie strukturelle Veränderungen und deren Auswirkungen in Ihrer Prüfungspraxis? Hier sind insbesondere die sich verändernden Machtstrukturen interessant. Denn strukturelle Veränderungen können sich auf die Risikofreude bzw. Risikoaversion aber auch auf die IKS-Aversion bzw. IKS-Freudigkeit auswirken. Welche Beobachtungen machen Sie? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse!
Nicht: Was funktioniert gerade so. Sondern: Was macht Freude. Das MVP, Minimum Viable Product, ist in der Digitalbranche längst Standard. Aber: Viable für wen? Und ab wann? Wer nur auf Funktionsfähigkeit schaut, verpasst oft die Chance auf echte Begeisterung.Wir sprechen über das MLP, das Minimum Lovable Product. Also ein Produkt, das man liebt, obwohl es noch nicht alles kann. Vielleicht gerade deshalb. Denn: Produkte, die Freude machen, verzeihen mehr. Werden lieber genutzt. Und bleiben.Mehr Wärme, mehr Glitzern in den Augen und Produkte, die man nicht nur nutzt, sondern gern hat, wünschen …Alex & Chrisvon https://wahnsinn.design Das ist Besser mit Design, ein Wahnsinn Design PodcastVielen Dank fürs Zuhören
60 - Mitochondrien: Dein Energiegeheimnis oder dein stiller Killer?
In dieser Episode von 'One and a Half Therapists' diskutieren Michael Kern und Patrick Dempt die zentrale Rolle der Mitochondrien in unserem Körper. Sie erklären, wie diese kleinen Kraftwerke für die Energieproduktion verantwortlich sind und welche Auswirkungen ihre Funktionsfähigkeit auf unsere Gesundheit hat. Die beiden Therapeuten beleuchten die Bedeutung eines gesunden Lebensstils für die Mitochondrien und geben wertvolle Tipps zur Verbesserung der mitochondrialen Gesundheit.Keywords Mitochondrien, Gesundheit, Energieproduktion, Lebensstil, Langlebigkeit, Stoffwechsel, ATP, neurodegenerative Erkrankungen, Wärmeproduktion, oxidativer Stress, Gesundheit, Mitochondrien, Bewegung, Ernährung, Autophagie, Energieproduktion, Lebensstil, Fasten, Zellregeneration, FitnessTakeawaysMitochondrien sind entscheidend für die Energieproduktion im Körper.Ein Verlust an Mitochondrien kann zu neurodegenerativen Erkrankungen führen.Die Anzahl der Mitochondrien variiert je nach Zelltyp.Energieproduktion erfolgt über ATP, das aus Glukose und Fettsäuren gewonnen wird.Ein schleichender Energiemangel kann über Jahre entstehen.Wärmeproduktion im Körper ist ebenfalls von Mitochondrien abhängig.Lebensstilfaktoren wie Stress und Ernährung beeinflussen die Mitochondrien.Die Neubildung von Mitochondrien kann durch einen gesunden Lebensstil gefördert werden.Langfristige Gesundheit hängt von der Pflege der Mitochondrien ab.Energieprobleme können der Ursprung vieler Krankheiten sein. Viele Menschen nehmen ihre gesundheitlichen Probleme nicht wahr.Es ist wichtig, die eigene Gesundheit aktiv zu hinterfragen.Bewegung ist entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit.Energie muss produziert werden, um aktiv zu bleiben.Autophagie kann durch Fasten gefördert werden.Gesunde Ernährung unterstützt die Mitochondrienfunktion.Fett ist eine bessere Energiequelle als Zucker.Schlaf hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit.Kälte- und Hitzetherapien können die Gesundheit fördern.Mitochondrien sind entscheidend für die Bekämpfung von Krankheiten.Chapters00:00 Einführung in die Mitochondrien02:57 Die Bedeutung der Mitochondrien für die Gesundheit05:52 Energieproduktion und ihre Auswirkungen09:05 Energie und Lebensqualität12:11 Einfluss des Lebensstils auf Mitochondrien15:11 Langfristige Gesundheit und Mitochondrienpflege16:37 Die Wahrnehmung von Normalität und Gesundheit19:16 Energieproduktion und Bewegung21:17 Autophagie und Zellregeneration25:44 Ernährung und Mitochondrien28:25 Praktische Tipps zur MitochondrienpflegeUnser Omega-3 Produkt in Therapie und Training:https://eqology.com/de/__s5b5da4s__/our-productsMit dem Therapeuten-Code 101095065 könnt ihr uns unterstützen!Lust auf mehr? Dann Abonniere unseren Podcast und bleibe am Puls der neuesten Gesundheitstrends!**Folge uns auch auf Social Media:**Homepages: www.kernxund.de - www.patrick-dempt.deInstagram: @kernxund - @patrickdempt_personaltrainingYoutube: @KERNXUND ONE AND A HALF THERAPISTSInformativ - Inspirierend - Unwiderstehlich Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
KI-Revolution im öffentlichen Sektor – Zwischen Effizienz und Rechtssicherheit
Link zum Artikel: KI transformiert die Datenverarbeitung für mehr Effizienz: Warum der deutsche öffentliche Sektor umdenken muss | ADVANT BeitenLinkedIn Dennis Hillemann: (1) Dennis Hillemann | LinkedInKontaktdaten Dennls Hillemann:Rechtsanwalt Dennis Hillemann c/o Rechtsanwälte Advant BeitenNeuer Wall 7220354 Hamburg E-Mail: dennis.hillemann@advant-beiten.com www.advant-beiten.com;Telefon +49.(0)40.68 87 45 - 132Deutschland steht vor einer demografischen Zeitenwende: Bis 2035 sinkt die Zahl der erwerbsfähigen Personen um vier bis sechs Millionen, während fast die Hälfte der öffentlich Bediensteten in den Ruhestand geht. Gleichzeitig revolutioniert Künstliche Intelligenz die Datenverarbeitung in der Privatwirtschaft. Für den deutschen öffentlichen Sektor ist KI längst keine Option mehr – sie ist eine zwingende Notwendigkeit zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats.In dieser Podcast-Episode analysiert ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht die komplexen Herausforderungen und enormen Potenziale von KI im öffentlichen Sektor. Behandelt werden die technologischen Grundlagen von Edge Computing und Echtzeit-Datenanalyse, die rechtlichen Anforderungen des neuen EU AI Acts und dessen risikobasierter Ansatz sowie die spezifischen Hürden für deutsche Behörden: von Datenschutz und IT-Sicherheit über Haftungsfragen bis hin zur Transparenz algorithmischer Entscheidungen.Der Beitrag zeigt konkrete Anwendungsmöglichkeiten auf – von der Automatisierung von Verwaltungsprozessen über verbesserte Bürgerservices bis zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Praxisnahe Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger runden die Analyse ab: strategische KI-Integration unter Wahrung menschlicher Kontrolle, systematischer Kompetenzaufbau und innovative Kooperationsmodelle zwischen Behörden und Privatwirtschaft.
Folge 78 - ICF in der Ergotherapie - mit Kerstin Ulbrich-Bird und Leah Gerlof
In dieser Folge von Performance Skills – Der Podcast für Ergotherapie, die in Kooperation mit der Zeitschrift ergopraxis(Ausgabe 6-25) entstanden ist, dreht sich alles um ein Konzept, das vielen aus dem Studium oder der Praxis bekannt ist, aber dennoch oft abstrakt bleibt: die ICF – die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Gemeinsam mit unseren Gästen , Kerstin Ulbrich-Bird und Leah Gerlof wir einen fundierten Blick auf die Grundlagen der ICF, sprechen über ihre praktische Relevanz und darüber, warum es sich lohnt, sich intensiver mit ihr auseinanderzusetzen. Wir diskutieren, wie sich durch die Anwendung der ICF die Sichtweise auf Menschen und ihre Lebenssituation verändert und welche Unterschiede es zwischen den Begriffen "Teilhabe" und "Betätigung" gibt – zwei zentrale Konzepte der Ergotherapie. Ein praxisnahes Fallbeispiel veranschaulicht die Anwendung, und wir beleuchten auch die Rolle der ICF im interdisziplinären Austausch. Außerdem geben unsere Gäste Tipps für alle, die bisher wenig Berührung mit der ICF hatten und einen Einstieg suchen. Persönliche Einblicke runden das Gespräch ab und zeigen, wer oder was unsere Gäste auf ihrem Weg inspiriert hat. Eine spannende Folge für alle, die Ergotherapie fundiert, klientenzentriert und zukunftsorientiert gestalten möchten. Ihr wollt mehr Infos: https://www.rehadat-icf.de/de/klassifikation/ https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICF/_node.html Viel Spaß mit dieser Folge wünscht euch Sabrina & Robert Schreibt uns gerne unter info@performance-skills.de oder geht auf unsere Instagram-Seite.
Im neuen Podcast mit Stefan Brink und Niko Härting zeigt sich einmal mehr, dass Gerichte und Gesetzgeber immer wieder „Luft nach oben“ lassen, was die Überzeugungskraft ihrer Entscheidungen angeht: Zunächst (ab Minute 00:46) werfen wir in Querbeet einen Blick auf die erfolglose Verfassungsbeschwerde einer Offizierin gegen die disziplinarrechtliche Ahndung der Gestaltung ihres privaten Tinder-Profils (BVerfG Beschluss vom 20. März 2025 - 2 BvR 110/23). Karlsruhe meint, die Verfassungsbeschwerde sei unzulässig, sie genüge nicht den Darlegungs- und Substantiierungsanforderungen des BVerfGG. Letztlich verneint das BVerfG die Beschwer, die von einer zwar in der Personalakte nicht getilgten, aber tilgungsreifen Disziplinarstrafe ausgeht. Naja. Sodann geht es (ab Minute 11:51) um die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 14. April 2025 BVerwG 10 VR 3.25), wonach kein presserechtlicher Auskunftsanspruch gegen den BND zu Erkenntnissen zum Ursprung der COVID-19-Pandemie besteht. Der BND habe plausibel dargelegt, dass die Auskünfte seine Funktionsfähigkeit und die auswärtigen Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen könnten. Auch schade. Keinen Widerspruch sah der BGH (ab Minute 22:02) – Beschluss vom 22. Januar 2025, II ZB 18/23 – zu der einschlägigen Vorentscheidung des EuGH, als er dem Auskunftsersuchen eines Gesellschafters, das auch dem Ziel diente, die Namen, Anschriften und Beteiligungshöhen der Mitgesellschafter dazu zu verwenden, diesen Kaufangebote für ihre Anteile zu unterbreiten, stattgab. Der Kläger begehrte von der Treuhänderin vergeblich Auskunft über persönliche Daten sowie die Beteiligungshöhen der an den Fondsgesellschaften beteiligten Gesellschafter. Zu Recht, sagt der BGH, das auf Kenntnis seiner Mitgesellschafter gerichtete Auskunftsbegehren des Gesellschafters sei lediglich durch das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) und das Schikaneverbot gemäß § 226 BGB begrenzt. In seinem Urteil vom 12. September 2024 hatte der Europäische Gerichtshof offenbar zu viel Spielraum gelassen. Sodann analysieren Niko und Stefan (ab Minute 28:16) den Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD in Sachen Datenschutz, der nun „entbürokratisiert“ werden soll. Die Datenschutzaufsicht soll bei der Bundesdatenschutzbeauftragten „gebündelt“ werden, alle vorhandenen Spielräume der DSGVO wollen die Koalitionäre nutzen, um beim Datenschutz für Kohärenz, einheitliche Auslegungen und Vereinfachungen für kleine und mittlere Unternehmen, Beschäftigte und das Ehrenamt zu sorgen. Und die Vorratsdatenspeicherung wird auch eingeführt, die dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern kommt. In Sachen Informationsfreiheit bleibt der Koalitionsvertrag kryptisch: „Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren.“ Was immer das nun bedeutet … da bleibt viel Luft nach oben!
Die Demokratie ist das einzig funktionsfähige soziale System
Die Verfallsform der Demokratie ist die Ochlokratie und sie ist das asozialste System überhaupt und wir steuern ziemlich direkt darauf zu... Es hilft sich klar zu machen, wie sich #Ochlokraten von #Demokrateten unterscheiden. Die antiken Denker von Perikles über Platon zu Aristoteles machten sich über unseren heutigen Demokratieprobleme tiefgründige Gedanken und zeigten deren Schwachstellen auf. Hören wir auf deren altes Wissen und nutzen es, um unsere Demokratie zu schützen, vor allem vor Leuten wie Weidel, Trump, Musk, Putin und Co, die einen Finanzfaschismus weltweit installieren, der nur den "Super-Reichen" hilft und alle anderen ausbeuten wird. Und das ist leider Fakt...Wachen wir auf und kämpfen wir für ein vereintes soziales, gerechtes und freiheitliches Europa. Buchempfehlung: Den Geist Europas retten. 10 Vorschläge (Link zu Thalia) #akademie3 #denkenlernen #demokratieretten #demokratiestärken #politischephilosophie n #wahl #demokratiewählen #ochlokratie #verfallsformenderdemokratie #platon #platonexperte
Folge 359: Argumente für die Interne Revision gegen automatische Fristsetzungen
In der Prüfung der Internen Revision hätte der externe Prüfer gerne gehabt, dass die Schwere einer Feststellung über einen Automatismus mit der zu gewährenden Erledigungsfrist für Maßnahmen zusammenhängen müsse. Wertschätzend formuliert, halte ich hiervon gar nichts. In diesem Podcast habe ich Argumente gegen diese sinnlose Forderung gesammelt und ausgeführt. Hier schon mal die Kurzform: 1.) Eine Feststellung kann mehrere Maßnahmen bedingen. Gewichtet bzw. klassifiziert wird immer die Schwere der Feststellung. Die einzelnen Maßnahmen werden nicht klassifiziert. Erst wenn alle Maßnahmen erledigt sind, kann eine zugehörige Feststellung geschlossen werden. Bei zeitlich gestaffelten Maßnahmen, macht ein Automatismus keinen Sinn. Würden wir die Maßnahme nur auf die Ad-hoc-Aktivitäten ausrichten, würden wir die nachhaltige Behebung von Feststellungen aus den Augen verlieren. 2.) Wir wollen unsere Unternehmen nicht auf pflastermäßige „Quick-Wins“ konditionieren. Uns geht es um die nachhaltige Behebung von Feststellungen. 3.) Bei sehr gravierenden Feststellungen macht eine zu kurze Frist keinen Sinn, da eine kurzfristige Erledigung schlicht und einfach nicht möglich ist. 4.) Bei weniger gravierenden Feststellungen, die jährliche Aktivitäten betreffen, macht ein Automatismus ebenfalls keinen Sinn. 5.) Um das Standing der Internen Revision zu erhalten, muss der Fachbereich von der Internen Revision bei der Fristvereinbarung gehört werden. 6.) Unrealistisch kurze Fristen führen fast automatisch zu Fristverlängerungen. Diese führen zu einer unnötigen Arbeitslast für die Interne Revision und den Revisionspartner. Wir wollen einen funktionierenden Follow-up Prozess und keine fixen Fristsetzungen die nur zu einem künstlichen Automatismus für Fristverlängerungen führen würden. Schlimmstenfalls würde das die Funktionsfähigkeit des Follow-up Prozesses und damit auch die Funktionsfähigkeit der Internen Revision einschränken. Fallen Ihnen weitere Argumente ein? Dann unterstützen Sie mich und uns alle, bitte! Ergänzen Sie Ihre Argumente bitte in Form eines Kommentars unter diesem Podcast! Gemeinsam können wir dieser Unsitte ein Ende bereiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse!
#147 - Migration: Willkommenskultur statt Panikmache
Über Migration, Flüchtlinge und Einwanderung wird – gerade jetzt in Wahlkampfzeiten – besonders hitzig, ja populistisch diskutiert. Das ist aus mehreren Gründen wenig hilfreich, ja gefährlich. Fakten werden verzerrt, Ängste geschürt, Folgen dramatisiert. Nicht, dass es nicht jede Menge Probleme gäbe, die unbedingt gelöst werden müssen. Aber der Fehler liegt tiefer: es fehlt das klare Bekenntnis als Einwanderungsland und eine deutliche Unterscheidung zwischen fluchtbedingter Zuwanderung und gesteuerter Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Wenn wir nicht aufpassen, zerstört die überdrehte Diskussion die verbliebene Attraktivität Deutschlands für Talente aus aller Welt. Daran aber hängen unser Wohlstand und die Funktionsfähigkeit unserer Sozialsysteme. Eine Podcastfolge als Denkanstoß und Ermutigung für eine langfristig erfolgreiche Haltung und Strategie. Themen: Populismus aus! Warum Verzerrungen und Ängste niemandem helfen und viel schaden. Probleme lösen – aber schnell. Abschiebung, schnellere Verfahren und klare Regeln. Systeme ändern – dringend. Warum falsche Anreize junge Männer übers Meer und in den Tod treiben. Einwanderungsland – ja! Wir sind längst ein Einwanderungsland – dazu sollten wir uns bekennen und selbstbewusste Regelungen schaffen. Country Branding – nötig! Analog zum Employer Branding einer Firma sollten wir als Land eine Marke sein und vom ersten Kontakt an überzeugen. Smarte Prozesse – unbedingt. Kontaktaufnahme, Visum, Bewerbung – sollte alles digital, schnell und auf Englisch funktionieren. Integration – aber besser. Mit klaren Kriterien und Bedingungen selbstbewusst steuern, wer zu uns kommt. Parallelgesellschaften – warum nicht? Der Begriff jagt Angst ein. Aber Menschen vernetzen sich mit Ihresgleichen. Deutsche Rentner an der Costa Blanca oder Saarländer in Berlin bilden genauso Parallelgesellschaften wie Japaner in Düsseldorf oder Amerikaner in Kaiserslautern. Das kann bereichernd sein. Talente gewinnen – global. Talente sind mobil, die besten können sich Land wie Firma aussuchen. Für erfolgversprechende Initiativen braucht es Kooperationen von Kammern, Regionen, Branchenverbänden, Unternehmen und ehrenamtlichen Unterstützern. Als Impulsgeber unterstütze ich gerne Ihr Event - für eine zukunftsorientiertere Haltung und positive Beispiele. Website von Stefan Dietz www.stefandietz.com mit weiteren Ideen und Ressourcen. Anfragen zu Keynotes, Moderation und Veranstaltungstipps: office@stefandietz.com Stefan Dietz als Redner – online und offline - buchen
Folge 353: Interne Revision und Ermessensspielräume beim Follow-up
Wie wichtig ein einheitliches Follow-up ist, wird einem immer dann klar, wenn man die Auswirkungen eines Follow-up-Prozesses mit fast uneingeschränkten Ermessensspielräumen für die Bearbeitenden betrachtet. Als anschauliches Beispiel dient der Artikel "Umwelt? Nicht so wichtig" aus der SZ vom 27.9.2024. Im Untertitel formulieren die beiden Autoren Pascal Hansens und Harald Schumann: "In Dutzenden Verfahren wurden EU-Staaten wegen Verstößen gegen das Umweltrecht verurteilt – ohne ernsthafte Konsequenzen" Diesen Fall habe ich auf die Interne Revision übertragen. Ich habe unterstellt, die EU Kommission müsse sich den Global Internal Audit Standards (GIAS) unterwerfen und habe ChatGPT gefragt, gegen welche der Prinzipien und Standards die EU Kommission mit den in dem Artikel beschriebenen Handlungen verstoßen würde. Nach anfänglichen Hürden (man muss mit ChatGPT wirklich chatten), kam ein erstaunliches Ergebnis zu Tage: Hier die Zusammenfassung der gesamten Analyse Prinzip 1: Demonstrate Integrity: Die EU-Kommission zeigt mehrere Abweichungen in Bezug auf Ehrlichkeit und ethisches Verhalten, insbesondere durch mangelnde Transparenz und politisch motivierte Entscheidungen. Prinzip 2: Maintain Objectivity: Es gibt Abweichungen aufgrund politischer Einflussnahme, die die Objektivität der Kommission beeinträchtigen. Prinzip 3: Demonstrate Competency: Die Kommission scheint ihre Kompetenzen zur Rechtsdurchsetzung nicht in vollem Umfang zu nutzen und hat bei der kontinuierlichen Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten versagt. Prinzip 4: Exercise Due Professional Care: Es gibt Abweichungen in Bezug auf die Sorgfalt und das kritische Urteilsvermögen der Kommission bei der Durchsetzung von Umweltgesetzen. Wenn die EU-Kommission also so wie eine Interne Revision den GIAS unterliegen würde, bzw. verpflichtet wäre, diese einzuhalten, dann würde man ihr wahrscheinlich die Funktionsfähigkeit absprechen. Aus diesem Grund sollten für die Revisorinnen und Revisoren die Ermessensspielräume im Follow-up Prozess nicht zu groß sein. Machen Sie es besser als die EU-Kommission und sorgen Sie für ein konsequentes Follow-up! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse! PS: Was hat ChatGPT falsch gemacht?
Im neuen Podcast sprechen Stefan Brink und Niko Härting in Querbeet (ab Minute 00:42) zunächst über ein Gespräch von Stefan mit Netzpolitik.org zur Informationsfreiheit: Moderne Verwaltung ist transparent ( https://netzpolitik.org/2024/ex-datenschutzbeauftragter-im-interview-moderne-verwaltung-ist-transparent/). Was steht Transparenz der Verwaltung eigentlich entgegen? Welche Rolle spielt die „Fachlichkeit“ der Verwaltung? Und warum ist nicht wirtschaftliche Effizienz, sondern Rechtstaatlichkeit ausschlaggebend? Dann betrachten bei die Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts (ab Minute 12:46) zur „Pegasus“-Entscheidung (https://www.bverwg.de/071124U10A5.23.0): Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist danach nicht verpflichtet, einem Journalisten von FragDenStaat Auskünfte über den Erwerb und Einsatz der Software "Pegasus" zu erteilen. Diese Software ist eine israelische Spyware, mit der mobile Endgeräte mit den Betriebssystemen iOS oder Android ausgespäht werden (Zugriff auf Daten sowie die Aktivierung von integrierten Mikrofonen und Kameras). Zwar gelte – so das BVerwG in seiner noch nicht veröffentlichten Entscheidung - Pressefreiheit auch für digitale Medien. Den erbetenen Auskünften stünden aber überwiegende öffentliche Interessen entgegen: Der BND habe plausibel dargelegt, dass diese Auskünfte seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Die journalistischen Fragen zielten auf die Offenlegung seiner aktuellen nachrichtendienstlichen Arbeitsweise und Methodik ab. Dies könnte mittelbar auch operative Vorgänge gefährden. Zudem wären die Informationen für ausländische Geheim- und Nachrichtendienste und andere mögliche Aufklärungsziele von bedeutendem Interesse. Auch der Schutz der Zusammenarbeit des BND mit solchen Diensten wäre bei Erteilung der Auskünfte beeinträchtigt. Man wundert sich demnach, was ausländische Nachrichtendienste alle nicht wissen … Dann geht es (ab Minute 22:08) um die Frage, was der Verfassungsschutz in den Sozialen Medien zu suchen hat: der Thüringer Verfassungsgerichtshof stärkt das Fragerecht von Abgeordneten (Urteil vom 20.11.2024, https://verfassungsgerichtshof.thueringen.de/media/tmmjv_verfassungsgerichtshof/Entscheidungen/23-00021_Urteil_nicht_barrierefrei.pdf) und tritt der Argumentation der Landesregierung entgegen, bei einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit ergebe sich das Bedürfnis nach Geheimhaltung bereits aus der Natur der Sache. Im Organstreitverfahren zweier AfD-Abgeordneter zum Umgang des Thüringer Verfassungsschutzes mit Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken bekräftigt das Gericht, dass die Landesregierung zumindest allgemeine Informationen hätte geben müssen, etwa die Angabe, wie viele (Fake-)Accounts der Verfassungsschutz in den sozialen Netzwerken nutzt. Angaben darüber, welche Chatgruppen der Verfassungsschutz in der Vergangenheit möglicherweise selbst erstellt habe, seien dagegen nicht vom parlamentarischen Fragerecht umfasst, da die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes ein in der Verfassung verankertes Schutzgut sei. Informationsfreiheit aus Bürgersicht, aus Journalistensicht und aus Sicht des Parlaments – so viel Transparenz war selten …
„Alt ist man erst ab achtzig“: Erkenntnisse der Alter(n)sforschung
Zwischen dem Renteneintritt und dem 80. Lebensjahr ist die gesellschaftliche Teilhabe und das ehrenamtliche Engagement besonders stark ausgeprägt. Diese Gruppe älterer Menschen bildet somit eine wesentliche Basis für die Funktionsfähigkeit und das Zusammenleben unserer Gesellschaft. In unserem Podcast diskutieren wir mit Petra-Angela Ahrens über ihre Studie „Alt ist man erst ab achtzig“, die zeigt, dass sich die Definition des Alters verschiebt und viele Menschen das 80. Lebensjahr als Beginn des Alters betrachten. Diese Ergebnisse bieten Einblicke in die Wahrnehmung des Alters, die Aktivität älterer Menschen in der Gesellschaft und ihre Bedeutung für das Gemeinwohl. Ihr findet den Beitrag „,Alt ist man erst ab achtzig‘: Erkenntnisse der Alter(n)sforschung“ in: Alternde Gesellschaft. Soziale Herausforderungen des längeren Lebens. Jahrbuch Sozialer Protestantismus 6, Gütersloh 2013 Online kostenlos einsehbar unter: https://www.gerhardwegner.de/wp-content/uploads/2020/10/Jahrbuch-6_Alternde-Gesellschaft.pdf Die Studienergebnisse findet ihr in „Religiosität und kirchliche Bindung in der älteren Generation“: Ein Handbuch. Hrsg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. ISBN 978-3-374-03907-4 https://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p3586_Religiositaet-und-kirchliche-Bindung-in-der-aelteren-Generation.html Ahrens, Petra-Angela (2022): Das Engagement der Älteren: Empirische Beobachtungen zu aktuellen Entwicklungen, in: Renzenbrink, Bernt/ Wegner, Gerhard (Hrsg.), Engagement im Ruhestand, Leipzig, S. 37-58: https://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p5235_Engagement-im-Ruhestand.html Ahrens, Petra-Angela (2022): Uns geht's gut. Generation 60Plus: Religiosität und kirchliche Bindung. Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche. Band 11. Münster: LIT Verlag. ISBN 978-3-643-11200-2 https://www.siekd.de/produkt/uns-gehts-gut-2/ ; https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-11200-2 Weitere Infos zum Thema findet ihr unter: Religiosität und kirchliche Bindung in der älteren Generation - Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (https://www.siekd.de/produkt/religiositaet-und-kirchliche-bindung/ ) Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Schreibt uns! --> info@si-ekd.de
Dampfmaschine oder Düsenjäger: Kernbankensysteme in Zeiten der Digitalisierung
Next Level Banking – Der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets
In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie und Innovation, also um die Frage, was sich mit dem Banking der Zukunft verändert. Die Frage regt die Fantasien an, und dabei können wir eines schnell übersehen: Im Kern geht es beim Banking in Zukunft wie schon in der Vergangenheit um die Abwicklung von Transaktionen. Das kann der Zahlungsverkehr sein, das kann der Handel mit Wertpapieren sein. Dass dies reibungslos funktioniert, sollen sogenannte Kernbankensysteme sicherstellen – zentrale Softwarelösungen, die die grundlegenden Bankprozesse und Finanztransaktionen von Banken und Finanzinstituten abwickeln: sicher, effizient, verlässlich und vor allem immer schneller. Und das ist eine zunehmende Herausforderung, bedenkt man allein, dass wir von immer neuen Wegen sprechen, die Kunden für ihre Bankgeschäfte nutzen wollen – vom Online-Banking bis hin zu mobilen Lösungen. Wie also stellt man hier die Funktionsfähigkeit sicher, wie hält ein Kernbankensystem mit den neuesten Entwicklungen in der digitalen Welt Schritt, welche Chancen ergeben sich und welche Hindernisse gilt es zu überwinden? Das wollen wir in dieser Episode diskutieren – mit unserem Gastgeber Daniel Kapffer, der Finanzvorstand der DekaBank und zugleich Chief Operating Officer, und seinem Gast von der BNP Paribas: Dr. Carsten Esbach. Er verantwortet als Chief Operating Officer die Rentabilität und Effizienz des operativen Geschäfts in Deutschland und in Österreich.
Beckenboden Check – Funktions- und Wahrnehmungstest für deine Mitte!
In dieser Folge teile ich Übungen mit dir, über die du herausfinden kannst, wie es deinem Beckenboden so geht! Natürlich kann dieser kleine Test keinen Besuch bei einer Beckenbodenspezialistin ersetzen aber dir doch einen ganz guten Überblick über die Vitalität und Funktionsfähigkeit deines Beckenbodens geben. Gib mir von Herzen gerne ein Feedback auf Instagram oder per E-Mail wie du deinen Beckenboden bei diesem Test wahrgenommen hast!
#99 Piraten + Huthi + Nahost-Konflikt: "Gemengelage wird noch schwieriger"
Die Gewalt gegen Seeleute durch Piraterie nimmt wieder zu, die Zahl der Überfälle auf Schiffe dürfte auf einem aktuellen hohen Niveau stagnieren, meint Oliver Wieck, Generalsekretär von ICC Germany, der deutschen Vertretung der Internationalen Handelskammer, zu der auch das International Maritime Bureau (IMB) gehört – DER Piraterie-Watchdog schlechthin. Wieck sieht in der Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ein großes Warnsignal. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch eine "noch schwieriger werdende Gemengelage" aus Piraten-Überfällen, Attacken der Huthi-Rebellen gegen Schiffe im Roten Meer und dem Nahost-Konflikt zwischen Israel, der Hamas und der Hisbollah sowie ihren jeweiligen Unterstützern. Wieck geht im HANSA PODCAST auf die aktuellen Piraterie-Zahlen der vergangenen Monate ein, vor allem auf die wachsende Gewalt gegen Seeleute: "Die Methoden werden rabiater". Für die Lösung der Problematik spricht er sich für eine effektive internationale Zusammenarbeit aus. "Man wird das Problem nicht beseitigen, indem man die Schiffsbesatzungen aufrüstet." Vielmehr bedürfe es einer Kombination von Sicherheitsmaßnahmen an Bord, internationalen militärischen Schutz-Projekten und vor allem einer stärkeren Bekämpfung der Piraterie-Ursachsen an Land – also in den Herkunftsländern der Piraten. "Militär-Einsätze können immer nur ein Teil der Antwort sein. Aber die Herausforderungen liegen vor allem auch an Land, wo unsägliche Armut herrscht, wo es große Anreize für kriminelle Aktivitäten gibt und wo man viel stärker auf den entwicklungspolitischen Instrumentenkasten zurückgreifen müssen". Schließlich hänge die Funktionsfähigkeit des Welthandels, der für Länder wie Deutschland von essentieller Bedeutung ist, auch von sicheren Seewegen ab. Gerade in der Entwicklungspolitik sei sicherlich noch mehr internationale Zusammenarbeit notwendig. Wieck spricht außerdem unter anderem über eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Piraten und den Huthi-Rebellen, seine Befürchtungen um steigende Überfall-Zahlen, ein "Revival" von bewaffneten Sicherheitsleuten an Bord von Handelsschiffen ("Armed Guards") und entwicklungspolitische Maßnahmen.
#201 Simon Caspary – Kulturentwicklung von Unternehmerfamilien
Kulturentwicklung von Unternehmerfamilien – nahezu jede:r hat irgendwie eine vage Vorstellung davon. Aber worum geht es da eigentlich genau? Unser heutiger Gast, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Organisationsberater und Coach Dr. Simon Caspary, hat eine so handliche wie umfassende Einführung verfasst, die den Begriff der Kultur genauso klärt wie die Unterscheidung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien und deren wechselseitige Beeinflussung. Wie entsteht Kultur? Was bedeutet das für den spezifischen Familientyp Unternehmerfamilie? Warum ist Kultur eine enorm wichtige Resilienzressource? Wieso ist Wandlungsfähigkeit unverzichtbar für die Funktionsfähigkeit von Kulturen, und besonders ihre Resilienzfunktion? Und wie kann man Kultur beeinflussen, obwohl Kultur doch etwas ist, das sich auch eigenständig formt, erhält und verändert? Wir sprechen mit Simon Caspary auch über fundamentale Regeln und Regularien für gelingende Gestaltung von Kultur, wie etwa Vergangenheitsbezug, Commitment der Beteiligten und Vorbildfunktionen von Führungsverantwortlichen. Dr. Simon Casparys Arbeitsschwerpunkte sind On-/Offboarding und Entwicklung von Nachfolger:innen in (Familien-)Unternehmen, Beratung und Begleitung von Übergebenden, Beratung von (Familien-)Unternehmen im Spannungsfeld Kultur, Struktur und Strategie, Teamentwicklung von Führungskräften sowie Moderation. Viel Spaß im Gespräch mit Simon Caspary bei Carl-Auer Sounds of Science. Folgen Sie auch den anderen Podcasts von Carl-Auer: autobahnuniversität www.carl-auer.de/magazin/autobahnuniversitat Blackout, Bauchweh und kein` Bock www.carl-auer.de/magazin/blackout…eh-und-kein-bock Cybernetics of Cybernetics www.carl-auer.de/magazin/cybernet…s-of-cybernetics Frauen führen besser www.carl-auer.de/magazin/frauen-fuhren-besser Formen (reloaded) Podcast www.carl-auer.de/magazin/formen-reloaded-podcast Heidelberger Systemische Interviews www.carl-auer.de/magazin/heidelbe…ische-interviews Zum Wachstum inspirieren https://www.carl-auer.de/magazin/zum-wachstum-inspirieren Zusammen entscheiden https://www.carl-auer.de/magazin/treffpunkt-entscheiden
“Die Bahn ist am Rande der Funktionsfähigkeit” - Claus Weselsky im Gespräch (Express)
Gabor Steingart im Gespräch mit GdL-Chef Claus Weselsky
Der tödliche Messerangriff in Solingen erschüttert das Land. Welche politischen Konsequenzen müssen jetzt folgen? Und welchen Einfluss hat dieser Terroranschlag auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag? Werden davon die Populisten profitieren? Wird das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie sinken?
Folge 331: Anne Brorhilker, die Ex-Chefermittlerin des Cum-Ex Skandals, übt Kritik
Der Podcast „#302 Gefährliche Muster in der Justiz“ über Anne Brorhilker, die Chefermittllerin im Cum-Ex Steuerskandal, kam bei Ihnen so gut an, dass ich von einigen von Ihnen auf neue Entwicklungen hingewiesen wurde. Die Tagesschau vom 22.04.2024 titelte: „Chefermittlerin kündigt überraschend und übt Kritik“. Anne Brorhilker hat reflektiert und sich nach dem Motto "change it, love it or leave it" dafür entschieden, als Staatsanwältin aufzuhören. Interessant! Denn in der Podcastfolge #302 ging es ja um die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege... Aber die Ex-Staatsanwältin wird nicht untätig bleiben. Sie wird sich künftig als Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation Finanzwende für den Kampf gegen Finanzkriminalität einsetzen. In dem Tagesschauartikel stellt sie ihre Sicht der Dinge dar zu: - den Vorwürfen und Einwänden zu ihrer Vorgehensweise bei den Ermittlungen - ihren Feststellungen und - ihren Lösungsvorschlägen und Maßnahmen. Diese reflektiere ich in diesem Podcast. Da es bei dem Cum-Ex Thema ja um Banken geht, fließt hierbei auch mein Hintergrund in der Internen Revision einer Bank ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse!
Von der Idee zur Umsetzung: Die Erfolgsgeschichte der Solarcontainer – Torsten Schreiber
Helden und Visionäre – Dein Weg zur sinnvollen Arbeit und Social Entrepreneurship
Von der Idee zur Umsetzung: Die Erfolgsgeschichte der Solarcontainer Torsten Schreiber von Africa GreenTec Eine Legende geht, sein Erbe bleibt. So titelt die aktuelle Podcastfolge von Goodcast. Torsten Schreiber, Gründer von Africa GreenTec, erzählt in dieser Folge, warum er sein Sozialunternehmen verlässt. Und bevor wir uns ebenfalls tiefergehend damit befassen, reisen wir noch einmal ins Jahr 2016 und veröffentlichen diese spannende Folge aus dem Archiv. Africa GreenTec: Eine Vision für erneuerbare Energien in Afrika So nimmt uns Torsten in der Folge mit in die Anfangszeit seines Unternehmens. In der Anfangszeit fokussiert sich Africa GreenTec auf die Bereitstellung von Solarcontainern (heute Solartainer genannt), die nach Afrika verschifft werden, um dort die ländliche Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Diese innovative Lösung ist eine Antwort auf die fehlende zentrale Stromversorgung in vielen Teilen Afrikas, wo über 80 Prozent der Menschen, insbesondere auf dem Land, ohne Elektrizität leben. Der Weg zur Finanzierung und den Herausforderungen des Social Entrepreneurship Dabei geht Torsten auch auf einen Punkt ein, der auch schon 2016 viele Gründer*innen schmerzt: Die Finanzierung. Dabei spricht er auch Schwierigkeiten an, wie die Begegnung mit klassischen Investoren und deren Skepsis gegenüber sozialen Projekten. Torsten beschreibt die Effektuation Methode, bei der vorhandene Ressourcen optimal genutzt werden, im Gegensatz zur klassischen Methode, bei der zunächst ein Businessplan erstellt und Kapital gesammelt wird. Auch das Bootstrapping, also die Finanzierung von Projekten mit minimalen Mitteln und Unterstützung aus dem eigenen Netzwerk, spielt eine große Rolle in seiner Strategie. Die Bedeutung von Prototypen und Pilotprojekten Ein Thema, was einige Gründer*innen nicht direkt auf dem Schirm haben, sind die Prototypen ihres Produktes. Um die technische Machbarkeit seines eigenen Projekts zu beweisen, hat Torsten einen Prototyp und ein Pilotprojekt entwickelt. Er betont die Wichtigkeit von Pilotprojekten, um den Erfolg und die Funktionsfähigkeit neuer Ideen zu demonstrieren. Dies entspricht auch den Prinzipien der Lean-Startup-Methode, bei der zunächst ein einfaches Modell erstellt wird, um das Konzept zu validieren und später zu skalieren. Viele persönliche und lehrreiche Insights In unseren Podcastfolgen gibt es immer auch persönliche Insights der Gäste. Torsten gibt davon besonders viele mit: Seine Entwicklung als Unternehmer, seine persönlichen Erfahrungen, die Geburt seiner Tochter, der Umgang mit Rückschlägen und Zweifel – um nur ein paar zu nennen. Insgesamt eine schöne Archiv-Folge. Doch eine Frage bleibt. In der Folge kommt auch das Thema auf Social Entrepreneurship zu sprechen – was es in Deutschland braucht und wie sich das Thema entwickeln könnte. Hatte er recht? Über Africa GreenTec Die Africa GreenTec AG ist eines der bekanntesten Sozialunternehmen in Europa. 2016 gegründet, sorgt es in Subsahara-Afrika dafür, dass Menschen, die normalerweise nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, Zugang zu Strom bekommen. Das gelingt durch so genannte Solartainer (Solarkraftwerke). Diese Solarkraftwerke fördern die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort. Zusätzlich bietet das Unternehmen mittlerweile weitere Dienstleistungen wie Kühlräume, Wasseraufbereitung und Internet an. Mittlerweile werden etliche Doofer und mehr als 150.000 Menschen mit Strom versorgt.
Wir Menschen leben, gemeinsam mit Milliarden von Mikroorganismen - dem sogenannten Mikrobiom- in einer großen Wohngemeinschaft: Doch was genau ist der Job dieses faszinierenden körpereigenen Ökosystems, dessen Funktionsfähigkeit vom Zusammenspiel klitzekleiner Wesen wie Bakterien, Pilzen und Urtierchen abhängt und dessen Erforschung immer neue bahnbrechende medizinische Erkenntnisse ans Licht bringt?
Stefan Brink und Niko Härting freuen sich in der neuen Podcast-Folge (ab Minute 00:39) zunächst über eine aktuelle Entscheidung: In Querbeet begrüßen sie die Wahl von Christina Rost zur neuen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Sachsen-Anhalt – das wurde nach fast sechs Jahren Sedesvakanz ja auch Zeit! Dann betrachten sie die Schlussanträge des EU-Generalanwalts in der Rechtssache C-768/21 zur Handlungspflicht einer Datenschutzbehörde, der eine begründete Beschwerde vorliegt und gehen auf die Replik zu Stefans Beitrag „Warum der Bundeskanzler nicht auf TikTok tanzen darf“ in FAZ Einspruch ein. Im Zentrum des Podcasts stehen dann (ab Minute 28:45.) zwei sehr unterschiedliche Entscheidungen des BVerfG: Im Beschluss vom 11. April 2024 - 1 BvR 2290/23 – gibt die 1. Kammer der Verfassungsbeschwerde von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt statt. Im August 2023 twitterte Reichelt wenig sachlich: „Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370 MILLIONEN EURO (!!!) Entwicklungshilfe an die TALIBAN (!!!!!!). Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung?!“. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mahnte Reichelt daraufhin wegen falscher Tatsachenbehauptung ab: Es sei kein Euro an die Taliban geflossen, sondern an Nichtregierungsorganisationen und die Vereinten Nationen. Zwar wies das LG Berlin das Ansinnen des BMZ zurück, da juristische Personen des öffentlichen Rechts keinen Ehrenschutz genössen und der Tweet von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, das Kammergericht erließ jedoch am 14.11.23 eine Untersagungsverfügung gegen Reichelt: Auch das BMZ könnte Ehrenschutz erlangen, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Funktionsfähigkeit einer Institution gefährdet sei. Dem widersprach das BVerfG und gab Reichelt Recht: Dem Staat komme kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu, er müsse auch scharfe und polemische Kritik aushalten. Erstaunlich nur: Über die offenkundig nicht gegebene Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde – es standen Reichelt noch Rechtsbehelfe, auch in der Hauptsache – zur Verfügung, geht Karlsruhe mit einem Halbsatz hinweg. Damit agiert es zunehmend unberechenbar – und völlig anders als bei der Verfassungsbeschwerde des (CUM) EX-Bankers Christian Olearius (Beschluss vom 10.4.2024 1 BvR 2279/23 – ab Minute 44:17), wo die Anforderungen an eine schlüssig begründete Verfassungsbeschwerde äußerst hoch gehängt werden: Die Beschwerde ließe „eine substantiierte Auseinandersetzung mit der seitens des Bundesgerichtshofs herangezogenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vermissen“ – weswegen gravierende Fragen zum Schutz von Tagebuchaufzeichnungen und zu § 353d Nr. 3 StGB unbeantwortet bleiben. Karlsruhe praktiziert also ein „freies Annahmeverfahren bei Verfassungsbeschwerden“ – schade nur, dass dies so nicht im Gesetz steht.
Hier folgt der zweite Teil des Interviewspecials mit Gesundheitscoach Pantelis Germanidis. Und wie schon in Teil 1 geht es in Teil 2 genauso tiefgehend und vollgepackt mit Wissen weiter und wir sprechen - unter anderem - auch noch über folgende Punkte: Die zentrale Rolle der Schilddrüse und Nebenniere Pantelis betont die essentielle Verbindung zwischen Schilddrüse und Nebenniere. Ein Ungleichgewicht in einem dieser Organe beeinflusst direkt die Funktionsfähigkeit des anderen. Die Schilddrüse, zentral für unsere Hormonproduktion, spielt eine vitale Rolle in der Energieversorgung unserer Zellen und damit in der Herstellung von ATP – der Energiequelle unseres Körpers. Die Nebenniere, eng verbunden mit Stressreaktionen, zeigt direkte Auswirkungen auf unsere Mineralienbalance und damit auf unsere gesamte körperliche Verfassung. Die negativen Auswirkungen der Pille Ein spezifischer Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der Pille und deren Auswirkungen auf den Mineralienhaushalt des Körpers. Pantelis erklärt, wie die Einnahme der Pille zu einem Mangel an essentiellen Mineralien führt und eine Östrogendominanz fördert, die wiederum die Entstehung von Endometriose begünstigen kann. Schwermetalle als verborgene Übeltäter Die Diskussion leuchtet auch die Rolle von Schwermetallen wie Aluminium, Cadmium und Quecksilber ausführlich aus. Diese Metalle können tief in unsere Zellen eindringen und dort zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Pantelis liefert praktische Beispiele und Quellen, wie diese Schwermetalle in unseren Körper gelangen und unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten Entgiftung. Einzigartige Diagnosewerkzeuge: Haarmineralanalyse und Irisdiagnose Ein besonderer Teil des Gesprächs widmet sich der Haarmineralanalyse und der Irisdiagnose als revolutionäre Werkzeuge zur tiefgreifenden Diagnosestellung. Diese Methoden ermöglichen es, einen Einblick in die mineralische Balance und die Belastung durch Schwermetalle zu erhalten, sowie genetische Dispositionen und aktuelle Gesundheitszustände zu erkennen.
Folge 302: Gefährliche Muster in der Justiz entdecken
Angenommen, Sie müssten die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege prüfen... Wie würden Sie es angehen? Hätten Sie eine Stichprobe gezogen oder eine bewusste Auswahl von X Fällen getroffen und dann eine Aussage über die Einzelfälle getroffen? Was hätte das Ergebnis bedeutet? Hätten Sie eine Aufbau- oder Systemprüfung in Kombination mit Funktionstests oder eine Prozessprüfung durchgeführt? Oder hätten Sie einen systemischen Blick auf das Ganze geworfen und die wertekonforme Zweckerfüllung auf Basis der zugrundeliegenden Muster geprüft? Hierbei tritt man einen weiteren Schritt zurück und betrachtet nicht nur den Ablauf eines Prozesses, sondern auch die zugrundeliegenden Interessen der einzelnen Akteure. Dann beobachtet man die Interaktionen der Akteure. Ist man weit genug entfernt und löst sich von den Details des Einzelfalls, kann man die zugrundeliegenden Muster erkennen. - Worum geht es wirklich? - Welches Spiel wird hier gespielt? - Welche Spielregeln scheinen zu existieren? - Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln hält? - Welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen hat das? Solche Prüfungsaussagen haben eine noch höhere Aussagekraft. Sie spiegeln die aktuellen relevanten Rahmenbedingungen wieder, und zeigen, wie es in Zukunft laufen wird, wenn diese Rahmenbedingungen so bestehen bleiben werden. Erkennt man diese Muster, lohnt es sich zu unterscheiden, welche davon hilfreich sind und welche nicht. Hilfreiche Muster kann man unterstützen. Nicht hilfreiche Muster sollte man versuchen zu unterbinden. Ein erster Schritt ist immer, diese Muster transparent zu machen und zu benennen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören, viel Erfolg beim Ausprobieren und erfolgreiche Prüfungsprozesse!
STK – Die sicherheitstechnische Kontrolle von Mikrostromgeräten
Willkommen zur 100. Folge unseres Podcasts
"Die Depressionsfalle" - ein Interview mit Thorsten Padberg - Folge 21
Nicht wahr, aber nutzbar - der Systemische Psychotherapie-Podcast
Die Depressionsfalle? So lautet der Titel des 2021 erschienenen Buches von Thorsten Padberg. Er ist niedergelassener Psychotherapeut in Berlin und hat mehrere Jahre intensiv für dieses Buch recherchiert und Gespräche mit international bedeutsamen Forscherinnen und Forschern zum Thema Depression geführt. In dieser Folge kommen Sebastian und Enno mit ihm über sein Buch und die weitreichenden Erkenntnisse und Konsequenzen ins Gespräch. Wieso kann die verbreitete Sicht auf Depression zu einer Falle werden? Warum wird nicht stärker rezipiert, dass es keine stichhaltigen Befunde zu einer Serotonin-Mangel-Hypothese gibt und überhaupt eine biologische Ursache von Depressionen bisher nicht nachweisbar ist? Wieso werden in unserer Gesellschaft Symptome so stark individualisiert und einer mangelnden Funktionsfähigkeit der Person zugeschrieben? Warum bedauert DSM-Erfinder Spitzer heute selbst wieder die Streichung des Wörtchens "reaktiv" im Zusammenhang mit Depressionen? Und warum ist Thorsten als KVT'ler so systemisch unterwegs? All diese Fragen und noch einige mehr beschäftigen die Drei in ihrem angeregten Gespräch. Kleine Warnung: danach möchte man das Buch lesen oder kostenfrei als Hörbuch bei Spotify hören. www.nwan-podcast.de nwan@gmx.de https://www.thorstenpadberg.info/
Mit Christoph Kolumbus auf Entdeckungstour gehen, bei Lauras Fußball-Debüt dabei sein und die eigene Taufe feiern - das Alles bügelt euch die neue Folge direkt in den Gehörgang!
Mit Christoph Kolumbus auf Entdeckungstour gehen, bei Lauras Fußball-Debüt dabei sein und die eigene Taufe feiern - das Alles bügelt euch die neue Folge direkt in den Gehörgang!
Gaza - Al-Shifa-Krankenhaus soll nicht mehr funktionsfähig sein
Die Weltgesundheitsorganisation hat das Al-Shifa-Krankenhaus in Nordgaza als nicht mehr funktionsfähig erklärt. Dort sind noch über 600 Patienten. Nach eigenen Angaben hat Israels Armee Waffen in einem Kinderkrankenhaus in Gazastadt gefunden.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
Notfall-/Krisenmanagement: Pandemieplanung - (Ab-)Sicherung der betrieblichen Funktionsfähigkeit
Hier finden Sie die Audiospur eines informativen Sicherheitsfachartikels aus unserer Sicherheitszeitschrift „SICHERHEIT. Das Fachmagazin.“ zum Thema „Notfall-/Krisenmanagement: Pandemieplanung - (Ab-)Sicherung der betrieblichen Funktionsfähigkeit“. ▬▬▬ Kostenfreies Abo: ▬▬▬ Hier gelangen Sie zum kostenfreien Abonnement von „SICHERHEIT. Das Fachmagazin.“:
Episode 98: Demokratiewächter Bundespolizei – Wir schützen Bundesorgane
Sie gewährleisten die Funktionsfähigkeit unserer Verfassungsinstitutionen und schützen somit unsere Demokratie: Der Schutz von Bundesorganen, umgangssprachlich auch O-Schutz genannt, erfolgt dort, wo politische Entscheidungen entstehen, gefällt und umgesetzt werden. In der 98. Episode von FUNKDISZIPLIN sind Markus und Deniz zu Gast und verraten, mit welchen Vorurteilen sie regelmäßig konfrontiert werden, wie ihr Berufsalltag aussieht und welche Staatsgäste und Promis sie schon willkommen heißen durften.
Ein Standpunkt von Patrick Münch.Auf parlamentarischem Weg trachtet die Klasse der Besitzenden danach, jedes Streben nach Überwindung des Eigentumsungleichgewichts im Keim zu ersticken.„Das BfV hat daher den Phänomenbereich ‚Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates‘ eingerichtet. Die diesem Phänomenbereich zugeordneten Akteure zielen darauf ab, das Vertrauen in das staatliche System zu erschüttern und dessen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.“ So steht es zu lesen auf der Seite des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV). Der Leser ist verblüfft. Es entsteht der Eindruck, dass die bestehenden Verhältnisse vor progressiven Handlungsalternativen geschützt werden sollen. Das Ziel einer progressiven Politik kann aber nur sein, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Dazu ist es notwendig, diese Verhältnisse zu erkennen, so wie sie wirklich sind. Dafür brauchen wir die ständige theoretische Analyse. Aus der theoretischen Erkenntnis leiten wir dann die Praxis ab. Um in diesem Sinne handlungsfähig zu werden, benötigen wir eine klare Strategie und auf dem Wege jeweils die richtige Taktik.... hier weiterlesen: https://apolut.net/delegitimierung-des-widerstands-von-patrick-muench+++Apolut ist auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommen Sie zu den Stores von Apple und Huawei. Hier der Link: https://apolut.net/app/Die apolut-App steht auch zum Download (als sogenannte Standalone- oder APK-App) auf unserer Homepage zur Verfügung. Mit diesem Link können Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen: https://apolut.net/apolut_app.apk+++Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/+++Ihnen gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/+++Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut+++Website und Social Media:Website: https://apolut.netOdysee: https://odysee.com/@apolut:aRumble: https://rumble.com/ApolutTwitter: https://twitter.com/apolut_netInstagram: https://www.instagram.com/apolut_net/Gettr: https://gettr.com/user/apolut_netTelegram: https://t.me/s/apolutFacebook: https://www.facebook.com/apolut/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
#188 Biome-Diagnostics-Gründerin Barbara Sladek: Wie man Darmkrebs frühzeitig erkennen kann
Unser heutiger Gast wusste schon mit neun Jahren, dass sie eines Tages in Oxford studieren wird. Und so kam es auch. Heute ist die studierte Biochemikerin und Molekularbiologin eine erfolgreiche Entrepreneurin. Ihre Firma Biome Diagnostics beschäftigt sich mit dem Darmmikrobiom und entwickelte aus diesem Wissen ein Früherkennungs-Kit für Darmkrebs.Im Gespräch mit carpe diem-Host Holger Potye plaudert Barbara Sladek über die dunklen Geheimnisse der Darmflora und erklärt uns alles, was wir über das größte innere Organ des Menschen wissen sollten. Neben dem Früherkennungs-Kit für Darmkrebs ist es ihr zudem gelungen mittels Stuhlprobe herauszufinden, wie Patient:innen auf eine Krebsimmuntherapie reagieren werden. Dieses Wissen ist für den Bereich der Onkologie sehr bedeutsam. Außerdem erfahren wir, welchen wichtigen Einfluss gesunde Ernährung auf die Funktionsfähigkeit unseres Darms hat (Stichwort: „Du bist, was du isst“) und warum auch bei unserer Ernährung Diversität eine zentrale Rolle spielen sollte.UND … wir lernen in diesem Podcast 39 Billionen Mikroben kennen (die Darm-Population besteht zu 95% aus Bakterien, der Rest sind Viren und Pilze), und die meisten davon lieben. Aber wie in jeder guten Geschichte gibt es auch Bösewichte, die die Darm-Balance gefährden und damit unser Immunsystem schwächen und sich auch auf unsere Stimmung auswirken können. Wer sind die Schurken und wie finden wir sie? Die Antwort darauf gibt es (nur) in diesem Podcast. Wir wünschen viel Vergnügen!Show Notes: Dr. Barbara Sladek hat ihr Doktorat in Oxford gemacht und 2018 mit ihrem Geschäftspartner Nikolaus Gasche ihre Firma Biome Diagnostics gegründet. Seither sind die beiden dem Darmmikrobiom auf der Spur und haben ein Früherkennungs-Kit für Darmkrebs entwickelt. Barbara hat den Minerva Award für Deep Tech Entrepreneurship bekommen und wurde 2022 von der WKO und der Tageszeitung „Die Presse“ zur „Unternehmerin des Jahres“ gewählt. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Wien.Übrigens: Das carpe diem-Magazin findet ihr überall, wo es Zeitschriften gibt und unter carpediem.life/abo. Ihr könnt wählen, mit welcher Ausgabe euer Abo beginnen soll – es kann natürlich mit der aktuellen Ausgabe starten. Die aktuelle Ausgabe von carpe diem finden Sie überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder Sie lassen Sie sich als Einzelheft bequem nach Hause senden. Digital ist das Heft unter kiosk.at/carpediem erhältlich.Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, schreibt einen Kommentar, chattet mit uns via WhatsApp und gebt ihm 5 Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify (Sterne-Wertung am Smartphone möglich). Wir freuen uns ganz besonders über Post, Anregungen und Ideen an: podcast@carpediem.lifeWusstest du schon, dass du jetzt via WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen kannst?Das geht ganz einfach. Speichere die carpe diem-Podcast-Nummer +43 664 88840236 in deinen Kontakten ab.Dann öffne dein WhatsApp und schick uns eine Nachricht. Egal ob als Text- oder Sprachnachricht.Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, Anregungen, Themenideen und Vorschläge für Wunschgäste. Und auf deine Stimme.
Der Automat, aus dem, gegen Münzen, Getränke, Essbares, Bücher oder Kosmetika gewonnen werden konnten, waren noch während der Kaiserzeit sicherlich ein Symbol des Fortschritts, der mechanischen Beherrschung der Welt. Der Drehbuchautor und Journalist Friedrich Raff stellt in seinem Feuilleton aus der Vossischen Zeitung vom 27. März 1923 diese gleich mit den reibungslos und „automatisch“ marschierenden Soldaten der Kaiserlichen Heeres. Kein Wunder also, dass die Münzgeld-Automaten ihre Funktionsfähigkeit mit dem Einschnitt des Ersten Weltkriegs und der damit einher- und daraus hervorgehenden wirtschaftlichen Verwerfungen verloren. Somit wird es zu einer spannenden Frage, ob eine Wiederinbetriebnahme der Automaten eigentlich wünschenswert sei. Frank Riede stellt sie für uns.
220 Mit Voigtis Zahlenstrahl zum leichten Zahlenverständnis
"Das muss doch den Kindern Spaß machen, mit diesem Bild zu arbeiten. Da möchte man am liebsten selbst wieder Kind sein." Meine Eltern hatten uns in der Akademie besucht, um unser Duftkräuter-Labyrinth zu bewundern, da wurden sie Zeuge, wie ein großes Paket geliefert wurde. Aufgeregt öffnete ich die Lieferung und meine Ahnung bestätigte sich: Es war die erste Lieferung unseres neuen Zahlenstrahls- bedrucktes A1 großes Blatt mit einer auf einer Wiese sich schlängelnder Weg, umsäumt mit Steinen und Bäumen. Statisch haftend. Schnell holte ich unser metallenes Flipchart. Die Folie haftete wie von Zauberhand. Die auswechselbaren Zahlenschilder wurden geholt und die magnetischen Autos, die den Weg befahren können. Die Lieferung übertraf meine Erwartungen. Wenn man eine solche neue Lieferung mit einer fertigen, umgesetzten Entwicklung bekommt, ist es wie Weihnachten. Was so einfach auf eine Tischdecke gemalt wurde und schon damals meine Schüler begeisterte, war nun in Schön als Idee umgesetzt. Funktionsfähig, innovativ und echt schön. Meine Mutter (87 J.) hatte da vollkommen recht- so muss Lernen einfach Spaß machen. Ich sehe diesen Zahlenstrahl in ganz vielen Grundschul-Klassenräumen. Es muss uns gelingen, in möglichst vielen Kindern zur Verfügung zu stellen. Er sollte in Grundschulen zur Standardausstattung gehören. Ein Hingucker ist er in jedem Fall.
Ich vermute, dass heute kaum jemand mehr ohne sein Handy unterwegs ist. Man ist erreichbar und kann sich allzeit informieren. Im Alltag geht das auch in den allermeisten Fällen gut. Macht man aber eine Reise oder ist sonst unüblicherweise unterwegs - kann es passieren, dass man das Ladekabel vergisst. Es dauert nicht lange, und das Gerät ist am Ende seiner Funktionsfähigkeit: Akku leer. Dumm gelaufen. Ärgerlich. Hätte man doch dran gedacht. Vergesslichkeit oder Unkonzentriertheit sind häufig dafür verantwortlich. Und warum ist das so? Weil man eben oft zu viel Zeit mit dem Gerät aktiv verbringt. Das klingt bizarr, widersprüchlich. Aber so ist es: das Teil führt zu einer Selbstschädigung: je mehr Aufmerksamkeit es fordert, desto höher das Risiko für Unkonzentriertheit und damit das erwähnte Szenario. Achte doch heute mal auf Deinen Konzentrations- und Aufmerksamkeitshaushalt und bring oder erhalte ihn in einer guten Balance. Ich wünsche Dir einen aussergewöhnlichen Tag! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/audiostretto/message
DCMS-Neuro-Check: die Mikronährstoffanalyse für das Nervensystem
Im DCMS-Neuro-Check wird eine große Anzahl von nervenrelevanten Mikronährstoffen bestimmt. Es ist heute sehr gut belegt, dass eine gute Mikronährstoffversorgung für die Funktionsfähigkeit des Gehirns und des peripheren Nervensystems eine zentrale Rolle spielt. Mikronährstoff-Mängel können die Entstehung psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen begünstigen oder deren Verlauf negativ beeinflussen. Der DCMS-Neuro-Check zeigt auf, welche Mikronährstoffe fehlen und gezielt zugeführt werden sollten.
Deutsche Bahn am Scheideweg: „Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch der Funktionsfähigkeit!“
Kaputte Gleise, kaputte Brücken, kaputte Mitarbeiter. Bei der Deutschen Bahn liegt so viel im Argen, dass selbst die Verantwortlichen Besserung geloben. Mit Milliardeninvestitionen wollen DB-Chef Lutz und Bundesverkehrsminister Wissing schnellstmöglich ein „Hochleistungsnetz“ aufbauen. Aber wie passt das mit den Regierungsplänen zusammen, Infrastruktur und Betrieb zu trennen? Gar nicht, meint Carl Waßmuth, Sprecher beim Bündnis „BahnWeiterlesen
Daniel Kestler ist Visual-Kognitivtrainer und Neuroathletiktrainer. Doch was genau ist Neuroathletik? Welcher Faktor hat Kognitivtraining für Profisportler? Wir reden drüber! Daniel hat eine schöne Beschreibung auf seine Homepage: Ich bin Daniel, 1984 in Würzburg geboren und ausgebildeter Visual- und Kognitivtrainer. Diese zertifizierte Ausbildung habe ich am Sportinternat in Köln, bei DynamicEye absolviert. Zudem habe ich mich von David Hillmer bei BrainBasedMovement in Köln/Hamburg, in Neuroathletik ausbilden lassen. Hier habe ich zwei moderne und gleichzeitig erfahrene Unternehmen gefunden, die sich auf meine Bereiche des Coachings spezialisiert haben und mit denen ich weiterhin zusammenarbeite. Nach den bewussten Erkenntnissen aus 20 Jahren Trainertätigkeit im Fußball, dem zwischenzeitlichen Trainerschein und diversen Hospitationen in Profivereinen, war mir ein tiefgründigeres Wissen über den menschlichen Körper und dessen Leistungsfähigkeit wichtig. Dabei geht es mir nicht um die reine Kraft und Ausdauer, sondern um die bewusste Ansteuerung einzelner Systeme, die im direkten Zusammenhang mit unserer Leistung stehen. Dazu gehört ein fundiertes Wissen über Anatomie und Zusammenhänge im menschlichen Körper. Da wir im visuellen Bereich täglich gefordert sind, müssen unsere Augen auch entsprechend funktionieren, wenn wir darauf angewiesen sind. Das dies in vielen täglichen Beispielen nicht der Fall ist, zeigt sich bereits im Kindesalter. Daher ist mir die Arbeit mit den Augen besonders wichtig. Denn auch unsere Augen werden von Muskeln gesteuert. Und diese lassen sich trainieren. So habe ich als Visualtrainer viele Test- und Trainingsmöglichkeiten um die Funktionsfähigkeit unserer Augen festzustellen und zu trainieren. Viel Spaß beim Hören! Ihr wollt mehr über Daniel Kestler erfahren? Internet: https://kognitivtrainer.de/ Instagram: kognitivtrainer Ihr wollt ein professionelles Techniktraining buchen? Dann schaut auf meinen Seiten vorbei und kontaktiert mich. Instagram: MSIndividual Internet: www.m-steffen.com Blog: www.fussballtechnik.com #fussballtraining #techniktraining #Kognitivtraining #visualtraining #training #fussballpodcast #bundesliga #nlz #coach #leistungssportler #tactic #mental #regionalliga #podcast #individualtaktik #würzburg
„Verächtlichmachung” soll unter Strafe gestellt werden - TE Wecker am 19.06.2022
Grinsen Sie mehr oder weniger offen, wenn Politiker etwas sagen? Lästern Sie etwa? Machen Sie gar Witze und – noch schlimmer – schütten Hohn und Spott über sie aus? Damit soll es künftig vorbei sein. Wir sollen über Politiker nicht mehr lästern dürfen, über sie keine Satiren schreiben und sie nicht kritisieren. Denn der Verfassungsschutz hat eine neue Bedrohung entdeckt, die unsere Demokratie gefährdet: Politiker würden verächtlich gemacht. Und damit werde der Staat delegitimiert. TE-Autor Alexander Wendt hat im neuesten Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz Folgendes ziemlich versteckt gefunden: „Diese Form der Delegitimierung erfolgt meist nicht durch eine unmittelbare Infragestellung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Agitation gegen und Verächtlichmachung von demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates und ihrer Entscheidungen. Hierdurch kann das Vertrauen in das staatliche System insgesamt erschüttert und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.“ „Verächtlichmachung” soll unter Strafe gestellt werden. Wendt hat damit entdeckt, dass jetzt ein Begriff aus der alten DDR übernommen werden soll. Wer hat da Angst, verächtlich gemacht zu werden? Ein Gespräch mit Alexander Wendt. https://www.tichyseinblick.de
Nahrungsmittelunverträglichkeiten betreffen sehr viele Menschen. Diese Unverträglichkeiten werden in unserem Körper durch Stress verursacht. Das wirkt sich auch in der Funktionsfähigkeit unseres Darms aus, was zu weiteren Unverträglichkeiten führen kann. Schließlich wird durch Stress die Verdauung stark behindert. Damit bleibt das Essen länger im Darm, es fault und es entstehen giftige Gase. Diese greifen die Darmschleimhaut an und vertreiben die guten Bakterien. In der Darmschleimhaut kommt es zu Zellschädigungen. Insbesondere sind davon Enzyme für die Laktoseverdauung und den Histaminabbau betroffen. Somit können Laktose und Histamin verbleiben und den bekannten Beschwerden führen. Dies führt zu einer Dysbalance im vegetativen Nervensystem, u.a. mit dem Symptom der Pulsfrequenzerhöhung. Diese Pulserhöhung machte sich Arthur F. Cola zu nutze, um einen Test für Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu entwickeln.
Hallo, ihr Lieben! Es ist Freitag und wir sind wieder mit einer neuen Folge am Start! Wir hoffen, ihr alle hattet eine gute Woche und seid jetzt frisch und bereit uns zuzuhören! Mamba - the magnet - hats erwischt und sie erzählt uns von all ihren Irrungen und Verwirrungen in Bezug zu diesem Thema. Außerdem teilt sie eine weitere Spa-Erfahrung mit uns. Cat ist nicht im Reinen mit sich und ihrem Körper und würde gerne seine Funktionsfähigkeit optimieren, was momentan aber nicht geht. Im Topthema dann geht es um Freundschaft Plus. Ja, liebe Community, weil ihr dieses Thema so sehr wolltet, sprechen wir heute mal darüber. Aufgrund der hohen Nachfrage, erwarten wir dieses Mal natürlich auch exorbitant hohe Hörerzahlen. Also haltet euch ran. Naja, es ist gerade mal wieder mit uns durchgegangen. Wir mögen euch natürlich immer. Auch ohne exorbitant und so. Ach ja, und ein Feedback in unserer Kategorie " peinliche Geschichten" haben wir am Anfang auch noch für euch parat. Also vergesst nicht- ihr seid toll, so wie Ihr Seid! Fühlt euch umarmt und geliebt!
Der Fachkräftemangel gefährdet die kommunale Handlungsfähigkeit. In den deutschen Städten und Gemeinden bleiben immer mehr Stellen unbesetzt, die Funktionsfähigkeit unserer Kommunen ist gefährdet. Heike Krutoff ist Referentin im Programmbereich Personalmanagement bei der KGSt, der Kommunalen Gemeinschafsstelle für Verwaltungsmanagement. Mit ihr Rede ich über sinnstiftende Arbeit, wertschätzende Führungskräfte, Spaß im öffentlichen Dienst und was Bürgermeister*innen noch alles tun können, um ihre Rathäuser zu attraktiven Arbeitsplätzen zu machen.
MTMT #172 - Patellasehnen-Tendinopathie / Patellaspitzensyndrom mit Nils Heim
Im MTMT Podcast #172 haben wir Schmerzcoach Nils Heim zu Gast. Neben seiner Tätigkeit als Sporttherapeut & Athletik-Trainer hat er sich auf das Patellasehnen-Spitzensyndrom und Achillessehnen-Schmerzen spezialisiert. In dem gemeinsamen Deep Dive erzählt uns Nils, was der Unterschied zwischen Patellasehnen-Spitzensyndrom und anderen Knieschmerzen ist und nach welchen Prinzipien er arbeitet, was seine Herangehensweise an dieses Thema ist. Sind die Übungen oder doch die Dosis das Wichtigste bei dem Reha-Prozess? Wie entwickelt sich der Schmerz in einer Session, über mehrere Wochen/Monate eines gemeinsamen Coaching-Prozesses und was macht man wann? Und er verrät uns, ob er Team “Treat the donut” oder Team “Treat the hole” ist und was das bedeutet! Hört rein! ► Mehr über Nils findet ihr hier: https://nilsheim.de ► https://www.instagram.com/nils.heim.schmerzcoach/ ► Patreon: https://www.patreon.com/mtmtgym ► (02:00) Wer ist Nils Heim? ► (03:00) Was ist ein Schmerzcoach? Wieso diese Spezialisierung? ► (07:45) Unterschied zwischen Patellasehnen-Spitzensyndrom und Knieschmerzen ► (12:50) Bildgebende Verfahren ► (17:55) Nils Prinzipien & Arbeit mit seinen Coaches ► (27:00) Reha-Prozess In-Season und Off-Season ► (36:30) ISOs trainieren - aber was dann? ► (46:00) Geheilt vs. Funktionsfähig ► (48:45) Sehnen-Belastungstoleranz & -Kapazität ► (54:15) Schmerzen während des Reha-Prozess ► (01:03:50) Nils Go-To ISOs ► (01:09:30) Pauschalisierung vs. Spezifizierung ► Instagram: https://www.instagram.com/mtmt.gym ► Online Coaching, Apparel und Personal Training: https://www.mtmt.life/store ► Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, kontaktiert uns auf unseren Social Media Kanälen oder schreibt uns unter podcast@mtmt.life !! MTMT Gym ist ein Team von Coaches aus München. Seit 10 Jahren begleiten wir ALLE Arten von Menschen auf ihrem persönlichen Weg. In unserer täglichen Arbeit widmen wir uns den Themen Training, Ernährung, Regeneration und Stress-Management. Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche, mit dem Ziel Athleten und Coaches NACHHALTIG erfolgreich zu machen. MTMT Content ist (meistens) frei von Dogma, Mythen und Bullshit - REAL, TRUE, UNTERHALTSAM und ANWENDBAR.
#20 Physiotherapeutin Das Interview beginnt ab 07:50 Die Physiotherapie beschäftigt sich vor allem mit der Wiederherstellung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers. In unsrem Interview steht uns Jette Rede und Antwort zu allen Fragen zu ihrer Arbeit als Physiotherapeutin. Wir erfahren in diesem Interview, wie es dazu kam, dass sie die Entscheidung getroffen hat, diesen Beruf zu erlernen und welche Schritte sie gehen musste, um heute als Schulleiterin einer Schule für Physiotherapie zu arbeiten. Jette erzählt, welche Unterschiede es zwischen der Ausbildung und dem Studium der Physiotherapie gibt. Jette klärt auch über die verschiedenen Schularten für Physiotherapeuten auf und wie die Ausbildung finanziert wird. Hierbei geht sie auch auf die aktuelle Entwicklung in der Ausbildung ein. Wir erfahren außerdem welche Eigenschaften man für den Beruf benötigt und Jette macht macht Werbung für ihren Beruf, dem viel zu wenig Aufmerksamkeit zukommt. Da Jette in der Lehre arbeitet, erhaltet ihr einen fantastischen Überblick über die Tätigkeiten, Voraussetzungen und Inhalte der Ausbildung zum Physiotherapeuten. Links: Facebook: https://www.facebook.com/Abgecheckt-Dein-Berufswahl-Podcast-104922301873478 Instagram: https://www.instagram.com/abgecheckt_berufswahlpodcast/ Web: https://abgecheckt-podcast.de/ E-Mail: info@abgecheckt-podcast.de abgecheckt! – Dein Berufswahlpodcast stellt dir jede Woche einen neuen Beruf vor und zeigt, wie du diesen Beruf ergreifen kannst, was die Tätigkeiten sind und welche Fakten du über diesen Beruf kennen solltest.
Nr. 2044 Justizminister Buschmann gegen Einstufung ganzer Bundesländer als Hotspot
Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) kritisiert die Pläne der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, das gesamte Bundesland zum Hotspots zu erklären. Buschmann sagte zu „Bild“ (Mittwochausgabe): „Der Hotspot hat klare Voraussetzungen.“ Entweder müsse sich eine besonders gefährliche Virus-Variante ausbreiten oder die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems „vor Ort konkret bedroht“ sein. Web: https://www.epochtimes.de Probeabo der Epoch Times Wochenzeitung: https://bit.ly/EpochProbeabo Twitter: https://twitter.com/EpochTimesDE YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC81ACRSbWNgmnVSK6M1p_Ug Telegram: https://t.me/epochtimesde Gettr: https://gettr.com/user/epochtimesde Facebook: https://www.facebook.com/EpochTimesWelt/ Unseren Podcast finden Sie unter anderem auch hier: iTunes: https://podcasts.apple.com/at/podcast/etdpodcast/id1496589910 Spotify: https://open.spotify.com/show/277zmVduHgYooQyFIxPH97 Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus: Per Paypal: http://bit.ly/SpendenEpochTimesDeutsch Per Banküberweisung (Epoch Times Europe GmbH, IBAN: DE 2110 0700 2405 2550 5400, BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER, Verwendungszweck: Spenden) Vielen Dank! (c) 2022 Epoch Times