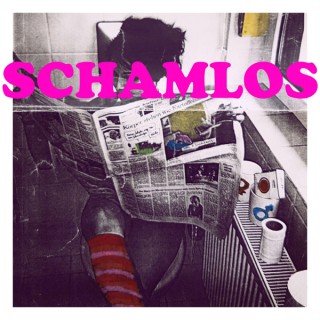Podcasts about parteipolitik
- 87PODCASTS
- 98EPISODES
- 38mAVG DURATION
- 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
- Jan 15, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about parteipolitik
Latest news about parteipolitik
- The Origins of the Investment Theory of Party Competition Institute for New Economic Thinking - Jul 13, 2023
Latest podcast episodes about parteipolitik
Christoph Chorherr eröffnet eine Serie zur „Zukunft der Demokratie“ und spricht mit Judith Kohlenberger, Kurt Guwak und Laurenz Ennser-Jedenastik über die Thesen ihres gemeinsamen Buchs „Demokratie sucht Zukunft – Wie Parteien neu gedacht werden müssen“. Die Gäste schildern, warum Parteien im Vergleich zu Unternehmen strukturell innovationsarm, innerlich verknöchert und stark von Kontrollbedürfnis, Risikoaversion und kurzfristiger Wahllogik geprägt sind. Laurenz Ennser-Jedenastik erklärt mit Verweis auf das „eherne Gesetz der Oligarchie“, wie sich in Parteien funktionale Eliten und mächtige Vetospieler – von Landeshauptleuten bis Bürgermeistern – herausbilden, die Reformen und Zentralisierungsvorschläge blockieren. Judith Kohlenberger beschreibt eine polarisierte Öffentlichkeit, Veränderungserschöpfung und Vertrauensverlust in staatliche Handlungsfähigkeit, während zugleich viele Menschen weiterhin politisch interessiert, aber von Parteipolitik abgestoßen sind. Am Beispiel Migration zeigt sie, wie symbolpolitische Maßnahmen (Asyl-Auslagerung, Scharia-Verbot) echte Zukunftsthemen wie demografischen Wandel und qualifizierte Zuwanderung verdrängen und wissenschaftliche Expertise meist nur für Wahlkampf-Framings abgefragt wird. Im Gespräch über Brexit, Orban, Erdogan, Trump, China und neue rechte Bewegungen diskutieren die vier, warum Demokratien ineffizient wirken, autoritäre Systeme scheinbar „liefern“ – und dennoch nur die liberale Demokratie Menschenrechte, individuelle Freiheit und Machtbegrenzung garantieren kann. Die Runde arbeitet heraus, wie Hyper-Individualisierung, soziale Medien, Boulevardlogik und alternative Medien-Ökosysteme Parteien zusätzlich unter Druck setzen, Politiker:innen zu permanent defensiver Kommunikation zwingen und geteilte Öffentlichkeit erodieren lassen. Am Ende skizzieren die Autor:innen Reformideen: Parteien sollen sich öffnen, echte inhaltliche Beteiligungsräume jenseits von Mitgliedschaft schaffen, Zukunftsbilder und kollektive Ziele stärker in den Mittelpunkt stellen und gemeinsam mit einer aktiven Zivilgesellschaft neue, konfliktfähige und dennoch entscheidungsstarke Formen demokratischer Politik entwickeln.Links zur Folge:Buch "Demokratie sucht Zukunft" (Goldegg-Verlag)Buch "Ungleich vereint" (Suhrkamp-Verlag)Ganz offen gesagt SPEZIAL Über das politische Handwerk - mit Laurenz Ennser-Jedenastik und Christoph Chorherr vom 21.03.2025Initiative "mehrGRIPS""Ehernes Prinzip der Oligarchie" (Wikipedia) Wir würden uns sehr freuen, wenn Du "Ganz offen gesagt" auf einem der folgenden Wege unterstützt:Werde Unterstützer:in auf SteadyKaufe ein Premium-Abo auf AppleKaufe Artikel in unserem FanshopSchalte Werbung in unserem PodcastFeedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.atTranskripte und Fotos zu den Folgen findest Du auf podcastradio.at
„Die Idee ist wichtig, nicht die Macht“ – Team Freiheit im Interview | Zweifel & Zuversicht Folge 2
Es gibt Probleme und sie müssen benannt werden. Doch wir wollen nicht bei der Problembeschreibung stehenbleiben und nur nörgeln, sondern konstruktive Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und diskutieren. Willkommen bei Zweifel und Zuversicht der Sendung für Klartext mit Lösungsansätzen. Wie zufrieden sind Sie mit dem derzeitigen Umfeld der Parteipolitik? Welche Auswüchse hat Fraktionszwang, Berufspolitikerkarriere und was schränkt die gefühlte Freiheit ein? Heute spreche ich mit zwei ehemaligen Bundestagsabgeordneten über politische Parteien, besser gesagt um bestehende Probleme etablierter Parteien und auch darüber, warum beide mit dem Verein Team Freiheit als sogenannte Antipartei voller Zuversicht sind. Herzlich willkommen, Frau Petry und herzlich willkommen, Herr Kemmerich!
Aktivismus, Parteipolitik und der angebliche Bürgerkrieg in Gießen - mit Sören Krupka
Von "bürgerkriegsähnlichen Situationen" war die Rede in der medialen Berichtserstattung zu den Gegendemonstrationen am Tag der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen 2025. Das stört Sören Krupka besonders und damit möchte er aufräumen. Wir sprechen zunächst mit ihm über seine politische Reise – von der Studierendenvertretung über Volt bis hin zum Aktivismus auf der Straße. Er reflektiert, wie sich Parteiarbeit und Aktivismus ergänzen können, ohne sich zu widersprechen. Und wir arbeiten auf, was in Gießen wirklich passiert ist.Besprochene Themen:Wie Sören zu Volt kam: von der Studierendenvertretung in Wolfsburg zur Co-Landesvorsitzenden in NiedersachsenWarum er sich zunächst vor Parteistrukturen fürchtete – und wie er sie dann selbst gestalteteSein „Hobby neben dem Hobby“: Aktivismus als Ergänzung zur ParteiarbeitDie Verbindung von Volt zu aktivistischen BündnissenDefinition von AktivismusDie Grenzen zwischen zivilem Ungehorsam und Militanz und wo die rote Linie verläuft"Bürgerkrieg" in Gießen: Wie sah die Demo aus, was passierte wirklich?Kritik an Polizei und Demonstrierende: Wasserwerfer, Vermummung, ClownsWarum man sich nicht entscheiden muss zwischen Partei und StraßeWie man seine Rolle findetLiberalismus heute: Welche Freiheit suchen wir eigentlich?Nützliche Links:Europe Cares: https://www.europecares.org/Buch "Wie Demokratien sterben": https://www.perlentaucher.de/buch/steven-levitsky-daniel-ziblatt/wie-demokratien-sterben.htmlDemo Gießen Berichterstattung: https://www.deutschlandfunk.de/demo-berichterstattung-zwischen-aktivisten-und-polizeiberichten-100.htmlVersammlungsrecht: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatliche-ordnung/versammlungsrecht/versammlungsrecht-node.htmlÜber VoltVolt ist die erste pan-europäische Partei, aktiv in über 30 Ländern. Volt setzt sich für mehr Teilhabe, Klimaschutz, digitale Innovation und soziale Gerechtigkeit ein. Sie verbindet progressive Politik mit wissenschaftlich fundierten Lösungen und setzt auf transnationale Zusammenarbeit. Europäisch denken, lokal handeln. Mehr dazu unter https://voltdeutschland.org
Rund um die Feiertage nehmen sich Helene Bubrowski und Michael Bröcker Zeit für ausführlichere Gespräche. Zu Gast ist Cem Özdemir, der im kommenden Jahr eine Trendumkehr für die Grünen erreichen will. Sein Ziel: das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. In Umfragen auf Bundes- wie auf Landesebene stehen die Grünen derzeit jedoch unter Druck.Özdemir betont die Eigenständigkeit der baden-württembergischen Grünen und grenzt sich bewusst von der Bundespartei ab: „Ich will nicht Parteipolitik machen, sondern gute Politik fürs Land.“[10:28]Die EU-Staats- und Regierungschefs haben einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Der Ökonom Daniel Stelter sieht darin eine Einführung von Euro-Bonds durch die Hintertür. Er warnt vor einer schleichenden Schulden- und Transferunion zulasten der deutschen Steuerzahler und kritisiert die Zustimmung von Friedrich Merz als „ausgesprochen problematisch“.[01:28]Hier geht es zur Anmeldung für den Space.TableTable Briefings - For better informed decisions.Sie entscheiden besser, weil Sie besser informiert sind – das ist das Ziel von Table.Briefings. Wir verschaffen Ihnen mit jedem Professional Briefing, mit jeder Analyse und mit jedem Hintergrundstück einen Informationsvorsprung, am besten sogar einen Wettbewerbsvorteil. Table.Briefings bietet „Deep Journalism“, wir verbinden den Qualitätsanspruch von Leitmedien mit der Tiefenschärfe von Fachinformationen. Professional Briefings kostenlos kennenlernen: table.media/testenHier geht es zu unseren WerbepartnernImpressum: https://table.media/impressumDatenschutz: https://table.media/datenschutzerklaerungBei Interesse an Audio-Werbung in diesem Podcast melden Sie sich gerne bei Laurence Donath: laurence.donath@table.media Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
100 Shades of Männlichkeit: Linke Männer und die Frage nach der Identität
Was bedeutet heute Männlichkeit? Eine neue SOTOMO-Studie zeigt: Viele junge Männer wissen darauf keine klare Antwort. Zwischen Vorwürfen toxischer Männlichkeit und feministischen Erwartungshaltungen geraten besonders linke Männer in eine Identitätskrise. Wie kam es dazu – und was heisst das für Liebe und Beziehungen? Stephanie Gartenmann und Camille Lothe über Männlichkeit und Parteipolitik.
Luhmanns Hypothese lautet, dass Politik und Recht zwei autonome, operativ geschlossene Funktionssysteme sind. In Abschnitt IV untersucht er hierfür weitere Anhaltspunkte. So geht er der Frage nach, wie Lobbyismus zu bewerten ist: Wie hoch ist der Einfluss von JuristInnen auf das politische System? Anmerkung: Das ist heute besser erforscht als zur Entstehungszeit des Buches vor rund 30 Jahren. In vielen Ländern gibt es Lobbyregister. Mit Studien belegen Nicht-Regierungsorganisationen regelmäßig, mit welchen Lobby-Etats Interessenverbände Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. In Deutschland z.B. LobbyControl, auf EU-Ebene das Corporate Europe Observatory. Nicht selten werden ganze Textpassagen von externen »ExpertInnen« in Gesetzestexte übernommen, teils im Wortlaut. Ohne Zweifel ist der »legislative Fußabdruck« heute besser dokumentiert als in den 1990er-Jahren. Hauptauftraggeber für juristische (Lobby-)Aktivitäten sind Wirtschaftskonzerne, allen voran die Finanzlobby. Die Erforschung von Kontaktnetzwerken hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Netzwerk- und Diskursanalysen nehmen zu. Luhmanns Frage ist jedoch: In welchem Funktionssystem wird der juristische Einfluss tatsächlich wirksam? Die Entscheidung, einen von JuristInnen verfassten Text in ein Gesetz zu übernehmen, ist eine politische. Das Risiko, damit womöglich gegen geltendes Recht zu verstoßen, trägt der Gesetzgeber allein. JuristInnen mögen die Texte entworfen haben. Die Frage ist jedoch, ob sie überhaupt politische Kontakte pflegen. Häufig vermitteln »Politikberater« die juristische Expertise an die Politik weiter. Ausschlaggebend sind persönliche Beziehungen, um überhaupt Kontakt in Entscheidungskreise des politischen Systems zu erlangen. Juristische Expertise wird natürlich vorausgesetzt. Entscheidend ist jedoch, wie gut ein Akteur mit der Politik vernetzt ist. Eben da setzen LobbyistInnen an. Für die Politik ist zudem die Frage wichtig: Welche Bedeutung hat ein Interessenträger, der JuristInnen beauftragt mit dem Ziel, politischen Einfluss zu nehmen? Eine derartige »Verwendung« von Anwälten ist jedenfalls eher dem politischen System zuzuordnen als dem Rechtssystem. Kurz, der bloße Status »Jurist« ist als alleiniges Kriterium nicht aussagekräftig genug. Man kann damit eine Kommunikation nicht zweifelsfrei Politik oder Recht zuordnen. Wären Politik und Recht eine Einheit, müsste es umgekehrt denkbar sein, dass rechtsdogmatische Erfindungen innerhalb der Parteipolitik zum Thema werden können. Anhand der juristischen Beispielthemen »Anscheinsvollmacht« und »culpa in contrahendo« erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber sich mit solchen juristisch zu entscheidenden Problemlagen befassen würde. Doch selbst wenn er es täte, ist anzunehmen, dass Gerichte derartige Problemstellungen systemintern weiterentwickeln würden. Nachdem der IV. Abschnitt die These von der operativen Geschlossenheit beider Systeme untermauert, will Luhmann im Folgenden überprüfen, ob diese These widerlegbar ist, sowohl von der politischen als auch von der rechtlichen Seite aus. Denn selbstverständlich sind die Kommunikationssysteme Politik und Recht füreinander offen – jedoch nur auf der kognitiven Ebene. Das bedeutet, beide Systeme sind füreinander Umwelt und nehmen jeweils Informationen aus der Umwelt auf. Verarbeitet werden solche »externen Fakten« jedoch systemintern, in operativer Geschlossenheit. Dies erfolgt anhand der inneren Codierung: Im Recht dreht sich alles um die Unterscheidungen von Recht/Unrecht sowie gleicher/ungleicher Fall. In der Politik läuft jede Entscheidung durch den Filter, ob sie mehr/weniger Macht bedeuten könnte. Dieses Verhältnis von operativer Geschlossenheit und kognitiver Offenheit bringt der Terminus »strukturelle Kopplung« zum Ausdruck. Strukturelle Kopplung wird in Kapitel 10 Thema sein. Darauf bereitet der IV. Abschnitt allmählich vor.
Parteipolitik statt Grundgesetz: SPD zementiert ihre Macht in Karlsruhe
Der Bundestag hat neue Bundesverfassungsrichter gewählt. Aber die Nominierung und die Wahl dieser Personen ist ein Politikum. Denn die Auswahl der Verfassungsrichter wird vor allem von SPD und Grünen als Mittel des Machterhalts missbraucht. Das ist ein Trend, den allerdings die CDU in Gang gesetzt hatte: Angela Merkel hatte einst den Wirtschaftsanwalt Stephan Harbarth, einen Wirtschaftsanwalt, ins Gericht geschickt. Im Gericht erwies er sich als höriger Merkel-Vertrauter. Auch die Grünen haben schon in der Vergangenheit Gabriele Britz installiert, die ihre Urteilsbegründungen von ihrem Ehemann, der Grünen-Politiker ist, abgeschrieben hat. Die neu gewählten Verfassungsrichterinnen setzen diesen Trend fort. Sigrid Emmenegger hat im Parteisystem der SPD Karriere gemacht. Sie will einen „Verfassungswandel“ erreichen, nicht indem das Grundgesetz geändert wird – sondern in dem das bestehende Gesetz einfach anders interpretiert wird als bisher. Das Ergebnis ist eine Grundgesetzänderung ohne Abstimmung, ohne Parlament, ohne Bürgerbeteiligung. Ann-Kathrin Kaufhold geht noch weiter. Sie arbeitete schon in der Vergangenheit an der Enteignung von Wohnungskonzernen und bereitet den SPD-Angriff auf das Erbrecht vor. Und mittels Verfassungsgerichtsurteilen sollen radikale Klimaziele am Parlament vorbei umgesetzt werden. Die CDU macht all das mit; zu sehr ist sie auf den kurzfristigen Machterhalt konzentriert. Und dabei sieht sie nicht, dass sie einer links-grünen Minderheit auf Jahre die Macht zementiert.
#81 Raus aus Parteipolitik - rein ins Wirtschaftswunder Nachhaltigkeit! Wie wir scheinbare Widersprüche auflösen.
Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen - mit dem Sustainability Podcast für Leader: Gewinne Zukunft.
Höre von zwei Meistern ihres Faches, wie sie es schaffen, über Partei- und Denkgrenzen hinweg Menschen hinter einer Vision zu einen. *** Wiederholung einer der erfolgreichsten Folgen in der Sommerpause - super passend zu aktuellen politischen Fragen. *** Bertram Fleck sorgte dafür, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis Deutschlands erster klimaneutraler Landkreis wurde. Nebenbei entstand ein kleines Wirtschaftswunder für die strukturschwache Region, bei dem über eine Milliarde Euro vor Ort gebunden wurde. Im Gespräch erklärt er die enorme Wirtschaftlichkeit seiner nachhaltigen Energiestrategie und die entscheidende Taktik aus Pragmatismus, Kollaboration und auch einer Portion Schlitzohrigkeit. Zudem erklärt Heinrich Strößenreuther - zur Zeit der Aufnahme CDU Mitglied, Gründer der KlimaUnion und einer der erfolgreichsten Campaigner in Deutschland - was es braucht, um Menschen für die Investition in Nachhaltigkeit und Erneuerbare zu gewinnen. Und warum sich für Gemeinden und Unternehmen durch Energieeffizienz, Windkraft und Solarenergie eine einmalige Chance bietet, sofern sie schnell genug agieren und das Feld nicht anderen überlassen. Eine grandiose Folge für alle Menschen, die in ihrem Unternehmen mit knappen Ressourcen und angesichts großer Skepsis Klimaziele vorantreiben. Nach dieser Folge hast Du jede Menge Anregungen für Deine Arbeit Nachhaltigkeitsmanager*in. Über Bertram Fleck: Bertram war von 1998 bis 2014 Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis und hat dafür gesorgt, dass die Gemeinden vor Ort eine beispiellose Energiestrategie umgesetzt haben. Über Heinrich Strößenreuther: Ist vermutlich einer der erfolgreichsten Klima-Campaigner in Deutschland. Er hat den Volksentscheid hinter Deutschlands erstem Radgesetz auf die Beine gestellt, ist Mitgründer von German Zero und Mitgründer der KlimaUnion. Vorher war er lange im oberen Management der Deutsche Bahn für Umweltthemen zuständig. Mittlerweile ist Heinrich als Mitglied von der CDU zu den Grünen gewechselt. Zu Zeit der Aufnahme waren Bertram und Heinrich gemeinsam auf Tour in Ostdeutschland zum Thema Energie- und Klimapolitik: https://clevere-staedte.de/projekt/Osttour
Ein Spaziergang mit Carsten Linnemann
Er wollte Arbeitsminister werden, ist aber lieber doch Generalsekretär der CDU geblieben: Carsten Linnemann. Gordon Repinski war mit ihm spazieren und hat auf einer Runde zwischen Konrad-Adenauer-Haus und Tiergarten über die wichtigen Themen von Regierung bis Parteipolitik gesprochen. Linnemann spricht über die Analyse des Wahlkampfs, die neue Rolle von Merz als Kanzler, den Anspruch als Volkspartei immer noch 30 Prozent plus zu erreichen und um vertane Chancen und neue Chancen geht es auch. Außerdem erklärt der CDU-Generalsekretär, wie er aus der Parteizentrale eine Denkfabrik machen will. Das Berlin Playbook als Podcast gibt es morgens um 5 Uhr. Gordon Repinski und das POLITICO-Team bringen euch jeden Morgen auf den neuesten Stand in Sachen Politik — kompakt, europäisch, hintergründig. Und für alle Hauptstadt-Profis: Unser Berlin Playbook-Newsletter liefert jeden Morgen die wichtigsten Themen und Einordnungen. Hier gibt es alle Informationen und das kostenlose Playbook-Abo. Mehr von Berlin Playbook-Host und Executive Editor von POLITICO in Deutschland, Gordon Repinski, gibt es auch hier: Instagram: @gordon.repinski | X: @GordonRepinski. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Das Kreuz mit dem C - Die Christdemokraten und die Kirchen
In den 50er,60er Jahren waren die Christlich-Demokratische Union und die Kirchen eng verbandelt. Aber spätestens seit der Kritik der Kirchen am Migrationskurs der Merz-CDU liegen Kirche und Union immer öfter über Kreuz. Während Politiker finden, die Kirchen sollten sich raushalten, fragen die sich, für welche Werte das C in der Partei eigentlich steht.
Noch-Verkehrsminister Wissing: „Ich habe die FDP auf den Abgrund zusteuern sehen“
Nach seinem Parteiaustritt hat sich das öffentliche Bild über Volker Wissing komplett gewandelt. Ein Gespräch über seine Abneigung gegen alles Libertäre, Parteipolitik im Ministeramt und warum die neuen Milliardenschulden für die Infrastruktur immer noch nicht reichen.
Junge Erwachsene interessieren sich für politische und soziale Themen wie nie zuvor. Dennoch bleibt der klassische Weg zum politischen Engagement, die parteipolitische Arbeit, für viele junge Menschen uninteressant. Aber woran liegt das? Wie sieht parteipolitische Arbeit überhaupt aus? Und was motiviert diejenigen, die sich trotzdem in Parteien engagieren? Über Herausforderungen und Chancen für den parteipolitischen Nachwuchs sprechen wir in dieser Fußnoten-Folge mit Nachwuchspolitiker:innen von Union und SPD sowie mit Politikwissenschaftlerin Eva Feldmann – Woitjania. Moderation und Skript: Lena Rajewski und Daniel Kuhn Redaktion: Maxim Nägele und Mira Finger Schnitt: Daniel Kuhn Produktion: Mona Wölpert Sendeleitung: Mona Wölpert --------------- Fußnoten ist ein M94.5-Podcast. © M94.5 - ein Angebot der MEDIASCHOOL BAYERN. Lust auf mehr junge & frische Formate?
BSW- und Linke-Politik im Check: Warum ist die Linke plötzlich besser?
Wie führen BSW und Linke Wahlkampf? Warum ist die Linke auf TikTok plötzlich die erfolgreichste Partei? Und wer von beiden hat eine reale Chance auf den Einzug in den Bundestag? Das bespricht Dilan Gropengiesser in der vierten Spezialfolge von Was jetzt? – Die Woche vor der Bundestagswahl mit Lisa Caspari. Es ist noch nicht lange her, da schien die Linke in die viel beschworene politische Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Doch dann das: Die Partei geht in die Offensive – nicht nur im Haustürwahlkampf, sondern auch auf Social Media. Mit Clips zu Parteipolitik, Mitschnitten von Reden und humorvollen Einlagen zeigt sie sich nahbar. Die neuen Bundesvorsitzenden Jan van Aken, Ines Schwerdtner und Shootingstar Heidi Reichinnek setzen einen neuen Ton. Sahra Wagenknecht, die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken, feierte wiederum mit dem BSW einen vielversprechenden Start in der deutschen Politlandschaft. Nach nur einem Jahr ist das BSW bereits Teil der Landesregierungen in Thüringen und Brandenburg. Dennoch verließen in den letzten Monaten einige Mitglieder die Partei, die Umfragewerte sanken unter die Fünf-Prozent-Hürde.
"Wir sollen keine Parteipolitik machen. Auf der anderen Seite wird sich die Kirche natürlich nie aus grundsätzlichen Fragen der Menschenwürde und sozialpolitischen Entscheidungen und auch friedensethischen Entscheidungen heraushalten können" (Mainzer Bischof Peter Kohlgraf).Unsere Mission:K-TV steht zu Tradition und Lehramt der katholischen Kirche. Der Sender möchte die katholische Lehre unverfälscht an die Menschen weitergeben und so die Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens verbreiten. Die Vermittlung von Glaubensinhalten ist zudem ein zentrales Anliegen.Schreiben Sie uns Ihre Anliegen und Fragen per E-Mail an: seelsorge@k-tv.orgHier können Sie K-TV unterstützen: https://www.k-tv.org/spenden Weitere wichtige Kanäle von K-TV: Livestream: https://www.k-tv.org/live-stream/ YouTube: https://www.youtube.com/@KTVKatholischesFernsehen Instagram: https://www.instagram.com/katholisches_fernsehen/Facebook: https://www.facebook.com/K.TV.Fernsehen/ Mediathek: https://www.k-tv.org/mediathek/Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktv.app&hl=de iOS App: https://apps.apple.com/de/app/k-tv-katholisches-fernsehen/id1289140993
Verfassungsschutz-Chef will in die Politik - Steilvorlage für die AfD?
Der Verfassungsschutz soll frühzeitig Angriffe und Gefahren für die deutsche Demokratie erkennen. Doch plötzlich steht die Bundesbehörde ohne Chef da. Thomas Haldenwang stand als Verfassungsschutzpräsident sechs Jahre an der Spitze – jetzt will er aber lieber in die Parteipolitik - kandidiert für den Bundestag und hat damit eine Debatte über die politische Neutralität des Inlandsnachrichtendienstes ausgelöst. In dieser 11KM-Folge erzählt Manuel Bewarder, Investigativreporter von NDR und WDR, was Haldenwangs Schritt für die politische Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes bedeutet und welche Auswirkungen das, für das Einstufungsverfahren der AfD in Sachen Rechtsextremismus, haben kann. Hinweis: Wir haben inzwischen eine korrigierte Podcast-Version hochgeladen. In einer ersten Version erklärte unser Gast fälschlicherweise, der Vater von Thomas Haldenwang sei für die Nationalsozialisten aktiv gewesen. Das trifft auf seinen Vater nicht zu. Wir haben den Fehler korrigiert. Manuel Bewarder, der Gast der 11KM-Folge, entschuldigt sich für den Fehler. Aktuelle Meldungen und Hintergründe zum Bundesverfassungsschutz: https://www.tagesschau.de/thema/verfassungsschutz Hier geht's zu “15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen”, unserem Podcast-Tipp: https://1.ard.de/15Minuten Wie gefällt euch 11KM? Lasst es uns wissen - in unserer Umfrage: https://1.ard.de/11KM_Umfrage Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautoren: Max Stockinger und Marc Hoffmann Mitarbeit: Nicole Ahles Produktion: Viktor Veress, Laura Picerno, Christine Dreyer und Marie-Noelle Svihla Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.
Kanzler Scholz: Parteipolitik am Tag der Einheit – Weltwoche Daily DE
#139 | Sicherheit in Wirtschaft & Politik mit Hans Harrer von Senat der Wirtschaft
In dieser Folge von DER SICHERHEITSPODCAST spricht unser Geschäftsführer, Thomas Urbanek, mit Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender von Senat der Wirtschaft. Hans Harrer ist ein leidenschaftlicher Unternehmer und Innovationstreiber. Der Senat der Wirtschaft ist ein Unternehmensnetzwerk, das sich für Innovation und Leadership einsetzt.Der Senat hat vier Säulen: Ökologie, Gesundheit, Bildung und Wirtschaft. Hans Harrer betont die Bedeutung von Netzwerken und Zusammenarbeit im Unternehmertum. Er spricht auch über die Rolle des Hausverstands und die Notwendigkeit, sich auf Anwenderwissen zu stützen. In diesem Teil des Gesprächs geht es um die Balance zwischen Bauchgefühl und Verstand, die Bedeutung von Hausverstand und Sicherheit für das Gemeinwohl.Es wird diskutiert, wie die Politik heute von Ideologien und Parteipolitik geprägt ist und wie demokratische Grundwerte und Entscheidungen aussehen sollten. Es wird auch die Rolle von Angst in der Führung von Gesellschaften und Unternehmen angesprochen. Weitere Themen sind die Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmen, die Notwendigkeit der Entbürokratisierung und die Bedeutung einer Fehlerkultur. Der Appell an die Gesellschaft lautet, sich gegenseitig zu lieben und gemeinsam eine empowernde Zukunft zu gestalten. Mehr Informationen auf der Website: https://senat.at/ Senat der Wirtschaft auf Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/senat.oesterreich Instagram: https://www.instagram.com/senat.at/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/senat-at/ YouTube: https://www.youtube.com/@senatderwirtschaftosterrei4765 TikTok: https://www.tiktok.com/@senat.at X (Twitter): https://x.com/DerSenat Spotify: https://open.spotify.com/show/0FcG7ZRSJVhtBC3NZEl80B Hans Harrer auf Social Media: LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-harrer-960163187/ TAURUS Sicherheitstechnik auf Social MediaWebsite: https://www.taurus-sicherheitstechnik.at/Facebook: https://www.facebook.com/taurussicherheitstechnikInstagram: https://www.instagram.com/taurus_sicherheitstechnikLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42142129/admin/dashboard/YouTube: https://www.youtube.com/@TAURUSSicherheitstechnikGmbHTikTok: https://www.tiktok.com/@taurus_sicherheitX (Twitter): https://x.com/TAURUSicherheitSpotify: https://open.spotify.com/show/0bBqe0Y3RihOrCyg4saXlu?si=d84842767bee4eae&nd=1&dlsi=d8e327e4dccc4913
Aufstieg der AfD - Warum sich Unternehmen gegen rechts positionieren
Unternehmen halten sich aus Parteipolitik meist raus. Mit dem Aufstieg der AfD änderte sich das. Deren Forderung nach einem Ausstieg Deutschlands aus der EU birgt eine ernste Gefahr. Denn viele mittelständische Unternehmen agieren längst global. Betz, Klaus www.deutschlandfunkkultur.de, Zeitfragen. Feature
Ein Standpunkt von Jochen Mitschka.Viele Menschen werden sich fragen, warum Israel in Gaza einen Völkermord durchführt, und in der Westbank immer intensiver eine ethnische Säuberung, ohne dass die Gesellschaft als Ganzes gegen die rechtsextremistische Regierung auf die Barrikaden geht. Die Demonstrationen, die man in Israel sah, waren nicht gegen die Palästina-Politik, sondern gegen die Innenpolitik gerichtet gewesen, durch welche die Regierung die letzten Reste von Gewaltenteilung beseitigen will, bzw. gegen die Geiselpolitik. Tatsächlich ist die Antwort leider einfach. Die Politik und ihre Haltung zum Palästina-Konflikt ist ein Spiegel der zionistischen Gesellschaft. Abby Martin hatte in einer Dokumentation schon vor Jahren darauf hingewiesen (1). Auch David Sheen hatte gewarnt. Er hielt am 28. November 2018 an der Universität Charles in Prag, Tschechische Republik, eine Vorlesung mit dem Thema »Israels Parlament verstehen« (2). Darin erklärt er schon vor 6 Jahren die Entwicklung der Gesellschaft und auch der politischen Parteien und wie es zu der Befürwortung eines rechtsextremen Apartheidsystems kam. Hier ein Transkript der übersetzten Vorlesung:„Vielen Dank für Ihr Kommen, und für das Interesse an dem Ort der Welt, von dem ich komme. Ich möchte, dass sie bekannt werden, damit Sie es besser verstehen. Es ist nicht einfach, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen sprechen wir über Parteipolitik in der dutzende von Parteien im Wettbewerb bei Parlamentswahlen in Israel stehen. Von denen eine zweistellige Anzahl dann ins Parlament einzieht. Zehn oder mehr Parteien sitzen in der Knesset.Wie soll jemand, der von außerhalb kommt, und die Sprache nicht versteht, wie soll der verstehen, was tatsächlich vorgeht? Deshalb will ich es für sie erklären. Eine Art, wie wir die Parteipolitik verstehen können, ist, indem wir die Parteien aufteilen in die Kategorien: Liberale Parteien, nationalistische Parteien, religiöse Parteien. Das sind die Parteien, die mehr oder weniger die jüdischen Bürger repräsentieren. Aber natürlich gibt es auch palästinensische Bürger Israels. zwanzig bis 25 Prozent der Bevölkerung. Und auch bei denen könne wir eine gleiche Einteilung vornehmen, in Liberale, Nationalisten, Religiöse...... hier weiterlesen: https://apolut.net/warum-tut-israel-das-von-jochen-mitschka+++Bildquelle: Elyasaf Jehuda/ shutterstock+++Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer „digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoinzahlungInformationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/+++Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.+++Apolut ist auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommen Sie zu den Stores von Apple, Google und Huawei. Hier der Link: https://apolut.net/app/Die apolut-App steht auch zum Download (als sogenannte Standalone- oder APK-App) auf unserer Homepage zur Verfügung. Mit diesem Link können Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen: https://apolut.net/apolut_app.apk Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Josephine Erkens, oder: Wie man(n) eine weibliche Führungskraft zu Fall bringt
Heute tauchen wir zum zweiten Mal in die Welt der “Weiblichen Kriminalpolizei” ein. Diesmal befinden wir uns im Hamburg der Weimarer Republik, wo Kriminalpolizeirätin Josephine Erkens nicht nur mit Gegenwind durch männliche Vorgesetzte konfrontiert ist, sondern auch noch andere Konflikte auszutragen hat. Wozu das führte, vor welchen Schwierigkeiten und Dilemmata die Polizistinnen standen und was Parteipolitik damit zu tun hatte - das beleuchten wir gemeinsam in der neuesten Folge der “Frauen von damals.” Quellen, Literatur und Tipps zum Weiterlesen: Ursula Nienhaus: "Nicht für eine Führungsposition geeignet": Josefine Erkens und die Anfänge weiblicher Polizei in Deutschland 1923 - 1933, Münster 1999. Digitalisate der Vossischen Zeitung bei der Staatsbibliothek Berlin (über DFG-Viewer) “Zwei Polizistinnen erschießen sich”, Abendausgabe 10. Juli 1931. “Der Tod der Polizeibeamtinnen”, Morgenausgabe 11. Juli 1931. “Hintergründe der Hamburger Tragödie”, Morgenausgabe 12. Juli 1931. “Das Verfahren gegen Frau Erkens”, Morgenausgabe 13. Juli 1931 (Man bemerke die vergleichsweise versteckte Notiz, in der entlastendes Material zu Erkens nachgereicht wird). “Kein Disziplinarverfahren gegen Frau Erkens”, Abendausgabe 16. Juli 1931. Robert Brack: Und das Meer gab seine Toten wieder. Roman, Hamburg 2008. (Ich gebe zu, historische Romane mit erfundenen Hauptfiguren, die endlich mal aufräumen, sprechen mich generell nicht an, weil für mich da immer die Gefahr der Selbstgefälligkeit gegenüber historischen Personen gegeben ist. Die Hauptfigur “weiß” es ja meistens besser, aber sie ist nun mal auch mit dem Wissen der heutigen Zeit konstruiert. Gleichwohl hat der Roman gute Kritiken und ist, soweit ich das beurteilen kann, hervorragend recherchiert. Zu Bracks Interpretationen der Fakten kann ich nichts sagen, weil siehe oben. ;)) Robert Brack: Sprechende Dokumente. Nachforschungen im Staatsarchiv während der Arbeit an dem Roman „Und das Meer gab seine Toten wieder”, in: Aus erster Quelle. Beiträge zum 300-jährigen Jubiläum des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 2013, S. 191-200. Karin Hausen: Die Polarisierung der ‚Geschlechtscharaktere‘ – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, S. 363-393. Das Angebot der Frauen von damals ist gratis und werbefrei. Wenn es euch in den Fingern juckt, etwas in die Kaffeekasse zu werfen - hier steht ein Sparschweinchen. Vielen Dank!
Basta Berlin (231) – Independence Day
Wir feiern heute unseren Unabhängigkeitstag: Wir folgen weder manipulativen Massenmedien, noch der penetranten Parteipolitik! Die Regierung handelt streng nach dem Motto: Alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Der Schaden für die Demokratie ist enorm… Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, rasieren heute das halbe Bundeskabinett: Scholz, Habeck, Baerbock oder Lauterbach, sie alle haben Dreck am Stecken. Und auch die Machenschaften von Ursula von der Leyen oder Christian Drosten werden heute ins Licht der Öffentlichkeit gezogen. Denn wir sind die Freunde der Demokratie…
U-Ausschuss - Union will Atomausstieg aufarbeiten
Seit 2023 sind alle deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Ob sie länger hätten laufen können, will die Union jetzt aufarbeiten: Sie unterstellt den Grünen, Parteipolitik gemacht zu haben. Die Umstände soll ein Untersuchungsausschuss aufklären. Finthammer, Volker www.deutschlandfunk.de, Informationen am Morgen
Mit Albert Rösti, Vorsteher Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, SVP
Bundesrat Albert Rösti muss Megaprojekte voranbringen: Wie will er die Stromversorgung sichern? Und wie mit der Atomenergie umgehen? Im «Rundschau Talk» erklärt der Energieminister, wie es mit der Strom-Schweiz weitergeht – und wie mit der Wolfsjagd und dem Schienennetz. Albert Rösti balanciert zwischen Parteipolitik und Bundesratsamt. Seit Monaten weibelt er für das neue Stromversorgungsgesetz – gegen grosse Teile seiner SVP. Rösti verspricht mehr Unabhängigkeit vom Ausland und mehr Sicherheit bei der Versorgung. Das Mittel: Erneuerbare Energie. Nach der Abstimmung vom 9. Juni 2024 fragt «Rundschau Talk» nach, wie Röstis Baupläne für Wind-, Solar- und Wasserkraft aussehen. Neue AKW für die Schweiz? Die Debatte um die Atomkraft flammt gerade wieder auf. Braucht die Schweiz neue AKW, wie es die Blackout-Initiative indirekt verlangt? Und wie lange sollen die bestehenden Meiler am Netz bleiben? Von Rösti braucht es klare Ansagen. Wie viel wilde Tiere in der Schweiz? Als Umweltminister hat Albert Rösti dem Wolf den Kampf angesagt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit leitete er den Abschuss von potenziell gefährlichen Tieren an. Doch Umweltverbände und Gerichte stoppten den Abschuss bald weitgehend. Alles nur ein Schlag ins Wasser, Herr Rösti? Und wie weiter mit dem Biber, der auch bereits zur Debatte steht? Schiene und Strasse: Verschleppter Ausbau? Unmut hüben und drüben, wenn es um den Ausbau der Bahn- und Strasseninfrastruktur geht. Die Westschweiz lamentiert, sie werde übergangen beim Schienenausbau, die Ostschweiz ebenso. Und linke Verbände und Parteien bekämpfen den Autobahnausbau. Gehts vorwärts beim Verkehr, Herr Rösti?
69. Special - Servant Politics im Gespräch Anissa Saysay (CDU-Parteivorsitzende Dormagen, Stadträtin)
Zur Person: Politikwissenschaftlerin M.A., CDU-Parteivorsitzende Dormagen, Stadträtin & Koordinatorin für die Landespolitik bei der IHK Köln Einige Gedanken-Funken aus dem Podcast-Gespräch: - Vertrauen in die Politik - Gutes Miteinander & sozialer Frieden - Politik, die sich ehrlich macht - MUT -> auch, um als Quereinsteiger in die Politik zu gehen - MUT -> auch zu weniger Parteipolitik - MUT -> auch, um andere Meinung auszuhalten - Gemeinsam Wachsen - Macht-Streben - ALT & NEU -> verändern & gestalten - Dialog & zu-HÖREN
Warum sollten Katholiken nicht die AfD wählen, Bischof Bätzing?
Die katholische Kirche in Deutschland befindet in der Krise. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz verweist auf Reformen und appelliert an die Ökumene. Zudem mischen sich die Bischöfe in die Parteipolitik ein und warnen vor der Wahl der AfD. Das Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, hat SWR-Religionsredakteur Ulrich Pick geführt.
Warum sollten Katholiken nicht die AfD wählen, Bischof Bätzing?
Die katholische Kirche in Deutschland befindet in der Krise. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz verweist auf Reformen und appelliert an die Ökumene. Zudem mischen sich die Bischöfe in die Parteipolitik ein und warnen vor der Wahl der AfD. Das Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, hat SWR-Religionsredakteur Ulrich Pick geführt.
Philip Rathgeb: DIE RADIKALE RECHTE UND DER SOZIALSTAAT
Robert Misik im Gespräch mit Philip Rathgeb DIE RADIKALE RECHTE UND DER SOZIALSTAAT Rechtsradikale Parteien sind nicht länger politische Herausforderer am Rande der Parteiensysteme; sie sind in der gesamten westlichen Welt Teil des politischen Mainstreams geworden. Die radikale Rechte hat die verschiedenen politischen Instrumente genutzt, die ihr im Rahmen ihrer politisch-ökonomischen Arrangements zur Verfügung stehen, um bedrohte Arbeitsmarktinsider und männliche Ernährer vor dem Niedergang zu schützen und gleichzeitig ein rassifiziertes und geschlechtsspezifisches Prekariat zu schaffen. Diese sozioökonomische Agenda des selektiven Statusschutzes stellt die horizontalen Ungleichheiten in Bezug auf Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit wieder her, ohne die vertikalen Ungleichheiten zwischen Arm und Reich anzugehen.Durch die Kombination von Erkenntnissen aus der vergleichenden Politikwissenschaft, der Parteipolitik, der vergleichenden politischen Ökonomie und der Wohlfahrtsstaatsforschung bietet das aktuelle Buch des Politologen Philip Rathgeb neue Einblicke in die Art und Weise, wie die radikale Rechte die Zustimmung zu autoritärer Herrschaft herstellt, indem sie die sozial zersetzenden Auswirkungen des globalisierten Kapitalismus für wichtige Wählergruppen zähmt. Philip Rathgeb, PolitikwissenschaftlerRobert Misik, Autor und JournalistPhilip Rathgeb, ist Assistenzprofessor für Sozialpolitik an der School of Social and Political Science an der Universität von Edinburgh. Zuvor war er als Postdoktorand am Fachbereich Politik und Öffentliche Verwaltung der Universität Konstanz tätig. Seine Forschungsinteressen liegen in der vergleichenden politischen Ökonomie und der vergleichenden Politik, mit besonderem Augenmerk auf Wohlfahrtsstaaten, Arbeitsbeziehungen und Parteipolitik. Sein erstes Buch Strong Governments, Precarious Workers wurde 2018 bei Cornell University Press veröffentlicht. Träger des Kurt Rothschild-Preises für Wirtschaftspolitik.
"Breaking News" - der Bruch von Rot-Grün im Rat. Wie es jetzt weitergeht, erklärt der HAZ-Podcast
Bloß keinen Stillstand in Hannovers Ratspolitik! Das fordern sowohl die Grünen als auch die SPD nach deren Ausstieg aus dem bisherigen Mehrheitsbündnis im Rat (und die feixende bisherige Opposition von CDU und FDP sowieso). Ist das Floskel, frommer Wunsch - oder doch ein Ruf, der gehört wird? Hannover wird künftig von wechselnden Mehrheiten regiert. Und die "autoarme Innenstadt" von OB Belit Onay gerät dabei wahrscheinlich unter die Räder. Weil am Ende doch Parteipolitik und das Schielen auf die nächste Wahl wichtiger sind als die Sache? Moderator Felix Harbart und die beiden Reporter Andreas Schinkel und Conrad von Meding analysieren den Stand der Dinge, buchstabieren aus, was keiner sagt, und projizieren, wie es nun in Hannovers Ratspolitik und mit den wichtigsten Themen der Stadt weitergehen kann.
Migrationsdebatte - Deutschlandpakt oder Parteipolitik?
Migrationsdebatte - Deutschlandpakt oder Parteipolitik? / "Vaters Meer" - Deniz Utlu gewinnt Bayerischen Buchpreis / Geschichten vom Anderssein: Das Buch "Migrantenmutti" von Elina Penner / Grenzenlose Vielfalt - Die Kulturtipps der Woche / "Good Vibes Only" - Das neue Album des deutsch-namibischen Musikers EES. Moderation: Constanze Alvarez
Seit CDU-Chef Merz sich unklar über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene ausgedrückt hat, diskutiert Deutschland über Parteipolitik in den Kommunen. Was in den Städten und Gemeinden anders ist als in Bund oder Land, erklärt Matthias Kamann aus der Welt-Redaktion. "Kick-off" ist der Nachrichten-Podcast von WELT. Wir freuen uns über Feedback an kickoff@welt.de. Hörtipp: Die wichtigsten News an den Märkten und das Finanzthema des Tages hören Sie morgens ab 5 Uhr bei „Alles auf Aktien" - dem täglichen Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Mehr auf welt.de/allesaufaktien Impressum: https://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html Datenschutz: https://www.welt.de/services/article157550705/Datenschutzerklaerung-WELT-DIGITAL.html
„Wir müssen wieder mehr miteinander statt übereinander reden“ sagt Stefanie Seiler, junge Oberbürgermeisterin von Speyer. Im Podcast diskutieren wir die Auswirkungen auf die Kommunalpolitik nach der Wahl eines AfD-Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt, die Rolle der Parteien und das Gefühl des "Nicht-Gehört-Werdens" vieler Bürger. In Speyer gibt es einige Initiativen zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts wie Bürgerempfang, Speyerer Abendbummel oder einen Innenstadtrundgang. Zudem erfahren wir, was die „Stabstelle für strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen“ macht.
Die Ampelkoalition tut sich immer wieder schwer, Konsens zu finden. Zuspruch für die AfD steigt. "Der AfD hilft, dass es unübersichtlich ist", sagt Thomas Krüger, Bundeszentrale für politische Bildung. Es bräuchte mehr klare Kommunikation nach außen. Von WDR 5.
Chaos in der Berliner Radverkehrspolitik und Tour Transalp
Wir sprechen mit Ragnhild Sørensen von Changing Cities über das Chaos in der Berliner Verkehrspolitik unter dem neuen schwarz-roten Senat, und Christian und Gregor berichten von der Tour Transalp. Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/antritt (00:00:00) Begrüßung zum Johannisbeermonat (00:00:48) Gerolf auf der Eurobike in Frankfurt (00:11:45) Gespräch: Ragnhild Sørensen über Verkehrspolitk in Berlin (00:17:13) Was bedeutet der Finanzierungsstopp? (00:20:21) Handelt der Senat widersprüchlich? (00:26:30) Welche Rolle spielen Populismus und Parteipolitik? (00:31:13) Wie reagiert Changing Cities und was bringt die Zukunft? (00:41:42) Christians und Gregors Erfahrungen bei der Tour Transalp (00:45:49) Wie war der Tourbeginn? (00:51:45) Welche Fahrertypen sind Christian und Gregor? (00:58:28) Wer fährt bei der Tour Transalp mit? (01:02:08) Christians kulinarische Kritik (01:03:48) Was verbindet Gregor und Christian beim Radfahren? (01:07:55) Vearbschiedung und Ausblick auf die nächste Folge (01:12:49) Florida Juicy x Verifiziert x Longus Mongus – Rotkäppchen (01:15:32) Transalp Tagebuch Tag 1 – Noch sind beide fit (01:21:31) Tag 2 – die erste Etappe (01:31:56) Tag 3 – Die vier Dolomitenpässe und gute Pasta! (01:39:45) Tag 4 – Monte Grappa und Prosecco (01:47:24) Tag 5 – Die längste Etappe und verlorene Koffer (01:56:04) Tag 6 – Rallyefahrer auf dem Manghenpass (02:07:44) Tag 7 – 20 Prozent Steigung bei Trient (02:23:21) Tag 8 – Tour Recap >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/gesellschaft/antritt-chaos-in-berliner-radverkehrspolitik-mit-dem-rennrad-bei-der-tour-transalp
Antritt | Chaos in der Berliner Radverkehrspolitik und Tour Transalp
Wir sprechen mit Ragnhild Sørensen von Changing Cities über das Chaos in der Berliner Verkehrspolitik unter dem neuen schwarz-roten Senat, und Christian und Gregor berichten von der Tour Transalp. Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/antritt (00:00:00) Begrüßung zum Johannisbeermonat (00:00:48) Gerolf auf der Eurobike in Frankfurt (00:11:45) Gespräch: Ragnhild Sørensen über Verkehrspolitk in Berlin (00:17:13) Was bedeutet der Finanzierungsstopp? (00:20:21) Handelt der Senat widersprüchlich? (00:26:30) Welche Rolle spielen Populismus und Parteipolitik? (00:31:13) Wie reagiert Changing Cities und was bringt die Zukunft? (00:41:42) Christians und Gregors Erfahrungen bei der Tour Transalp (00:45:49) Wie war der Tourbeginn? (00:51:45) Welche Fahrertypen sind Christian und Gregor? (00:58:28) Wer fährt bei der Tour Transalp mit? (01:02:08) Christians kulinarische Kritik (01:03:48) Was verbindet Gregor und Christian beim Radfahren? (01:07:55) Vearbschiedung und Ausblick auf die nächste Folge (01:12:49) Florida Juicy x Verifiziert x Longus Mongus – Rotkäppchen (01:15:32) Transalp Tagebuch Tag 1 – Noch sind beide fit (01:21:31) Tag 2 – die erste Etappe (01:31:56) Tag 3 – Die vier Dolomitenpässe und gute Pasta! (01:39:45) Tag 4 – Monte Grappa und Prosecco (01:47:24) Tag 5 – Die längste Etappe und verlorene Koffer (01:56:04) Tag 6 – Rallyefahrer auf dem Manghenpass (02:07:44) Tag 7 – 20 Prozent Steigung bei Trient (02:23:21) Tag 8 – Tour Recap >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/gesellschaft/antritt-chaos-in-berliner-radverkehrspolitik-mit-dem-rennrad-bei-der-tour-transalp
Chaos in der Berliner Radverkehrspolitik und Tour Transalp
Wir sprechen mit Ragnhild Sørensen von Changing Cities über das Chaos in der Berliner Verkehrspolitik unter dem neuen schwarz-roten Senat, und Christian und Gregor berichten von der Tour Transalp. Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/antritt (00:00:00) Begrüßung zum Johannisbeermonat (00:00:48) Gerolf auf der Eurobike in Frankfurt (00:11:45) Gespräch: Ragnhild Sørensen über Verkehrspolitk in Berlin (00:17:13) Was bedeutet der Finanzierungsstopp? (00:20:21) Handelt der Senat widersprüchlich? (00:26:30) Welche Rolle spielen Populismus und Parteipolitik? (00:31:13) Wie reagiert Changing Cities und was bringt die Zukunft? (00:41:42) Christians und Gregors Erfahrungen bei der Tour Transalp (00:45:49) Wie war der Tourbeginn? (00:51:45) Welche Fahrertypen sind Christian und Gregor? (00:58:28) Wer fährt bei der Tour Transalp mit? (01:02:08) Christians kulinarische Kritik (01:03:48) Was verbindet Gregor und Christian beim Radfahren? (01:07:55) Vearbschiedung und Ausblick auf die nächste Folge (01:12:49) Florida Juicy x Verifiziert x Longus Mongus – Rotkäppchen (01:15:32) Transalp Tagebuch Tag 1 – Noch sind beide fit (01:21:31) Tag 2 – die erste Etappe (01:31:56) Tag 3 – Die vier Dolomitenpässe und gute Pasta! (01:39:45) Tag 4 – Monte Grappa und Prosecco (01:47:24) Tag 5 – Die längste Etappe und verlorene Koffer (01:56:04) Tag 6 – Rallyefahrer auf dem Manghenpass (02:07:44) Tag 7 – 20 Prozent Steigung bei Trient (02:23:21) Tag 8 – Tour Recap >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/gesellschaft/antritt-chaos-in-berliner-radverkehrspolitik-mit-dem-rennrad-bei-der-tour-transalp
Bootsunglücke, Dürre in Europa und Kritik am Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk
Die News wurden diese Woche vom U-Boot dominiert, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic vermutlich implodiert ist. Fast zeitgleich ist vor der griechischen Küste ein Boot mit Hunderten Geflüchteten gesunken. Wir sprechen über die ungleiche Behandlung der beiden Unglücke. Außerdem geht's um Dürre in Europa. Es hat in Deutschland seit Wochen nicht genug geregnet. Das ist nicht einfach nur Wetter, sondern auch ein riesen Problem. Wir fragen einen Hydrologen, was das für Folgen haben könnte und was wir dagegen tun können. Und wir sprechen mal wieder über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Unser Politik-Format DIE DA OBEN! hat sich nämlich einen neuen, besseren und cooleren ÖRR ausgedacht und wir gehen durch, wie der so aussehen könnte. - Google Suchanfragen (00:02:26) - Verunglücktes U-Boot Titan (00:04:25) - Bootsunglück in Griechenland (00:12:04) - Claudia Pechsteins Rede + Richtungsstreit in der CDU (00:16:26) - Dürre in Europa (00:23:49) Gespräch mit Hydrologe Prof. Fred Hattermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Kayla Shyx neues Video über sexualisierte Gewalt (00:37:50) - Intel Mikrochip-Fabrik in Magdeburg (00:40:15) - Der perfekte öffentlich-rechtliche Rundfunk (00:42:42) Gespräch mit Linda Friese von DIE DA OBEN! hier geht's zum ganzen Video: https://www.youtube.com/watch?v=SvCSZGX7a4c - Kurzkurznews (00:57:20) - Feedback und Fragen könnt ihr uns immer per DM auf Insta schicken: https://www.instagram.com/funk/
Bootsunglücke, Dürre in Europa und Kritik am Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk
Die News wurden diese Woche vom U-Boot dominiert, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic vermutlich implodiert ist. Fast zeitgleich ist vor der griechischen Küste ein Boot mit Hunderten Geflüchteten gesunken. Wir sprechen über die ungleiche Behandlung der beiden Unglücke. Außerdem geht's um Dürre in Europa. Es hat in Deutschland seit Wochen nicht genug geregnet. Das ist nicht einfach nur Wetter, sondern auch ein riesen Problem. Wir fragen einen Hydrologen, was das für Folgen haben könnte und was wir dagegen tun können. Und wir sprechen mal wieder über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Unser Politik-Format DIE DA OBEN! hat sich nämlich einen neuen, besseren und cooleren ÖRR ausgedacht und wir gehen durch, wie der so aussehen könnte. - Google Suchanfragen (00:02:26) - Verunglücktes U-Boot Titan (00:04:25) - Bootsunglück in Griechenland (00:12:04) - Claudia Pechsteins Rede + Richtungsstreit in der CDU (00:16:26) - Dürre in Europa (00:23:49) Gespräch mit Hydrologe Prof. Fred Hattermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Kayla Shyx neues Video über sexualisierte Gewalt (00:37:50) - Intel Mikrochip-Fabrik in Magdeburg (00:40:15) - Der perfekte öffentlich-rechtliche Rundfunk (00:42:42) Gespräch mit Linda Friese von DIE DA OBEN! hier geht's zum ganzen Video: https://www.youtube.com/watch?v=SvCSZGX7a4c - Kurzkurznews (00:57:20) - Feedback und Fragen könnt ihr uns immer per DM auf Insta schicken: https://www.instagram.com/funk/
Claudia Pechstein ist vielen als Eisschnellläuferin bekannt. Dass sie aber auch bei der Bundespolizei arbeitet, wissen viele möglicherweise erst seit diesem Wochenende, denn da sprach sie in Uniform auf einem Parteitag der CDU. Seitdem gibt es viel Kritik. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler hält ihren Auftritt nicht für unzulässig, merkt aber an, dass sie damit Parteipolitik macht.
***Seht uns live am 8. Juli beim Schmidt-Podcastfestival in Hamburg! Tickets und Infos findet ihr hier***Der Marathon geht in die dritte Stunde! Zum Glück haben wir weiterhin Unterstützung von unserem wunderbaren Überraschungsgast. Freut euch auf eine neue Episode von "Matilde liest Speisekarten vor"! Außerdem reden wir über Körperbilder, Parteipolitik, fragwürdigen Sexualkundeunterricht, und beantworten weiterhin eure Fragen.Unterstützt uns auf Patreon und erhaltet jeden Monat exklusiven Content!Ihr könnt uns auch über PayPal unterstützen.Vielen Dank, du schönes, lebensbejahendes Biest!Folgt uns auf Twitter und Instagram: @schamlos_pod oder schreibt uns per Mail: schamlospodcast (at) gmail.comJanina Rook, Matilde Keizer und Antonia Bär könnt ihr hier finden:Instagram: @rook_togo, @antonialisabaer, @matikeizerTwitter: @antonialisabaer, @matildekeizerBonus-Folgen auf Patreon! Bonus-Folgen auf Patreon! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Wer davon nicht reden will, schafft es ab (©Armin Thurnher) Für den ORF wird 2023 zu einem Schicksalsjahr: Zum einen muss, nach einem Urteil des Verfassungsgerichts, seine Finanzierung neu geregelt werden – die bisherige GIS-Gebühr muss entweder ausgeweitet oder durch eine Abgabe für alle Haushalte ersetzt werden. Oder er wird künftig aus dem Bundesbudget finanziert – jährliche Verhandlungen mit der Regierung zwecks Absicherung des Wohlverhaltens inklusive. Außerdem sollen dem öffentlich-rechtlichen Medium durch eine Digitalisierungsnovelle ein paar jener Steine aus dem Weg geräumt werden, die ihm dank des Lobbyings der Zeitungsverlage dorthin gelegt wurden – etwa dass man Sendungen nur sieben Tage lang nachhören bzw. nachsehen kann. In der Zeit der Corona-Pandemie wurde der ORF verstärkt als „Staatsfunk“ wahrgenommen. Auch dass er durch Parteipolitik bestimmt werde, aufgeblasene Strukturen habe und nicht wirtschaften könne, hieß und heißt es immer wieder. Die neue Hörfunkdirektorin Ingrid Thurnher hat Sparmaßnahmen für Ö1 angekündigt und die Absicht, aus FM4 eine Art „Ö3 für Junge“ zu machen. Parallel dazu haben gleich zwei Chefredakteure des ORF wegen ihrer Willfährigkeit gegenüber ÖVP und FPÖ zumindest kurzzeitig ein wenig zur Seite treten müssen. Und die grüne Mediensprecherin hat überraschenderweise ihre Sympathie für die Finanzierung des ORF aus dem staatlichen Budget erkennen lassen. Wie sieht in diesem Umfeld die Zukunft des ORF aus? Welche Rolle soll er gegenüber den kommerzialisierten Privatsendern einnehmen? Und sind umfassende ORF-Gebühren für Alle zumutbar? Darüber spricht Wolfgang Maderthaner mit dem Journalisten und Historiker Peter Lachnit. Lachnit war ab 1984 im genossenschaftlich organisierten „Verlag für Gesellschaftskritik“ aktiv und seit 1997 beim Radioprogramm Ö1. Dort war er Redaktionssprecher und leitete von 2012 bis 2017 die Sendereihe „Diagonal – Radio für Zeitgenoss:innen“. Den „Radiopreis der Erwachsenenbildung“ hat er dreimal erhalten, 2016 den Dr. Karl Renner-Publizistikpreis. In „Kreiskys Wohnzimmer“ erläutert er, warum er keinen Widerspruch darin sieht, in den 1980ern bei der Gründung der „ARGE österreichischer Privatverlage“ dabei gewesen zu sein und heute für eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzutreten.
Nach 16 Jahren in der Regierung falle es der Union schwer, sich neu aufzustellen, sagt Politologe Karl-Rudolf Korte. Auf Bundestagsebene spiele Merz als CDU-Parteichef, der im Angriffsmodus die Regierung vorführe, aber die Rolle seines Lebens. Von WDR 5.
Zwei von sieben gehen. Und damit die Erfahrung und das Wissen aus über zwanzig Jahren im Amt. Welche Persönlichkeiten braucht es jetzt im Bundesrat? Wie viel Rochade bei den Departementen verträgt es, ohne die Funktion des Gremiums zu gefährden? Fragen an den Politikwissenschaftler Adrian Vatter. Mit der gestrigen Ankündigung des Rücktritts von Bundesrätin Simonetta Sommaruga verliert der Bundesrat auf Ende Jahr zusammen mit Bundesrat Ueli Maurer Erfahrungen und Kenntnisse aus über 20 Amtsjahren. Dies ist umso einschneidender, weil der Bundesrat nach der Corona-Krise nun auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges meistern muss. Was bedeuten diese Rücktritte für die Stabilität des Gremiums? Welche Persönlichkeiten braucht der Bundesrat nun? Und welche Rolle spielt die Parteipolitik bei der Führung der Departemente? Adrian Vatter, Professor für Schweizer Politik und Direktor des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Bern, ist ein profunder Kenner des Bundesrates und Verfasser des Standardwerks «Der Bundesrat». Im Tagesgespräch bei Karoline Arn erklärt er auch, weswegen der Bundesrat ein Kandidat für das Guiness-Buch der Rekorde ist.
Nachdem Hurrikan Ian über Florida hinweggezogen war und katastrophale Schäden angerichtet hatte, traten Floridas Gouverneur Ron DeSantis und US-Präsident Joe Biden gemeinsam auf. Beim Krisenmanagement ist kein Platz für Parteipolitik. Der Republikaner DeSantis lobte also die gute gemeinsame Teamarbeit zwischen seinem Bundesstaat und dem Weißen Haus. Es sind Höflichkeiten, die sich DeSantis ansonsten eher spart. Der 44-Jährige ist der neue Star der US-amerikanischen Rechten. Nicht wenige sehen in ihm – und nicht in Ex-Präsident Donald Trump – die Zukunft in ihrem Versuch, die Republikanische Partei dauerhaft weiter nach rechts zu rücken. DeSantis hat es in den vergangenen Monaten geschickt geschafft, sich von Trump zu distanzieren und gleichzeitig seine politische Strategie zu übernehmen. In Florida macht er mit identitätspolitischen Themen Politik, er schickt Migranten mit Flugzeugen nach Martha's Vineyard, legt sich mit Disney an und hat für seinen Bundesstaat eine ganz eigene Corona-Politik betrieben. Wie DeSantis der Aufstieg gelang, wie gefährlich er Donald Trump werden könnte und wie sehr ihn die Demokraten fürchten müssen, diskutieren wir im US-Podcast. Außerdem sprechen wir über Joe Bidens Reaktion auf die aktuellen Luftangriffe Russlands in der Ukraine und seine Aussage, dass die nukleare Gefahr so groß sei wie seit der Kubakrise 1962 nicht mehr. Im "Get-out": der Film "The Woman King" mit Viola Davis und die Serie "House of the Dragon". Der Podcast erscheint alle zwei Wochen donnerstags, die nächste Folge am 27. Oktober. Sie erreichen uns per Mail an okamerica@zeit.de.
Der Höhenflug der Grünen in der Regierung scheint vorbei zu sein. Das liegt aber nicht daran, dass sie zu ideologisch sind und zu wenig Realpolitik machen. Leseempfehlung: [Das sind Deutschlands größte Energiesünder](https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100061858/steigende-gaspreise-diese-personen-sollten-besonders-sparen.html) Den Tagesanbruch gibt es auch zum Nachlesen unter https://www.t-online.de/tagesanbruch **Den "Tagesanbruch"-Podcast gibt es immer Montag bis Freitag gegen 6 Uhr zum Start in den Tag. Die Wochenend-Ausgabe mit einer längeren Diskussionsrunde ist freitags ab 16 Uhr verfügbar.** Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie uns bei [Apple Podcasts](https://itunes.apple.com/de/podcast/t-online-tagesanbruch/id1374882499?mt=2), [Google Podcasts](https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90YWdlc2FuYnJ1Y2gucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw?ep=14) oder [Spotify] (https://open.spotify.com/show/3v1HFmv3V3Zvp1R4BT3jlO?si=klrETGehSj2OZQ_dmB5Q9g). Unseren YouTube Channel mit allen Tagesanbruch Folgen [können Sie hier abonnieren](https://www.youtube.com/channel/UCCjde5pZkCzVXIjodNXu-WA). Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gern eine Bewertung da. Anmerkungen, Lob und Kritik an podcasts@t-online.de Produziert vom Podcast-Radio detektor.fm
Müssen wir diesen Winter frieren?
Werden wir diesen Winter die Heizung runter drehen müssen? Wird der Strom knapp? Diese Fragen klingen aktuell realistischer als in anderen Jahren. Auf jeden Fall aus Sicht vieler Schweizerinnen und Schweizer – Solarpanels für den eigenen Balkon, elektrische Heizöfen und Brennholz werden gerade in grossen Mengen gekauft.In einer zweiteilige Folge des Podcasts «Apropos» widmet sich der Energiekrise. In der ersten Folge ging es darum, wie es so weit kommen konnte und welche Rolle die Schweizer Energiepolitik dabei spielt. In einer zweiten Folge erklärt Wirtschaftsredaktor Philipp Felber-Eisele welche Szenarien nun realistisch sind – und was politisch geschehen muss, um eine Mangellage abzuwenden. Gastgeber ist Philipp Loser. Mehr zum Thema: Alles zur Energiekrise: https://www.tagesanzeiger.ch/tags/69439/energiekrise
#96 Servant Politics im Gespräch mit Christiane von Beuningen (Moderatorin & Sprecherin)
"Warum bin ich in die Politik gegangen? Was wollte ich verändern? Was können wir verändern? "Made in Germany war einmal irgendwie etwas wert." "Warum platzt der Bundestag gerade aus allen Nähten?" Einige Highlights aus dem Podcast: - Ego, Macht, Parteipolitik, Wählerstimmen in der Politik => Marketingausrichtung der Politik - Fusball-WM der Frauen - Fleiß-Bienchen in der Politik - Lebensbezug in der Schule => damit das System verstanden wird - Chancengleichheit und zeitgemäßes LERNEN - Verantwortungsvolle Umgehen miteinander (auch und gerade im Internet) - Mit Mindset ins Erwachsenen-Alter starten ... in der Gesellschaft einen Beitrag leisten. - Aufsichtsräte & Politik => Neutralität? - Vetternwirtschaft
Kein neues Theater in Ingolstadt - "Angriff auf die Kultur"
In Ingolstadt wurde der Bau eines neuen Theaters in letzter Sekunde durch ein Bürgerbegehren verhindert. Intendant Knut Weber sieht Parteipolitik und Populismus am Werk und empfindet den Entscheid als „Angriff auf die Kultur“.Knut Weber im Gespräch mit Janis El-Birawww.deutschlandfunkkultur.de, Rang 1Direkter Link zur Audiodatei
Grünen-Politikerin Franziska Brantner zum Abschalten von „Nordstream 1“ – „Putin führt einen ökonomischen Krieg“
Die Bundesregierung war vorbereitet auf das Abdrehen des Gashahns durch Russland. Angesichts der Wartungsarbeiten bei der Gaspipeline „Nordstream 1“ erklärt die Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) im Gespräch SWR2: „Wir haben schon vor Kriegsbeginn in der Ukraine begonnen, uns zu wappnen.“ Die Kritik von CSU-Chef Markus Söder im ARD-Sommerinterview, dass andere Länder besser vorbereitet seien auf die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland antwortet Brantner: „Soweit ich das sehen kann, ist das reine Parteipolitik.“ Die Bundesregierung werde bei Eintritt der so genannten „Gasnotlage“ die Bevölkerung weiter von den steigenden Preisen bei der Energieversorgung entlasten verspricht Brantner – macht aber auch klar: „Wir nutzen den Trigger erst, wenn es nötig ist.“ Über die Strategie Moskaus gibt sich Brantner keinen Illusionen hin: „Putin führt einen ökonomischen Krieg.“ In diesem Zusammenhang verteidigt die Grünen-Politikerin auch die Ausnahme-Genehmigung, eine in Kanada gewartete Gasturbine wieder nach Russland zu exportieren. Das Fehlen der Maschine diene dem russischen Präsidenten anderenfalls als vorgeschobenes Argument. Brantner entgegnet: „Wir dürfen diesen Narrativen von Putin nicht auf den Leim gehen.“
Daniel und Anna sind verlobt. Die beiden zögern aber noch mit dem Heiraten. Denn nach der Hochzeit würden sie mehr Steuern zahlen. Der Grund: Die Heiratsstrafe. Diese Ungleichbehandlung soll schon lange abgeschafft werden, doch die Parteien streiten sich um das wie. Dabei hat das Bundesgericht bereits 1984 entschieden: Die Heiratsstrafe ist verfassungswidrig und gehört abgeschafft. Allerdings bezog sich das Urteil nur auf die Kantonssteuern – nicht aber auf die Bundessteuern. Die Kantone haben seither reagiert und haben die Heiratsstrafe abgeschafft. Auf Bundesebene hat sich seither aber nichts verändert. Zwar sind sich alle Parteien mehrheitlich einig, dass die Ungleichbehandlung zwischen verheirateten und nicht verheirateten Paaren abgeschafft gehört. Doch über das wie wird seither gestritten. Schaut man sich die Vorschläge der Parteien genauer an, zeigt sich, dass dahinter mehr steckt als reine Steuerpolitik. Vielmehr lässt sich der ideologische Hintergrund der Parteien erkennen. Die Liberalen wollen das Individuum, die Konservativen die traditionelle Familie stärken und Links will die gutverdienenden steuerlich nicht entlasten. Es zeigt sich: Steuerpolitik ist eine Frage der Weltanschauung – und knallharte Parteipolitik. Wollt ihr uns etwas mitteilen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57 oder schreibt uns auf einfachpolitik@srf.ch Einfach Politik ist ein Podcast von SRF. Inhalt und Recherche: Valérie Wacker und Iwan Santoro, Produktion: Janis Fahrländer, Technik: Björn Müller
Daniel und Anna sind verlobt. Die beiden zögern aber noch mit dem Heiraten. Denn nach der Hochzeit würden sie mehr Steuern zahlen. Der Grund: Die Heiratsstrafe. Diese Ungleichbehandlung soll schon lange abgeschafft werden, doch die Parteien streiten sich um das wie. Dabei hat das Bundesgericht bereits 1984 entschieden: Die Heiratsstrafe ist verfassungswidrig und gehört abgeschafft. Allerdings bezog sich das Urteil nur auf die Kantonssteuern – nicht aber auf die Bundessteuern. Die Kantone haben seither reagiert und haben die Heiratsstrafe abgeschafft. Auf Bundesebene hat sich seither aber nichts verändert. Zwar sind sich alle Parteien mehrheitlich einig, dass die Ungleichbehandlung zwischen verheirateten und nicht verheirateten Paaren abgeschafft gehört. Doch über das wie wird seither gestritten. Schaut man sich die Vorschläge der Parteien genauer an, zeigt sich, dass dahinter mehr steckt als reine Steuerpolitik. Vielmehr lässt sich der ideologische Hintergrund der Parteien erkennen. Die Liberalen wollen das Individuum, die Konservativen die traditionelle Familie stärken und Links will die gutverdienenden steuerlich nicht entlasten. Es zeigt sich: Steuerpolitik ist eine Frage der Weltanschauung – und knallharte Parteipolitik. Wollt ihr uns etwas mitteilen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57 oder schreibt uns auf einfachpolitik@srf.ch Einfach Politik ist ein Podcast von SRF. Inhalt und Recherche: Valérie Wacker und Iwan Santoro, Produktion: Janis Fahrländer, Technik: Björn Müller
Werbung oder Information?
220111PCWerbung oder Information? Mensch Mahler am 11.01.2022 In der Frage der Kernkraft stehe er links von der SPD, in der Abtreibungsdiskussion rechts von der CDU. So ähnlich formulierte der streitbare Essener Pfarrer Fritz Schwarz schon 1985 seine Positionen in Fragen, die er parteipolitisch für nicht verhandelbar hielt. Sein Buch „unter allen Stühlen“, ebenfalls 1985 erschienen, ist bis heute lesenswert. Und ich gebe Ihm recht: es gibt Themen, die sind nicht für Parteipolitik geeignet. Allein das eigene Gewissen entscheidet bei Überlebensthemen. Kardinal Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, kritisiert die von der Ampelkoalition angestrebte Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibung. Der Paragraf 219a untersagt es Ärztinnen und Ärzten, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich zur Verfügung zu stellen. Dies soll laut Ampel bald wieder erlaubt sein und darüber hinaus soll eine Schwangerschaftskonfliktberatung auch online möglich sein. Abgesehen davon, ob eine Information mit Werbung gleichzusetzen ist, meine ich schon, dass eine Konfliktberatung im persönlichen Gespräch sinnvoll ist, einfach weil die menschlich-psychische Komponente so besser transportiert werden kann. Und auch die Wahrheit nicht verschwiegen wird, dass eine Abtreibung auch immer ein Leben beendet. Wie die Mutter und bestenfalls auch der Vater dann damit umgehen, muss in der Tat ihrem eigenen Gewissen vorbehalten bleiben. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Neue Kulturstaatsministerin - Claudia Roth: "Ich bin parteiisch für die Kultur"
Regierungswechsel in Berlin - und damit auch im Staatsministerium für Kultur und Medien. Claudia Roth von den Grünen übernimmt das Amt von Monika Grütters. Parteipolitik habe hier nichts zu suchen, sagte sie im Deutschlandfunk - den Klimaschutz will Roth trotzdem in den Fokus nehmen.Claudia Roth im Gespräch mit Stefan Koldehoffwww.deutschlandfunk.de, Kultur heuteDirekter Link zur Audiodatei
Piratensender Powerplay, Episode 57: "Die Ethik des Teilens"
Fri, 15 Oct 2021 17:50:24 +0000 https://piratensenderpowerplay.podigee.io/74-neue-episode d40799d47561403e51bea1853126850c Das Gespräch am Ende der Woche – mit Samira El Ouassil und Friedemann Karig 00:00: Werblicher Hinweis: mehr Podcast mit Friedemann 01:00: Los geht´s diese Woche ohne Parteipolitik, dafür mit Diskursspiegelung: wie kommen wir aus dem Dilemma der liberalen Gesellschaft raus, die nicht ignorieren kann, was sie angreift, und es durch ihre Aufmersamkeit immer auch stärker macht? 09:00: Sarah-Lee Heinrich und die Entgrenzung von Online- und Offline-Schulhöfen, instrumentalisiert von rechten Accounts. 14:00: Wie kommen gewisse tpxische Inhalte in unsere Timelines, ohne dass wir toxischen Accounts folgen? Durch Empörung und Gegenwehr. 16:50: SAMIRA HAT AUCH SCHONMAL SCHLIMME WORTE IM MUNDE GEFÜHRT!!! 17:30: Warum haben das viele Leute auch von sich öffentlich gemacht, um solidarisch zu sein? 22:30: Löscht diese Solidarität das Feuer? Nein. Hilft sie den Objekten des Shitstorms? Womöglich. 26:00: Wenn die Reproduktion des skandalisierten Verhaltens nicht hilft – was sind dann Leitlinien des eigenen soziamedialen Handelns? 29:30: Elke Heidenreich. Haleluja. 34:30: Die Plattformanbieter profitieren von diesem toxischen Teilen. Sie incentivieren es. Das dürfen wir nie vergessen. 41:30: Vielleicht ist weniger wichtig, über wen und was sich empört wird, sondern woher die Empörung ursprünglich kommt. 74 full Das Gespräch am Ende der Woche – mit Samira El Ouassil und Friedemann Karig no Samira El Ouassil, Friedemann Karig
FDP-Spitzenkandidat Czaja: Volksentscheid "absolut falscher Weg"
Zwölfzweiundzwanzig - Das Gespräch am Wochenende mit Sabina Matthay | Inforadio
Obwohl die FDP derzeit die kleinste Partei im Berliner Abgeordnetenhaus ist, will ihr Fraktionschef und Spitzenkandidat Sebastian Czaja nach der Abgeordnetenhauswahl wieder mitregieren - auch um die Enteignung großer Wohnungsunternehmen zu verhindern. Mit ihm hat Sabina Matthay gesprochen.
Birgit Gerstorfer - SPÖ - OÖ Wahl Special
Von der Leiterin des AMS OÖ zur Spitzenkandidatin der SPÖ OÖ. Birgit erzählt uns aus der Zeit beim AMS und was sie dabei gelernt hat über die sozialen Missstände und wie das ihre Politik beeinflusst. Warum sie Politik für ihre Enkelkinder macht und wir bekommen auch mit, wie zermürbend die Parteipolitik ist, die immer wieder gute Ideen im Keim erstickt wenn sie von der falschen Seite kommen. Die Sozialdemokratie hatte es die letzten Jahre nicht leicht, Birgit will diesen Kurs in OÖ ändern. Wie? Reinhören Präsentiert von tips.at
Wie sexistisch geht es im Bundestag zu? Katharina Dröge (Grüne) und Rebekka Müller (Volt) im Gespräch
Die Kölnerin Katharina Dröge sitzt seit 2013 für die Grünen im Bundestag, Rebekka Müller macht Wahlkampf, um erstmals für die Partei Volt in den Bundestag einzuziehen. im Podcast reden die erfahrene Bundestagsabgeordnete und die Polit-Newcomerin über gute alte Wahlkampfplakate am Straßenrand, ihre politischen Topthemen, Sexismus im Bundestag und ihre Leidenschaft für klassische Parteipolitik.
In der heutigen Ausgabe des Mexiko Podcast sind wir als Detektive unterwegs. Es geht um Spionage-Software, um undurchsichtige Parteipolitik und um 19 Millionen Impfdosen, die angeblich verschwunden sind.
Langwierig, kleinteilig, enttäuschend: So sehen viele Parteipolitik. Sollten wir als Bewegung Parteien abschreiben? Und worauf können wir nach der Wahl noch hoffen? Das besprechen wir in der neuen Folge. Opposition oder Regierung - was ist die bessere Strategie für Bewegungsleute im Parlament? Und was können wir aus der Geschichte der Grünen und der Sozialdemokratie über den langen Marsch durch die Institutionen lernen?
Was können Jugendliche gegen die Klimakrise tun. Ein gespräch mit Aidan von den Jungen Grünen.
Demos, Konsumverhalten oder Parteipolitik. In diesem Podcast reden wir darüber wie sich Jugendliche gegen die Klimakrise einsetzten können.
Grüne bei Umfragen vorn: Wohl mehr als ein Strohfeuer
Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend liegen die Grünen in der Wählergunst vor der Union. Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann sieht eine Wechselstimmung im Land. Es fehle eine klare Linie bei Unions Spitzenkandidat Armin Laschet. Zudem könnten die Grünen mit dem Thema Klima punkten.
Auch die Alternative für Deutschland hat sich für den Bundestagswahlkampf positioniert. Der Kampagnenspruch lautet: "Deutschland. Aber normal." Welchen Weg die Partei gehen will, hat Christian Wildt den Sozialwissenschaftler Alexander Häusler gefragt.
Freie Wähler und die CDU - Abstimmungen durch Bürger, Rolle der Parteien in unserer Gesellschaft
✘ Werbung: https://www.Whisky.de/shop/ Die Freien Wähler sind bundesweit im #Aufwind. Ihnen haftet nicht die #Parteipolitik an, sondern die #Kandidaten sehen sich frei von Vorgaben durch eine Partei. Dass die Freien Wähler nun eine Partei gründen mussten, um zur Bundestagswahl 2021 zugelassen zu werden, widerspricht ihrem Anspruch. Geht aber wohl nicht anders in unserer repräsentativen Parteiendemokratie. Buch Prof. Otte ► https://youtu.be/wdRW1xsfZN8 Wahl des Parteivorsitzenden CDU ► https://youtu.be/Tps1clvVkOU Wahlvorhersage Bund 2021 ► https://youtu.be/xnsyJznZAbM Wahl in Thüringen 2020 ► https://youtu.be/vQ4k7MC93ow
Viele hessische Kommunen haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Gebäude stehen leer, die Hausarztpraxis findet keinen Nachfolger und es fehlt an Menschen, die sich einbringen und Aufgaben übernehmen. Aber es gibt auch Lösungen für diese Herausforderungen. Und die liegen oft jenseits der Parteipolitik. Hessens Kommunen lösen Probleme mit guten Ideen, Pragmatismus und viel Engagement.
Mehr Corona-Gemähre & Politik ohne Ochsentour - Meinungsmagazin
Junge Menschen engagieren sich lieber für konkrete Projekte als in Parteien. Moderator Max von Malotki diskutiert, wie die damit umgehen sollen. Peter Zudeick kommentiert Dissonanzen der Corona-Politik. Und: Stromspeicher gesucht.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist seit Jahren ein Spielball von Parteipolitik und Intrigen. Clemens Neuhold und Christian Rainer im profil-Talk zur aktuellen Titelgeschichte.
Es war für beide Seiten kein ganz einfaches Verhältnis zwischen den Aktivisten des AFD-Kreisverbands Recklinghausen und dem Journalisten, der wissen wollte: "Was treibt euch an, und warum seid ihr dabei?" Dennoch gab es spannende Begegnungen: beim Stammtisch oder beim Ausflug zur "großen Politik" auf Einladung eines Abgeordneten in Berlin. Auch wenn es ums Zuhören und Nachfragen ging, blieben kontroverse Debatten nicht aus.
Wir haben mit dem patriotischen YouTuber Friedrich von Osterhal gesprochen. Themen waren unter anderem die YouTube-Zensur, die Entwicklung seiner politischen Perspektive und das Verhältnis von Parteipolitik und medialem Vorfeld. Außerdem empfiehlt er einige neue YouTube-Kanäle, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Kanäle: Friedrich von Osterhal - https://www.youtube.com/channel/UC1JUkaXFjV5FCFqVEEmKLjQ UNTERSTÜTZEN: https://konfliktmag.de/unterstuetzen/ +++++++++++++ konflikt Magazin Telegram: t.me/konfliktmagazin +++++++++++++ Website: konfliktmag.de E-Mail: redaktion@konfliktmag.de +++++++++++++ Twitter: twitter.com/konfliktmag Facebook: www.facebook.com/konfliktmag +++++++++++++ DLive: dlive.tv/konfliktmag Podcast: konfliktmagazin.podbean.com +++++++++++++
Folge 50: Jung, grün, bremisch – Alexandra Werwath
Mit 24 stand sie – zunächst mit Hermann Kuhn – an der Spitze der Bremer Grünen: Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin, damit das, was in anderen Parteien Landesvorsitzende betitelt wird. Sie erzählt, wie sie mit 14 in die Parteipolitik fand, wie der „feministische Weg aus der Krise“ aussehen könnte, was sie an der derzeitigen Infektionsschutz-Strategie auszusetzen hat und wie man dreistöckige Torten backt.
Die SPD will die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr ganz auf Eis legen. Die SPD-Fraktion werde der Bewaffnung der Drohne „Heron TP“ nicht zuzustimmen, hieß es aus Berlin. Hier siegt schnöde Parteipolitik über Verantwortung, schreibt Alexander Will, Mitglied der NWZ Chefredaktion.
#104 - Lilly Blaudszun: Wie wir junge Menschen für alte Parteien begeistern können
Wie begeisterst man die Generation Z für Parteipolitik, Programmentwürfe und Delegiertenversammlungen? Lilly Blaudszun hat Ideen: Sie ist 19 Jahre alt, politische Influencerin, arbeitet für die SPD Mecklenburg-Vorpommern im Kommunikationsbereich und wirkt seit neustem auch im Team um Raphael Brinkert an der SPD-Kampagne für die Bundestagswahl mit. Im 8. Tag kritisiert Blaudszun den Umgang etablierter Politiker mit den Sorgen der Jugendlichen und weist Wege auf, wie Parteien junge, politisch engagierte Bürger für sich gewinnen können.
#104 - Lilly Blaudszun: Wie wir junge Menschen für alte Parteien begeistern können - Kompakt
Die Politische Influencerin will die Generationen Z in die Institutionen bringen! Wie begeisterst man die Generation Z für Parteipolitik, Programmentwürfe und Delegiertenversammlungen? Lilly Blaudszun hat Ideen: Sie ist 19 Jahre alt, politische Influencerin, arbeitet für die SPD Mecklenburg-Vorpommern im Kommunikationsbereich und wirkt seit neustem auch im Team um Raphael Brinkert an der SPD-Kampagne für die Bundestagswahl mit. Im 8. Tag kritisiert Blaudszun den Umgang etablierter Politiker mit den Sorgen der Jugendlichen und weist Wege auf, wie Parteien junge, politisch engagierte Bürger für sich gewinnen können. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
#9 BIPoCs in der Politik - mit Aminata Touré und Ario Mirzaie
Sie heißen Rashida Tlaib, Ayana Presley, Ilhan Omar und Alexandria Ocasio Cortez. Sie alle ergeben “The Squad” - eine Gruppe von Schwarzen Frauen und Frauen of Colour, die für eine progressive und linke Politik in der US-amerikanischen Demokratischen Partei stehen. Wie sie engagieren sich immer mehr marginalisierte Menschen dort in Parteien und erheben in den Parlamenten ihre Stimme - ein Trend, der auch in Deutschland zu beobachten ist. Immer mehr und mehr mischen BIPoC auch in Deutschland die Parteienlandschaft auf. Einige von ihnen haben schon ein Amt inne, andere wollen es fürs Superwahljahr 2021 erreichen. Aber wie ist es für BIPoC parteipolitisch aktiv zu sein? Welche Herausforderungen und Chancen warten auf sie? Und Hand aufs Herz: was ist effektiver? Außerparlamentarischer Aktivismus oder Parteipolitik? Darüber sprechen Dominik und Zuher in dieser Folge mit Ario Mirziae (Kandidat fürs Berliner Abgeordnetenhaus) und Aminata Touré (Vize-Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein).
Teutrine: FDP ist eine Partei des Aufstiegs und der Bildung
Zwölfzweiundzwanzig - Das Gespräch am Wochenende mit Sabina Matthay | Inforadio
Die FDP im Herbst 2020: Lediglich rund sechs Prozent der Deutschen würden derzeit die Liberalen wählen. Liegt es am Programm, an den hausgemachten Affären? Darüber spricht Sabina Matthay mit dem Vorsitzenden der Jungen Liberalen, Jens Teutrine.
Heute mit diesen Themen: Die Higa-Veranstalterin kassierte im Gemeinderat eine Abfuhr Glarus schickt 400 Partygänger in Quarantäne Christoph Blocher kündigt Rücktritt aus der Parteipolitik an – aber nicht aus der Politik
Ohne Sicherheit keine Demokratie mit Christoph Bilban
Neutralität sei kein Grund um keine aktive Sicherheitspolitik zu betreiben, sagt der Präsident des Thinktanks Sipol und Oberstleutnant Christoph Bilban. Er forscht an der Landesverteidigungsakademie, im Gespräch über die Bedeutung kollektiver Sicherheit als europäischer, neutraler Staat im 21. Jahrhundert und was sein Verein Sipol dazu beiträgt. Europa und Freiheit Wenn Christoph Bilban von Sicherheit spricht, beginnt er damit auf der höchsten Ebene: „Für mich besteht kollektive Sicherheit vor allem darin, als globale Weltgemeinschaft ein Umfeld zu schaffen, das möglichst frei von Gewaltstrukturen und Bedrohungen ist. Wo man Konflikte auf möglichst zivilisierte und friedvolle Art lösen kann“. Unter heutigen Bedingungen heißt das für Österreich eine Sicherheitspolitik, die im europäischen Rahmen entstehen und bestehen muss. Die Idee, nationale Kräfte mit fokussierten Aufgaben zu bündeln, sei prinzipiell nicht schlecht, sagt er. „Die Voraussetzung dafür ist aber eine europäische Union, die viel weitergeht als heute. Das geht nicht ohne eine politische Union. Der Grundsatz eines jeden militärischen Einsatzes ist, dass die politische Verantwortlichkeit ganz klar ist“. Ein Problem in einer Vergemeinschaftung der Streitkräfte sieht Bilban in der Geschwindigkeit von Entscheidungen. Wenn nach wie vor nach dem Einheitsprinzip entschieden wird, würden man auf manche Bedrohungen und Risiken nicht mehr schnell genug reagieren können. Konkret scheitert es trotz Bemühungen wie dem PESCO-Programm noch an einem genauen Plan, wie eine solche Armee aussehen sollte. „Wenn es aber eine europäische Armee geben wird, sollte Österreich dabei mitwirken“. Als Verein Sipol hat man sich auch den europäischen Freiheitsbegriff auf die Fahnen geheftet: „Wir vertreten die Grundwerte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, der Fokus auf die Menschenrechte, die zentral sein sollten für politisches Handeln. Diese bürgerlichen, demokratischen Grundfreiheiten verstehen wir darunter“. Sicherheit verstehen Sipol definiert er als überparteiliche Initiative, die sich Diskursförderung beim Thema Sicherheitspolitik zum Hauptziel gesetzt hat. Menschen zu sensibilisieren und ein breites Verständnis zu schaffen, wo Österreich auf Europaebene steht, wenn es um Frieden, Sicherheit und Stabilität geht. „Es ist wirklich purer Idealismus ohne Parteipolitik“, sagt Bilban. 2014 offiziell gegründet, gab es 2015 den ersten Meilenstein: „Eine Studie zum Thema Verträglichkeit von Miliztätigkeit und Studium von Bernhard Völkl und mir hat Aufmerksamkeit im Verteidigungsministerium erregt. Wir haben gemerkt, dass mit Fakten und Sachthemen wird man gehört“. 2016 und 2017 kommen Stammtische zu den Vereinstätigkeiten und es wird weiter publiziert: „Unsere Artikel basieren meistens auf unserer jeweiligen Expertise bzw. auf der der Gastautoren“. Die reicht von Politikwissenschaft über Wirtschaft bis zu Biotechnologie. Als neues Standbein kam die Übersetzung der österreichischen Verteidigungspolitik in englischer Sprache dazu, um das auch Europäer*innen verständlich zu machen. Wo soll Sipol in fünf Jahren sein? „Sipol war darauf ausgelegt, dass wir mit 35 Jahren aussteigen und wieder den Jungen überlassen, dass es ein sich selbst erneuerndes System bleibt. In den nächsten fünf Jahren wollen wir es so weit bringen, dass wir das Zepter abgeben und sagen: ‚Wir haben ein Produkt, dass es schafft, dass Menschen eine Ahnung von Sicherheitspolitik haben, die sich das nicht vorstellen konnten“.
Über Politik zu sprechen bereitet mir keine Freude - Der Held am Freitagabend
Welt, willkommen beim Helden! Ganz kurz versuche ich zu beschreiben, weswegen ich lieber über Strukturen und Potentiale spreche, als mich in die Tiefen der Parteipolitik zu verirren. Kurz zu mir: Einige von Euch kennen mich vielleicht aus meinem Held der Steine-Kanal, den ich als kleiner Held, jung und den Kopf voll Träumereien, in Frankfurt gründete. Seit vielen Jahren versuche ich dort die Welt der Bausteine zu sortieren, das entdeckte Wissen zu teilen und Euch in ruhigen Momenten auch zu unterhalten. Nun finde ich immer wieder ein wenig freie Zeit und diese möchte ich natürlich mit Euch verbringen. Wir werden unentdeckte Welten erforschen, Abenteuer bestehen und manchmal erzähle ich einen Schwank aus meiner Jugend. Ich wünsche Euch viel Freude & eine tolle Zeit! Hier gibt's die netten Tassen*: http://bit.ly/Bausteinecke-HdSTasse ...und hier die weiteren Kanäle & Infos https://www.held-der-steine.de https://www.instagram.com/helddersteine https://www.facebook.com/HeldderSteine Thomas Panke 069-95863972 Laubestr. 26 60594 Frankfurt am Main *Die Links sind Affiliate-Links. Die Angebote stammen nicht von mir, allerdings erhalte ich durch den Verweis eine Provision, wenn dann ein Kauf stattfindet, jedoch ohne dass Euch zusätzliche Kosten entstehen. Wenn Ihr klickt und kauft: vielen Dank! :)
Die Regeln einer Gesellschaft finden mit Gertraud Diendorfer
Das Demokratiezentrum Wien feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Die Leiterin Gertraud Diendorfer im Gespräch über die Vermittlung des Themas und warum sie es überhaupt nicht für abstrakt oder trocken hält. Starke politische Bildung als Institution, und der lange Weg zur Freude an der Demokratie in Österreich. Lesen Sie hier zwei Stichpunkte aus dem Gespräch. „Ich glaube es wird ein wenig überbewertet, dass Demokratie trocken und spröde und schwierig ist. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso spannender wird sie. Demokratie bestimmt ja unglaublich das eigene Leben, die Rahmenbedingungen, welche Regeln und Möglichkeiten wir haben“. Diendorfer sagt, dass auch eine zielgruppenorientiere Vermittlung wichtig sei. Kinder und Jugendliche werden anders an das Thema herangebracht als es in einem Workshop für Erwachsene der Fall wäre. Ende der 1990er Jahre entstanden die ersten Pläne für das Demokratiezentrum Wien. Zeitgleich mit der Massentauglichkeit des Internets sieht Diendorfer das Potential: „Das Internet hat ja versprochen, dass Wissen demokratisiert wird, dass man direkt und anders kommuniziert, dass eine neue Öffentlichkeit entstehen kann“. Das war ein Teil der Gründungsgedanken. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus vielen wissenschaftlichen Bereichen ist aber auch die Forschung und Vermittlung zentral. „Wir wollten das Demokratiezentrum an der Schnittstelle von Wissenschaft, Bildung und interessierter Öffentlichkeit gründen“. Bei der Vermittlung ist Diendorfer sehr direkt, sie hält es nicht für abstrakt: „Das wird schon so vor sich hergetragen und man scheut gleich zurück. Unsere Gesellschaft ist generell komplex. Jede Anleitung für ein technisches Gerät muss ich mir zweimal durchlesen, bei dem Thema Demokratie will man sich dieser Mühe aber nicht aussetzen. Man soll das aber tun, denn es ist ein lohnendes Unterfangen“. Woher kommt die Demokratieverdrossenheit in Österreich? Diendorfer sieht hier vor allem historische Gründe. Österreich sei eine Gesellschaft ohne Revolution, zwei mitverursachten Weltkriegen und einer fehlenden differenzierten Aufarbeitung dieser Verantwortung. „Von daher hat man politische Bildung sehr verengt als Parteipolitik gesehen und das als Indoktrination gesehen. Auch unsere Demokratiegeschichte ist sehr jung“. Demokratie ist nicht gleich Demokratie Die unterschiedlichen Formen von Demokratie sorgen ebenfalls dafür, dass eine Realisierung und Begeisterung sich nicht von alleine einstellt. „Man kann natürlich zur Wahl gehen und dann den gewählten Vertretern und Vertreterinnen sagen, ihr macht jetzt den Job. Ich vertrete aber eine partizipative Form, wo ich mich engagiere und mitbestimmen möchte. Nur dann, wenn ich selbst Verantwortung übernehme, kann ich mitreden und mitgestalten. Das war in Österreich ein längerer Prozess über Jahrzehnte, dass wir Demokratie immer weiterentwickelt haben“. Um dieses Gefühl voranzutreiben, arbeitet sie gerne mit Ausstellungen, das sie als Lernformat nutzt. Vor allem bei Schülerinnen und Schülern kommt die Interaktion des Formats, ergänzt mit technischen Möglichkeiten gut an. Thematisch bleibt hier auch sehr viel möglich, von Integration, Migration, Demokratie an sich oder das Beispiel von Grundrechten: „Schon als junger Mensch habe ich ja gewisse Rechte und kann mich einbringen. Aber weil so wenig politische Bildung vermittelt wird, weil es auch von der Bildung der Lehrer abhängt, ob es ein Fach gibt oder nicht, wissen Schüler oft nicht Bescheid“. Die zweite Schiene, die Diendorfer für wichtig hält, ist daher eine stärkere Institutionalisierung der politischen Bildung, um weniger von einzelnen Schulen, Lehrer*innen und Lehrplänen abhängig zu werden.
Mit Nils Wegner über die Rechte, warum man trotzdem in der Gesellschaft leben muss und etwas Amerika
Nils Wegner Twitter: https://twitter.com/Skototaxis https://sezession.de/57218/mosaik-rechte-und-jugendbewegung https://sezession.de/53055/alter-rechter-junger-rechter-kein-rechter-mohler-hepp-strauss Themen: - Die neue Rechte - Parteipolitik - Metapolitik - Der alltägliche Grind - Mohler, Hepp und Strauß Mail: info.Rechtsausleger@gmail.com Twitter: @rechtsausleger1 Patreon: https://www.patreon.com/Rechtsausleger
Die CDU zu führen, ist nicht irgendein Job. Der nächste Parteivorsitzende wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Kanzlerkandidat der Union – und hat große Chancen, 2021 Bundeskanzler zu werden. Eigentlich. Denn fragt man die Deutschen, wem sie am ehesten die Kanzlerschaft zutrauen, dann liegt im Augenblick der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder vorn – mit weitem Abstand vor den CDU-Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Viereinhalb Monate vor dem CDU-Parteitag bringt das Bewegung in die Vorsitzendenfrage. Mit ZEIT-Redakteurin Mariam Lau sprechen wir darüber, warum die Kandidatenkür so wichtig ist – selbst wenn man sich nicht für Parteipolitik interessiert. Wie würde sich das Land verändern? Was muss man mitbringen, um die Bundesrepublik durchs nächste Jahrzehnt zu führen? Und da sich im Augenblick nur Männer bewerben und die CDU über die Einführung einer Frauenquote streitet: Hat die CDU ein Problem mit Frauen – oder haben Frauen demnächst ein Problem mit der CDU? Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die Politik aktuell beschäftigt, über die Geschichten hinter den Nachrichten und darüber, was noch kommen könnte. Immer freitags mit zwei Moderatoren, einem Gast – und einem Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing oder Ileana Grabitz und Marc Brost zu hören – und diese Woche ausnahmsweise Marc Brost allein. Jeder Gast bekommt am Ende der Sendung eine "Das Politikteil"-Tasse geschenkt. Diese Tasse gibt es auch im "Das Politikteil"-Fanshop (www.shop.spreadshirt.de/zeit-podcasts).
Zwischen Design und Verwaltung mit Caroline Paulick-Thiel
Die Mitgründerin und strategische Direktorin von „Politics for Tomorrow“, Caroline Paulick-Thiel schafft Innovation im öffentlichen Sektor in Deutschland. Wie Design und Verwaltung miteinander funktionieren und warum wir unser Verständnis von Politik schärfen müssen. Eine Frage der Definition Bevor man die Politik von morgen definiert, muss es ein klares Verständnis geben, über welche Art von Politik wir sprechen, sagt Paulick-Thiel. „Wie definieren wir das für uns? Geht es um Parteipolitik, Lebenspolitik, Politik in Organisationen oder öffentlichen Institutionen?“ Die Politik als solches gibt es nicht, daher greift sie auf die politikwissenschaftliche Einteilung in Politics, Polity und Policy zurück: „Politics sind die Prozesse mit denen wir zu Policies kommen. Wie treffen wir Entscheidungen, um zu neuen Rahmenbedingungen und zu neuen Institutionen, also Polity, zu kommen?“ Als Organisation fokussieren sie sich nicht auf Policies, also Inhalte, sondern bleiben bei den Politics als Prozessen. „Wie kann man das besser betrachten, besser organisieren und Perspektiven einbringen, wo wir blinde Flecken haben, die wir bisher vergessen haben?“ Das beinhaltet nicht nur Personengruppen, sondern auch „commons“, also Gemeingüter. „Wie können wir in Wien die Wiener Luft an den Tisch bekommen? Entitäten, die maßgeblich für unsere Lebensgrundlage entscheidend sind mit an den Tisch holen?“. Wie repräsentiert man etwas, das nicht repräsentierbar ist? „Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man so etwas legislativ macht. Michel Serres hat in seinem Buch „Der Naturvertrag“ Vorschläge gemacht, wie man Natur legislativ repräsentiert. Es gibt über Ombudsansätze, wo eine Person Natur repräsentiert. Wir arbeiten seit diesem Jahr auch mit systemischen Aufstellungen, wo wir zum Beispiel den Umgang von Verzicht oder Gemeinwohl mit in den Denkraum und den körperlichen Raum holen. Über Dinge sprechen, die unsichtbar sind, aber die uns alle betreffen“, erzählt Paulick-Thiel. Wie kommt dieser Ansatz in der Praxis an? „Wir arbeiten aktuell in Deutschland mit einem diversen Netzwerk an Einzelpersonen, die sehr offen sind und in ihren Institutionen Veränderung anstoßen. Der Übergang von individueller Leistung zu organisationaler Kapazität stellt dabei eine große Hürde dar“. Die Knackpunkte, die oft verhindern, dass neue Prozesse in der Verwaltung ankommen, liegen auf rechtlicher, organisationaler und bürokratischer Seite. Man müsse neue Routinen auf einer hohen Ebene erreichen, um einer kritischen Masse an Beamten Zugang zu geben, argumentiert sie. Infrastruktur für die nächste Generation Auch in Deutschland sei in den letzten Jahren die folgende Botschaft angekommen: „Der öffentliche Sektor ist mit Herausforderungen konfrontiert, die sich nicht ohne Kreativität, Kooperation und neue Arbeitsansätze lösen lassen“. Die Frage sei bei Führungskräften angekommen, auch in der Hinsicht, das Potential der vielen Mitarbeiter des öffentlichen Sektors zu nutzen. „Darin sehe auch unsere Aufgabe: Räume aufzumachen, Infrastrukturen für eine nächste Generation aufzubauen, um sich zu entfalten. Dinge anzugehen, die junge Menschen maximal bewegen, aber auf die unsere öffentlichen Systeme nur minimale Antworten darauf haben“.
Der Solidarpakt 2020 löste schon Streit aus. Er soll das Problem der Altschulden und die Steuerausfälle der Kommunen zugleich lindern. Ein Gespräch mit SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans.
Man ist häufig mit vielen Fragen über das Leben konfrontiert. Woher kommt Petersilie? Wie steht sie in Verbindung mit dem Öl aus Saudi Arabien? Gibt es eine Petersilie-Mafia? Und was hat das alles mit der österreichischen Parteienlandschaft zu tun? Zitrönchen und Staubi stellen sich diesen wichtigen Fragen in dieser Folge und geben kaum ernsthafte Antworten auf Probleme, die entweder nicht existieren oder an ihrer Ernsthaftigkeit nicht zu überbieten sind.
Folge 3: Das bayerische G-8 oder warum München und der Robin keine Freunde sein können
Fehlende Stundenpläne, überforderte Lehrer und Unterricht (fast) bis zum Morgengrauen. Das G8 hat bei Vielen bleibenden Schaden verursacht und sie politisiert. Für Robin war die Schulzeit der Ausgangspunkt für seine Abneigung gegenüber der CSU, “Mia san Mia”-Getue, und überhaupt konservativer Parteipolitik. Für Willy zusätzlich noch der Beginn einer Karriere als Landesschülersprecher. In dieser Folge unseres Podcasts geht es aber auch um das was Schule uns (unfreiwillig) gelehrt hat: Machtlos ist man nur, solange man alleine handelt... Folge direkt herunterladen
Pillen nach Europa & Regierung unkonzentriert - Meinungsmagazin
Moderator Stephan Karkowsky erfährt, dass Medikamente made in China ein Risiko für Patienten sind. Ursula Weidenfeld findet, dass die GroKo nicht genug Vertrauen weckt. Und das Baukindergeld hilft nicht gegen Wohnungsnot.
Causa Wiesinger: Zerstört Parteipolitik Österreichs Schulen?
Eigentlich hätte Susanne Wiesinger, als Ombudsfrau für das Bildungsministerium, nur einen Bericht über den Einfluss islamistischer Ideologie an Schulen schreiben sollen. Doch anstelle dessen sorgt die ehemalige Lehrerin nun auch mit einem neuen Buch für Aufruhr. Denn darin heißt es, dass "Parteipolitik Österreichs Schulen zerstört". Was sowohl an dem Bericht als auch am Buch so problematisch ist und was es mit den schwerwiegenden Anschuldigungen auf sich hat, erklärt Petra Stuiber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim STANDARD.
Heute: Umzug, Klima-Zeitreisen und Parteipolitik.
Im Rahmen der anstehenden Nationalratswahl in Österreich diskutieren die Drei im heutigen Podcast zum Thema Wählen gehen. Wie wichtig ist Wählen gehen und kann ich nicht einfach daheim bleiben, wenn ich mich mit keiner Partei identifizieren kann? Content Creatorin JANAklar, YouTuber Michi Buchinger und Bestseller-Autor Thomas Brezina diskutieren über die Wichtigkeit von Wahlen, wie sie zu politischen Statements stehen und wie sie zwischen Sach- und Parteipolitik unterscheiden. Wie stehst du zum Thema Wahlen? Ganz klar wählen gehen, einfach ungültig wählen oder betrifft dich das Thema überhaupt nicht?
Buchbesprechung: AfD die kommende Volkspartei von Richard Bucholz
Untertitel: Die wahren #Ursachen für den Erfolg der AfD von heute und morgen Dies ist kein Buch, das Werbung für die AfD machen will. Es ist vielmehr eine erschreckender #Abrechnung mit den Missständen in Deutschland, die die AfD trefflich zu ihrem #Wachstum ausnutzt. Die Partei und die Probleme zu ignorieren oder klein zu reden war gestern. Mehr und mehr Menschen machen sich Gedanken ums Morgen und sehen sich bei den kaum zu unterscheidenden Parteien nicht mehr vertreten. Die AfD wird in den kommenden Jahren zu einer großen Volkspartei werden, wenn sich die aktuelle Parteipolitik sich der wirklichen Probleme der Menschen nicht bald annimmt. Der Autor ist Lehrer für Politik und Wirtschaft und zeichnet ein geschlossenes Bild von unserer #Gesellschaft, die die aufziehenden #Megaprobleme noch nicht einmal ansatzweise erkennt geschweige denn in den politischen Fokus rückt.
Mit Isabel Pfeiffer-Poensgen hat NRW eine Kulturministerin, die aus der Szene statt aus der Parteipolitik stammt. Bei den Kulturschaffenden im Land war die Freude überwiegend groß, als Ministerpräsident Laschet die heute 65-Jährige bei der Regierungsübernahme aus dem Hut zauberte. Die Kultur im Land sollte durch Pfeiffer-Poensgen und mit mehr Geld stärker gefördert werden. Knapp zwei Jahre später ziehen wir eine erste Bilanz, was die parteilose Ministerin bisher bewirkt hat. Rennen die Besucher den Museen und Veranstaltungen im Land die Bude ein? Gibt es eine Linderung der teilweise prekären Situationen der Kunstschaffenden? Und kommen die Fördergelder für Kultur an der richtigen Stelle an? Unter anderem diese Fragen stellt Daniela Junghans unseren kulturpolitischen Fachleuten Peter Grabowski und Marion Grob. Viel Spaß beim Hören.
#01 Fachwissen statt Parteipolitik - sind Experten die besseren Politiker?
Hört endlich auf die Experten! Fridays for Future, Rezo & Co. fordern: Fachwissen statt Parteipolitik. Wie viel Einfluss sollten Fachleute auf politische Entscheidungen bekommen? Sind sie vielleicht sogar die besseren Politiker?
Die Vermessung der Meinung mit Cornelius Hirsch
In der zweiten Folge zu unserem Europaschwerpunkt trafen wir Cornelius Hirsch. Er ist der Co-Gründer und Leiter von Poll of Polls, einer Plattform für Wahlumfragen, die aus ganz Europa Daten aggregiert und auswertet. Diese Idee hat dem Medium POLITICO so gut gefallen, dass es Poll of Polls kauft. Ein Gespräch über die Liebe zur Wissenschaft, warum er bei fast jedem Abendessen über Politik spricht, diese aber nicht selbst machen möchte. Europas Antwort auf 538 „Begonnen hat alles während dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016, ich war täglich auf fivethirtyeight.com und hab mir gedacht, warum gibt es sowas nicht auch für Europa?“ FiveThirtyEight ist eine Nachrichtenwebsite die Statistiken und Einschätzungen für Wahlumfragen liefert, Hirsch gründete davon inspiriert „Poll of Polls“. Gemeinsam mit einem Studienkollegen begannen sie 2017 mit den niederländischen und anschließend den französischen Wahlen. Sein Kollege Peter Reschenhofer programmierte die Website und Skripts, Hirsch übernahm die Datenarbeit. „Täglich Wikipedia, Umfrageseiten, Nachrichtenseiten oder sogar Twitter nach den neuesten Statistiken durchsuchen. Hoffen, dass es jemand eingegeben hat und während dem Frühstückskaffee eintippen“. Neben dem Vollzeitjob wird Poll of Polls aufgebaut, Hirsch arbeitet bis vor kurzem am WIFO und ist Doktorand an der Wirtschaftsuniversität. Nach und nach kommen mehr Länder mit mehr Wahlen dazu. Der Bedarf viele Befragungen an einem Ort zu sammeln und auszuwerten, kam von ihm selbst. „Was ich wollte, gab es nicht. Also habe ich es selbst gemacht, weil ich wissen wollte wie es steht“. Nachdem jedes Land in der EU online war, ging es schnell nach oben. Anfragen von internationalen Medien von Washington Post bis Le Monde kommen, letzten Sommer trifft er Ryan Heath von Politico Europe am Forum Alpbach und die Verhandlungen beginnen. Zur Verteidigung und Grenzen der Meinungsforschung Hirsch verteidigt die Meinungsforschung, die vor allem nach der Wahl von Trump in die Kritik geraten ist. „Niemand hat einen Sieg von Trump ausgeschlossen, seine Chancen lagen bei etwa 30 Prozent“. Die Verantwortung sieht er eher bei Journalisten und Medien, die aus einer Umfrage gerne eine Schlagzeile machen: „Eine Umfrage ist wie ein gutes Parfüm, man soll daran riechen, aber nicht davon trinken“, sagt Hirsch und gibt zu diesen Satz von Mathias Strolz gestohlen zu haben.Inspiriert aus einem Interview mit Regula Stämpfli fragt Philipp Weritz nach den Grenzen: Nur, weil man Demokratie vermessen kann, heißt das auch, dass man sie vermessen soll? „Das ist eine Frage, die ich mir selbst auch stelle. Aber es gehört zu meinem Menschenbild dazu, dass Wähler und Wählerinnen mündig sind. Und nur informierte Bürgerinnen sind informierte Wählerinnen“. Er sieht seine Rolle als Unterstützer und Aufklärer, der sich aufgebauschten Nachrichten auch entgegenstellen kann. „Als Herr Berlusconi in Italien seine Kandidatur bekannt gab, war das ein großer Tumult. Wenn man sieht, dass er einer Partei mit acht Prozent vorsteht, relativiert sich das wieder“. Politisierung á la Ländle Der gebürtige Vorarlberger ist seit jeher neugierig wenn es um Politik geht. „Ich kann mich gar nicht erinnern, jemals nicht politisch interessiert gewesen zu sein. Bei uns zu Hause wird bei jedem Abendessen mindestens einmal über Politik geredet“. Mit einem christlich-sozialen Großvater, der sich schon für Umweltagenden einsetzte, war ebenfalls ein Grundstein gelegt. Als dritten Faktor sieht Hirsch die Schulpolitik. „Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, dann in der Landesschülervertretung. Einen ordentlichen politischen Streit im besten Sinne auszutragen war einfach wahnsinnig spannend“. Allerdings sieht er bereits erste Anzeichen von Parteipolitik, die ihn abschrecken. Sachliche Auseinandersetzungen finde er sehr spannend, aber mit Anliegen einer Partei im Hintergrund zu diskutieren, will er nicht.
Im neuen Wochenkommentar geht's heute vor allem um die kräftigen Lebenszeichen, die rot und grün in dieser Woche endlich wieder von sich gegeben haben: es geht um den wunderbaren Linksruck der Wiener Grüninnen und den Jubelparteitag rund um die Wahl von Joy Pamela, und es geht unter anderem um den völlig verständlichen Warnstreik der Eisenbahngewerkschafter, der mit Parteipolitik überhaupt nichts zu tun hat!
Im neuen Wochenkommentar geht’s heute vor allem um die kräftigen Lebenszeichen, die rot und grün in dieser Woche endlich wieder von sich gegeben haben: es geht um den wunderbaren Linksruck der Wiener Grüninnen und den Jubelparteitag rund um die Wahl von Joy Pamela, und es geht unter anderem um den völlig verständlichen Warnstreik der Eisenbahngewerkschafter, der mit Parteipolitik überhaupt nichts zu tun hat!
In der heutige Folge geht es um die positive wirtschaftliche Entwicklung Polens nach dem Sozialismus, die aktuell mehr und mehr überschattet wird von politischen Machtspielen der regierenden PiS-Partei.
24: Die intellektuellen Nazis der Identitären Bewegung
In Europa und den USA ist eine Neue Rechte zu beobachten, die in Politik und Zivilgesellschaft aktiv ist. Eine relativ junge Organisation, die mit bestehenden Gruppen und Einzelpersonen gut vernetzt ist, ist die Identitäre Bewegung. Ihr Kernthema ist eine angeblich drohende "Über-Islamisierung" unter der Europa leide. Sie ist besonders, da sie es schafft, junge und gebildete Menschen für sich zu begeistern. Und zwar so: Sie lädt ihre Propaganda mit Popkultur auf, und gibt ihr mit einer intellektuellen Sprache einen positiven Anstrich. Die Identitäre Bewegung ist gefährlich, weil sie extrem rechtes Gedankengut für junge Menschen anschlussfähig macht, denen Nazis zu blöd waren und klassische Parteipolitik zu unattraktiv ist. Besonders beunruhigend: Es gibt Gründe, anzunehmen, dass in der mittlerweile verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) in den 90ern und 2000ern Kinder und Jugendliche gedrillt wurden mit dem Ziel, eine neu-rechte Elite heranzuziehen, und wir die jetzt mit der IB vor uns haben. Einordnung der IB durch die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin ZEIT Online über die Nazi-Aussteigerin Heidi Benneckenstein taz-Interview mit Heidi Benneckenstein
Sachsen-Anhalt steht vor schwieriger Regierungsfindung
Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird die politische Landschaft im Land durcheinanderwirbeln. Die Stärke der AfD sorgt dafür, dass sich neue Mehrheiten finden müssen.
#225 - Politik, das System & überhaupt - Christopher Lauer - Jung & Naiv
Mit Christopher Lauer, Ex-Pirat und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Wie funktioniert Parteipolitik heutzutage? Warum funktioniert's bei der CDU, aber nicht bei den Piraten? Wie wird Politik heute eigentlich gemacht? Wie sieht die parlamentarische Realität aus? Leben wir in einer Demokratie? Ist Politik für jeden etwas? Hat man nach ein paar Jahren noch Bock auf den ganzen Stress? Christopher Lauer war von 2009 bis 2014 Mitglied der Piratenpartei und ist seit 2011 Abgeordneter in Berlin. Wir haben mit ihm jung & naiv über seine frustrierenden politischen Erfahrungen gesprochen. Lauer im Netz: @schmidtlepp www.christopherlauer.de Abonniert den Youtube-Kanal! Werdet Fan auf Facebook. Folgt uns auch gern auf Twitter (@JungNaiv, @TiloJung)
Antje und Benni sprachen über: - die Grünen, Parteipolitik im allgemeinen und Angela Merkel im besonderen. - Blockupy, Hamburg, die Eigentumsfrage und Gewalt bei Demonstrationen (21:25) - Soziokratie und Konsens (44:20) Folge direkt herunterladen Download file directly