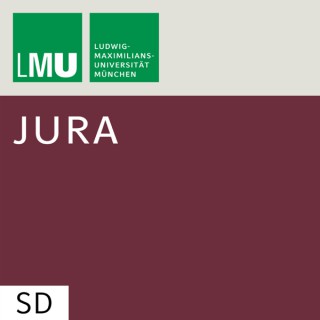Podcasts about schutzwirkung
- 56PODCASTS
- 74EPISODES
- 49mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 19, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about schutzwirkung
Latest podcast episodes about schutzwirkung
KI Patente: Was du schützen kannst – und was nicht | #KIundTECH
KI Patente: Was du schützen kannst – und was nicht!Künstliche Intelligenz verändert die Innovationslandschaft – doch was davon ist tatsächlich patentierbar? In dieser Episode spreche ich mit Dr. Patrick Heckeler, Patentanwalt und Partner bei Bardehle Pagenberg, über den aktuellen Stand des Patentrechts im KI-Bereich. Wir beleuchten, welche Entwicklungen Unternehmen heute schützen können, wo die Grenzen liegen und wie eine sinnvolle Patentstrategie im KI-Umfeld aussieht.Für alle, die mit KI entwickeln, Produkte bauen oder in innovative Technologien investieren, liefert dieses Gespräch eine klare Orientierung für die Praxis.Warum sollten Sie dieses Interview nicht verpassen?Sie erfahren, welche KI-Erfindungen heute realistische Chancen auf Patentschutz haben.Sie verstehen, wie Core AI und Applied AI patentrechtlich unterschieden werden.Sie lernen, wie Sie Schutzrechte auf DACH- oder globaler Ebene strategisch planen.Sie erfahren, wie Sie typische Risiken vermeiden, die Innovationen ungewollt gemeinfrei machen.Sie erhalten klare Empfehlungen, wie Sie den richtigen Zeitpunkt zur Patentanmeldung bestimmen.Takeaways aus dem Interview:KI-Erfindungen sind patentierbar, wenn sie ein technisches Problem lösen – Software allein reicht nicht.Core AI (Verbesserung der KI selbst) und Applied AI (KI zur Lösung technischer Probleme) werden unterschiedlich bewertet.Neuheit ist entscheidend: Jede öffentliche Erwähnung kann die Patentfähigkeit gefährden.Vor dem Proof of Concept sollten NDA und Anmeldestrategie geklärt sein.Nationale Anmeldung schafft Zeit: Ein Jahr, um internationale Märkte zu entscheiden.Für technisch komplexe KI-Erfindungen sind Prototypen, Messdaten und klare Dokumentation von Vorteil.Patentportfolios sind stabiler als Einzelpatente und erhöhen langfristig die Schutzwirkung.Danke an Dr. Patrick Heckeler für dieses klare, praxisnahe Gespräch!► https://www.bardehle.com/de/team/heckeler-patrick ► https://www.linkedin.com/in/dr-patrick-heckeler/ Über #KIundTECH – der KIundTECH Podcast: KI & TECH in Unternehmen und Gesellschaft: Wettbewerbsvorteil oder Sargnagel?Was machst Du daraus? Wir sprechen mit Anwendern und Vordenkern über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI – klar, praxisnah und auf den Punkt. Damit unsere Hörer schneller die richtigen Entscheidungen treffen können. ► Mehr erfahren: https://kiundtech.com/ ► Holger Winkler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holger-winkler/ Du möchtest einen Gast vorschlagen oder selber zu uns in die Sendung kommen? Alle Informationen und ein Bewerbungsformular findest du auf unserer Webseite!
Stoßstangen für Automobile waren bis Ende der 1920er Jahre ein Zubehör, das extra bestellt werden musst. Und es gab auch nur welche für vorne. Große Schutzwirkung hatten die Dinger nicht. Die Stoßfänger der Gegenwart dagegen sollen sogar Verletzungen bei Fußgängern oder Radfahrern minimieren können.
Prof. Dr. Mandy Mangler: „HPV kann Krebs verursachen – und auch Männer sollten sich schützen.“
„Wir alle hatten schon einmal HPV – nur die wenigsten wissen es.“ Prof. Dr. Mandy Mangler zählt zu den renommiertesten Gynäkologinnen Deutschlands und ist eine der wichtigsten Stimmen für Frauengesundheit. In dieser Folge BUNTE VIP GLOSS spricht sie mit Podcast-Host Jennifer Knäble über eine der am meisten unterschätzten Virusinfektionen weltweit: Humane Papillomviren – kurz HPV. Die Infektion ist extrem weit verbreitet, bleibt in den meisten Fällen unbemerkt und wird vom Immunsystem erfolgreich bekämpft. Doch bestimmte Hochrisiko-HPV-Typen können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben – sie führen zu Zellveränderungen, aus denen sich über Jahre hinweg Krebs entwickeln kann. — In Deutschland sterben jedes Jahr mehrere tausend Menschen an HPV-bedingten Krebsarten – darunter Gebärmutterhalskrebs, Mund-Rachen-Krebs oder Analkrebs. Trotzdem wird das Virus noch immer häufig als „Frauenthema“ abgetan – ein gefährlicher Irrtum, denn auch Männer können sich infizieren und sind Teil der Infektionskette. „Fast 3.000 Männer erkranken hierzulande jährlich an einem bösartigen Tumor, zum Beispiel an Peniskrebs, der durch HPV verursacht wurde“, so die Expertin. — Die gute Nachricht: Wir können uns schützen. Prof. Dr. Mangler erklärt, wie die HPV-Impfung wirkt, für wen sie sinnvoll ist und warum nicht nur junge Mädchen, sondern ebenso Jungen, Männer und Erwachsene davon profitieren können. Sie beschreibt die Übertragungswege des Virus, erklärt die begrenzte Schutzwirkung von Kondomen und zeigt, warum regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und fundierte Aufklärung so wichtig sind im Kampf gegen HPV-bedingte Krebserkrankungen. Prof. Dr. Mandy Mangler bei BUNTE VIP GLOSS. — Über unsere Expertin: Prof. Dr. Mandy Mangler (Jahrgang 1977) ist Chefärztin an zwei Berliner Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe, spezialisiert auf operative Verfahren und gynäkologische Onkologie. Sie unterrichtet im Studiengang „Hebammenwissenschaft“ an der Evangelischen Hochschule Berlin und engagiert sich als Vorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsmedizin Berlin sowie der Berliner Chefärztinnen und Chefärzte (BLFG e. V.). Bekannt ist sie zudem als Host des Podcasts „Gyncast“. Für ihren Einsatz für Gleichstellung und Diversität in der Medizin wurde sie 2022 mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet. Mandy Mangler ist Mutter von fünf Kindern und lebt mit ihrem Partner in Berlin. — Hier findet ihr alle Informationen zu unseren Podcast-Partnern: https://www.wonderlink.de/@buntevipgloss-partner — Ein BUNTE Original Podcast.
Wed, 04 Jun 2025 04:00:00 +0000 https://sybillefreund.podigee.io/210-mfm 75f9075b174ac53846cf8e3466934a3c Wir wollen es gern einfach haben. Vorgekochtes Essen, das man nur schnell in der Mikrowelle für 30 Sekunden erwähnen muss, Pillen statt Änderung der Lebensweise - und jetzt neu: sich selbst amplifizierende Impfstoffe! Sie liefern nicht nur (wie die bisherigen modRNA-Impfstoffe) die Bauanleitung für das Spike-Protein und veranlassen den Körper, es herzustellen und dann dagegen Antikörper zu produzieren. Selbst amplifizierende Impfstoffe enthalten zusätzlich auch den Code zur massenhaften Vervielfältigung dieser „Spike-Maschinen“. Was das soll? Man erhofft sich eine längere, stabilere Produktion von Spike-Proteinen, in der Folge eine intensivere Immunreaktion des Körpers und so eine stärkere Schutzwirkung. Der erste dieser neuartigen Impfstoffe wurde ohne langwierige Sicherheitsprüfungen in der EU zugelassen. Dr. med. Sybille Freund und Volker Pietzsch schauen sich das kritisch an. Alle Folgen von ‚Medizin für Mitdenker“ und ein ausführliches Stichwortverzeichnis finden Sie unter https://doktorfreund.de/podcast 210 full no Dr. med. Sybille Freund
#66 Impfmythen im Faktencheck - mit Kinderarzt Dr. Florian Babor
Impfungen sind ein sensibles Thema vor allem, wenn es um unsere Kinder geht. In dieser Folge räumen Tati und Felix gemeinsam mit Kinderarzt und Podcaster Dr. Florian Babor mit Mythen auf, die sich hartnäckig halten. Vom angeblichen Zusammenhang mit Autismus über die Sorge vor einer „Überlastung“ des kindlichen Immunsystems bis hin zu Impf-Fragen bei Neurodermitis. Ihr erfahrt, warum Impfungen so wichtig sind, welche Schutzwirkung sie haben und worauf ihr bei akuten Hautschüben achten solltet.
ArchivWare om 16.09.2022 - Die lange Nacht der Masken - Ein Symposium
Die lange Nacht der Masken – wird in der Tat ein kulturelles Event, wenn man Kultur im weiten Sinne fasst und kulturell betrachtet, wie der Mensch in seiner Gesellschaft das Leben, das Zusammenleben gestaltet. Die lange Nacht der Masken wird kein venezianischer Maskenball, eher ein medizinisches Symposium. Der Anspruch ist, tatsächlich wissenschaftlich und evidenzbasiert das Thema Masken und deren Schutzwirkung bzw. Schädlichkeit zu erörtern. Über zwanzig Experten aus Medizin und Recht suchen unter der Überschrift „Die Masken – Schutz oder Unterwerfung“ am 22. September von 18 bis 23 Uhr nach Antworten. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland, das am 8.9.2022 verabschiedet wurde, sieht u.a. erneut eine bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr, in Arztpraxen und Krankenhäusern vor. Hinzu kommt die Möglichkeit für die Bundesländer, je „nach Gusto“ entscheiden zu können, dies auch in Schulen und öffentlichen Gebäuden vorzuschreiben. Aber: Wen wollen und können die Organisatoren des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie außerhalb der ohnehin kritischen Blase mit ihrem Symposium erreichen? Gibt es neue Erkenntnisse? Darüber hat sich unsere Kollegin Andrea Drescher mit dem Mitorganisator Ronald Weikl unterhalten: Den Link zur kostenfreien Teilnahme und nach dem Symposium auch das Material finden Sie in Kürze auf der Seite des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie: https://www.mwgfd.de/ #Corona #Maskenpflicht #Masken #FFP2 #OPMasken #mwgfd #RonnyWeikl #AndreaDrescher #Totraum #co2 #Sauerstoff #Stoffwechsel #RadioMünchen www.radiomuenchen.net/ @radiomuenchen www.facebook.com/radiomuenchen www.instagram.com/radio_muenchen/ twitter.com/RadioMuenchen Radio München ist eine gemeinnützige Unternehmung. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. GLS-Bank IBAN: DE65 4306 0967 8217 9867 00 BIC: GENODEM1GLS Bitcoin Cash (BCH): qqdt3fd56cuwvkqhdwnghskrw8lk75fs6g9pqzejxw Bitcoin (BTC): 3G1wDDH2CDPJ9DHan5TTpsfpSXWhNMCZmQ Ethereum (ETH): 0xB41106C0fa3974353Ef86F62B62228A0f4ad7fe9
Schuldrecht AT - Folge 23: Schuldübernahme, Vertrag zugunsten Dritter und Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Noch § 15 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Abtretung (§§ 398 ff BGB): Gesetzlicher Forderungsübergang (cessio legis); Schuldübernahme: Befreiende (privative) Schuldübernahme (§§ 414 ff BGB): Voraussetzungen und Rechtsfolgen, Erfüllungsübernahme; Kumulative Schuldübernahme oder Schuldbeitritt, Vertragsübernahme; Vertrag zugunsten Dritter (§§ 328 ff BGB); Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Voraussetzungen, Rechtsfolgen, Beispiele
Schuldrecht AT - Folge 24: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte; Schuldnermehrheiten
Noch § 15 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Beispiele, Vorverlagerung in das Vertragsanbahnungsverhältnis (§ 311 III BGB); § 16 Gläubiger- und Schuldnermehrheiten: Schuldnermehrheit (§ 420 ff BGB): Teilschuld (§ 420 BGB), Gesamtschuld (§ 421 BGB), "Gesamthandsschuld", Problem der gestörten Gesamtschuld
Schuldrecht AT - Folge 26: Der Inhalt von Schadensersatzansprüchen, Drittschadensliquidation
Noch § 17: Der Inhalt von Schadensersatzansprüchen (Schadensersatzrecht): Herstellungsinteresse, (sekundäres) Wertinteresse, Ersatz immaterieller Schäden, Bereicherungsverbot (§ 255 BGB), Haftungsausfüllende Kausalität; Drittschadensliquidation: Konstellation, Die zufällige Schadensverlagerung, Typische Fallkonstellationen, Folge, Abgrenzung zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte § 1 Überblick über die Vorlesung Schuldrecht, Besonderer Teil
Neuer Impfstoff gegen Malaria – Wirksamer und billiger als bisher
Etwa 450.000 Kinder weltweit sterben jedes Jahr an Malaria, vor allem in Afrika. Besonders betroffen sind unter 3-Jährige. Bislang ist ein Impfstoff für Kinder auf dem Markt, dessen Schutzwirkung aber nicht sehr hoch ist. Jetzt wird ein neuer Impfstoff getestet, der wirksamer und günstiger ist.
IME012: Culpa in Contrahendo (cic), Linoleum-Fall, Salatblatt-Fall, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (§§ 278, 311 II, III, 328, 831 BGB)
Irgendwas mit Examen Folge 12: Taucht ein in die komplexe Welt der vorvertraglichen Haftung in dieser brandneuen Episode. Wie funktioniert die culpa in contrahendo (c.i.c.) und wie wird sie in der Klausur geprüft? Wir besprechen die berühmten Linoleum- und Salatblatt-Entscheidungen, um die Konzepte und Anwendungen der vorvertraglichen Haftung herzuleiten. Wie wird die Haftung bei einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter gehandhabt und welche Rolle spielen die §§ 278, 311 II, III, 328, 831 BGB in diesem Kontext? Gemeinsam mit Prof. Dauner-Lieb entschlüsseln wir die komplizierten Haftungsmechanismen, zeigen auf, wie sie sich auf verschiedene Vertragsarten auswirken und geben Euch ein tieferes Verständnis über die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Wie immer wird Systemverständnis großgeschrieben und ihr erhaltet nach dem Podcast ein klares und präzises Verständnis der Thematik. Packt Eure Gesetzesbücher aus, macht es Euch gemütlich und bereitet Euch auf eine intensive Lernsession vor. Viel Spaß beim Zuhören!
Stoßstangen für Automobile waren bis Ende der 1920er Jahre ein Zubehör, das extra bestellt werden musste. Und es gab auch erstmal nur welche für vorne. Große Schutzwirkung hatten die Dinger eh nicht. Die Stoßfänger der Gegenwart sollen sogar Verletzungen bei Fußgängern oder Radfahrern minimieren können.
Schuldrecht AT - Folge 23: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte; Schuldner- und Gläubigermehrheiten
Noch § 15 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Voraussetzungen, Rechtsfolge, Beispiele, Vorverlagerung in das Vertragsanbahnungsverhältnis (§ 311 III BGB); § 16 Gläubiger- und Schuldnermehrheiten: Schuldnermehrheit (§ 420 ff BGB): Teilschuld (§ 420 BGB), Gesamtschuld (§ 421 BGB), "Gesamthandsschuld", Problem der gestörten Gesamtschuld; Gläubigermehrheiten
Schuldrecht AT - Folge 25: Drittschadensliquidation
Noch § 17 Der Inhalt von Schadensersatzansprüchen (Schadensersatzrecht): Drittschadensliquidation: Konstellation, die zufällige Schadensverlagerung, Folge, Abgrenzung zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Schuldrecht AT - Folge 22: Schuldübernahme, Vertrag zugunsten Dritter und Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Noch § 15 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Schuldübernahme (§§ 414 ff BGB), Erfüllungsübernahme, Kumulative Schuldübernahme oder Schuldbeitritt, Vertragsübernahme; Vertrag zugunsten Dritter (§§ 328 ff BGB); Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Meditation | Lade das Licht in dein Zuhause
Auf die Plätze. Glücklich. Los. - Der Podcast mit 5 Minuten Impulsen für deinen glücklichen Alltag.
Heute gibt es Teil zwei von der Reinigung deines Zuhause. In der letzten Folge haben wir deine Wohnung geräuchert und über das räuchern Neues eingeladen. Um diese Schutzwirkung zu verstärken, möchte ich heute eine Meditation mit dir teilen. Diese Meditation hilft dir...
Die lange Nacht der Masken – wird in der Tat ein kulturelles Event, wenn man Kultur im weiten Sinne fasst und kulturell betrachtet, wie der Mensch in seiner Gesellschaft das Leben, das Zusammenleben gestaltet. Die lange Nacht der Masken wird kein venezianischer Maskenball, eher ein medizinisches Symposium. Der Anspruch ist, tatsächlich wissenschaftlich und evidenzbasiert das Thema Masken und deren Schutzwirkung bzw. Schädlichkeit zu erörtern. Über zwanzig Experten aus Medizin und Recht suchen unter der Überschrift „Die Masken – Schutz oder Unterwerfung“ am 22. September von 18 bis 23 Uhr nach Antworten. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland, das am 8.9.2022 verabschiedet wurde, sieht u.a. erneut eine bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr, in Arztpraxen und Krankenhäusern vor. Hinzu kommt die Möglichkeit für die Bundesländer, je „nach Gusto“ entscheiden zu können, dies auch in Schulen und öffentlichen Gebäuden vorzuschreiben. Aber: Wen wollen und können die Organisatoren des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie außerhalb der ohnehin kritischen Blase mit ihrem Symposium erreichen? Gibt es neue Erkenntnisse? Darüber hat sich unsere Kollegin Andrea Drescher mit dem Mitorganisator Ronald Weikl unterhalten: Den Link zur kostenfreien Teilnahme und nach dem Symposium auch das Material finden Sie in Kürze auf der Seite des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie: https://www.mwgfd.de/
Sonnencreme: 6 Tipps vom Hautarzt: richtig anwenden. Dr. Kasten Hautmedizin in Mainz
Bei der Anwendung von Sonnencreme sind einige wichtige Punkte zu beachten. Sonst ist die Schutzwirkung deutlich herabgesetzt. Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz, gibt Ihnen hier sechs wichtige Tipps für eine wirksame Anwendung.
Folge 8 • Vertrag mit Schutzwirkung und Mietrecht
Rücktritt nach § 324 BGB; Abgrenzung § 273 / § 320 BGB Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter Mietrecht
Was ist ein Vertrag zugunsten Dritter? Was ist ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter? Und was versteht man unter einer Drittschadensliquidation? (03:07) Rückblick auf die vorangehende Einheit (Gläubiger- und Schuldnermehrheit) (21:51) Vertrag zugunsten Dritter (32:15) Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall (43:05) Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (59:46) Drittschadensliquidation
Antibiotika können Schutzwirkung von Impfungen bei Kleinkindern reduzieren
Offenbar haben Impfungen bei Kleinkindern, die Antibiotika eingenommen haben, eine geringere Schutzwirkung entwickelt. Das berichten Wissenschaftler*innen aus den USA, die 560 Kinder von sechs bis 24 Lebensmonaten regelmäßig untersucht und beobachtet haben. Martin Gramlich im Gespräch mit Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Schwalben haben schon lange eine enge Beziehung zu den Menschen, da sie in unserer Gegend fast nur in Häusern leben. Häuser sind "Kunstfelsen" mit besonderer Schutzwirkung vor natürlichen Feinden. Mit dem Rückgang der offenen Ställe geht auch die Zahl der Schwalben im bäuerlichen Umfeld zurück.
Therapietreue – Muss ich nur Medikamente nehmen, wenn die MS aktiv ist? #132
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Prof. Dr. Mathias Mäurer erklärt, wie die MS funktioniert, wie man sie am besten unter Kontrolle bekommt und wie Therapietreue schützt. Hier geht es zum Blogbeitrag: https://ms-perspektive.de/therapietreue-bei-ms/ Willkommen zu Folge #132 vom MS-Perspektive-Podcast. Heute begrüße ich erneut Prof. Dr. Mathias Mäurer zu Gast im Interview. Wir sprechen über die Bedeutung der verlaufsmodifizierenden Therapie und wie wichtig es ist, seine Therapie auch langfristig so durchzuführen, wie es gedacht ist. Gerade im Social Media Bereich gibt es leider so einige Influencer, die zwar Patienten, aber eben keine Experten auf dem Gebiet der Behandlung von MS sind und Empfehlungen aussprechen, die wissenschaftlich betrachtet kompletter Unfug sind. Diese Folge soll helfen, wissenschaftlich basierte Fakten einfach verständlich zu erklären und Dir auf Deinem Weg mit der Erkrankung sinnvolle Tipps mitzugeben. Inhaltsverzeichnis Begrüßung Was passiert denn genau im Körper, wenn die MS aktiv ist? Wie viel von dieser Aktivität spürt man denn als Patient bewusst im schubförmigen Verlauf? Verkürzt die Kortison-Stoßtherapie vor allem die Dauer eines Schubes oder hat sie einen Einfluss auf die Langzeitprognose? Gibt es einen Unterschied was die Langzeitprognose angeht, bei der Blutwäsche? Können Sie bitte erklären, was man genau mit der verlaufsmodifizierenden Therapie erreichen will? Und wie sie wirkt? Was bedeutet denn genau Therapietreue? Welche medizinisch sinnvollen Gründe gibt es, eine verlaufsmodifizierende Therapie zu wechseln oder gar auszusetzen? Welche Therapieoptionen haben Frauen mit Kinderwunsch, die eine aktive MS haben? Was passiert denn, wenn ich eine aktive MS mit einer verlaufsmodifizierenden Therapie zum Stillstand gebracht habe und denke, jetzt ist alles gut und jetzt setze ich die Medikamente ab? Welche Risiken sind mit einem wiederholten Wechsel von Therapie und Therapieabbruch verbunden? Welcher Prognose sehen Menschen entgegen, die die MS mit, in Anführungsstrichen, nur einer gesunden Lebensweise eindämmen wollen? Wie sieht die Prognose von MS-Patienten aus, die eine wirksame Therapie nutzen, wo wirklich die Aktivität komplett unterdrückt wird, auch im subklinischen Bereich? Wie umkehrbar sind Spätfolgen, die sich im progredienten Verlauf der MS zeigen, nach aktuellem Stand der Forschung und Behandlungsoptionen? Sind Ihnen denn schon Patienten begegnet, die ihre frühere Entscheidung gegen verlaufsmodifizierende Medikamente bereut haben? Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben zum Schluss? Begrüßung Nele Handwerker: Hallo Herr Professor Mäurer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und heute den Hörerinnen und Hörern noch mal was zum Thema Therapietreue sagen. Muss ich nur Medikamente nehmen, wenn die MS aktiv ist? Danke, dass Sie sich so spontan Zeit genommen haben. Prof. Mathias Mäurer: Ja, sehr gerne, Frau Handwerker. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich auf Ihre Fragen. Nele Handwerker: Wer Professor Mäurer nicht kennt, er hat einen Master of Health Business Administration, ist Chefarzt der Neurologie und neurologischen Frührehabilitation am Klinikum Würzburg Mitte, am Standort Juliusspital. Und ich hatte ihn schon mal zu Gast, In Folge 89 hat er sich ein kleines bisschen mehr vorgestellt. Hör gerne noch mal in die Folge rein. Aber kommen wir zu dem, worum es heute geht. Was passiert denn genau im Körper, wenn die MS aktiv ist? Prof. Mathias Mäurer: Ja, also letztlich ist der Schub ja an sich das, was die MS ausmacht. Den merkt der Patient und danach richtet sich natürlich so ein bisschen das, wie die MS bewertet wird. Aber im Endeffekt muss man natürlich sagen, was die MS wissenschaftlich ausmacht, ist die Attacke des Immunsystems auf das zentrale Nervensystem. Das kann nicht nur im Sinne von Schüben manchmal passieren, sondern wir haben generell eine entzündliche Aktivität, die wir teilweise nur im Kernspintomogramm sehen. Man kann ungefähr rechnen, dass auf einen klinischen Schub circa zehn Läsionen in der Kernspintomographie kommen. Das heißt, der Schub alleine ist jetzt kein unbedingt ausreichender Maßstab, um die Aktivitäten der MS zu bewerten, sondern meistens ist es die Kombination aus dem, was klinisch passiert, der Kernspintomographie und dem, wie sich der Patient fühlt. Da werden ja auch teilweise bei uns Screening Methoden gemacht wie die Gehstrecke, das Stäbchen stecken oder auch kognitive Tests, und Fatigue-Skalen, wo man insgesamt bewerten kann, wie aktiv die Erkrankung zum Zeitpunkt ist. Nele Handwerker: Hmm, okay. Genau dieses 1:10, das kannte ich auch. Das hatte mich damals auch ein bisschen schockiert, aber auch sofort davon überzeugt, dass ich besser was gegen die MS bei mir unternehmen sollte. Wie viel von dieser Aktivität spürt man denn als Patient bewusst im schubförmigen Verlauf? Nele Handwerker: Also Sie haben es jetzt schon im Prinzip gesagt und im verborgenen…. Prof. Mathias Mäurer: Ja, wobei ich, ich kann es gerne auch noch so ein bisschen spezifizieren. Es ist ja tatsächlich so, das zentrale Nervensystem ist groß. Gerade das Gehirn hat natürlich Regionen, wo es Stellen gibt, wo Sie Entzündungen haben können, ohne das jetzt direkt zu merken. Also Sie merken die Entzündung in der Regel meistens nur dann, wenn Sie einen Entzündungsherd in einer eloquenten Region haben. Unter eloquent verstehen wir Regionen, die wirklich klar einer Funktion zugeordnet sind. Also wenn Sie irgendwo in einer motorischen Bahn was haben, dann haben Sie eine Lähmung. Wenn Sie im Sehnerv was haben, sehen Sie nichts. Aber wenn das irgendwo im Parietallappen liegt oder irgendwo periventrikulär , dann müssen Sie nicht unbedingt von einer entzündlichen Aktivität was merken. Es gibt Theorien, dass man sagt, dass vielleicht die Fatigue sozusagen auch so eine Art, ja, Summenmarker für Entzündungsaktivität ist. Also wenn Patienten auch merken, sie fühlen sich irgendwie doch sehr leistungsgemindert, dass es unter Umständen auch ein Zeichen dafür sein kann, dass sich da irgendwas tut. Aber in der Regel können gerade Läsionen im Gehirn selber häufig stumm sein. Im Rückenmark merkt man sie eher, weil da viele wichtige Bahnen eng beieinander liegen. Aber im Gehirn selber ist es manchmal als Patient gar nicht wahrscheinlich, dass man merkt, was da passiert. Nele Handwerker: Passt genau zu dem, was ich erlebt habe, auch wenn mein einer Fall nicht statistisch relevant ist. Bevor ich mit einer Therapie begonnen habe, hatte ich mit der Fatigue total Probleme. Nachdem meine Therapie nach drei Monaten gegriffen hat, hat sich zum Glück alles zurückentwickelt. Da geht es auch so ein bisschen um die neurologische Reserve. Das Gehirn hat gewisse Kapazitäten zum Umbauen und wenn die aufgebraucht sind, rutscht man in den chronischen Verlauf. Prof. Mathias Mäurer: Genau, die Sache mit der neurologischen Reserve oder Brain Reserve, wie es auch genannt wird, in der Fachliteratur, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das muss man sich eben auch vor Augen halten, dass man natürlich als junges Gehirn, und bei vielen MS-Patienten fängt die Erkrankung ja doch in sehr jungen Jahren an, eine extrem große Kompensationsreserve hat. Also man kann vieles was dann passiert, gerade in den jungen Jahren, einfach wegstecken. Und dadurch letztlich zwischen den Schüben überhaupt nichts merken. Man fühlt sich vielleicht bis auf die Fatigue relativ gesund. Es gibt aber sehr schöne Studien. Ich weiß nicht, ob ich die mal schildern darf. Das ist so funktionelle Kernspintomographie, wo man letztlich sehen kann, wie viel Hirn muss eigentlich jemand aktivieren, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen. Da gibt es sehr schöne Untersuchungen. Bei einem Gesunden, wenn der eine Bewegung macht, dass Finger so hin und her tappen, da wird im Prinzip nur der motorische Cortex und ein paar prämotorische Areale aktiviert. Wenn das gleiche ein MS-Patient macht und der muss überhaupt nicht irgendwie im Bereich der Handfunktion betroffen sein, das reicht, wenn es jemand war, der eine Sehnervenentzündung hatte und vielleicht ein paar entzündliche Flecken, dann sieht man, dass der für die selbe Motoraufgabe letztlich viel mehr Hirnsystem aktivieren muss. Das heißt, der nutzt schon viel mehr von seiner Reserve um das gleiche auszuführen. Ich vergleiche das immer mit so einem Motor, der letztlich viel, viel höher dreht als der Motor von einem Gesunden. Und genauso wie beim Auto, wenn Sie das lange machen, dann haben Sie irgendwann einen Motorschaden. Und das ist es, was bei der MS passieren kann. Wenn sie lange immer wieder ihre Kompensationsfähigkeit belasten, ist sie irgendwann aufgebraucht. Und in dem Moment merkt man die MS dauerhaft. Und das ist häufig, aber erst im mittleren Lebensalter der Fall. Sprich, derjenige, der die MS früh bekommt und seine Reserve aufbraucht, weil er halt sonst nichts machen möchte, der wird nach einer gewissen Zeit in Schwierigkeiten laufen. Jetzt ist mir auch ganz wichtig, ich möchte nicht mit Ketten rasseln, weil das immer ein bisschen doof ist, wenn man mit irgendwelchen Konsequenzen droht. Nicht jede MS ist gleich und das heißt nicht bei jedem, wenn er jetzt, sagen wir mal, therapeutisch komplett ablehnend ist, dass das gleich im Desaster landen muss. Aber es gibt halt, sagen wir mal, vielleicht so prozentual allenfalls 20 bis 30 %, die auch da Glück haben mit der Erkrankung. Bei der überwiegenden Mehrzahl läuft es halt doch so, wie ich es sage, ja, dass man eben unter Umständen in Probleme reinläuft, wenn man das System zu sehr stresst. Nele Handwerker: Und das ist dann schon arg, quasi Roulette spielen mit der eigenen Gesundheit. Jetzt kommen wir mal zur Kortison-Stoßtherapie. Ich habe oft genug von Leuten gehört, die denken, dass es ganz wichtig ist, super hilft, und auch die Langzeitprognose positiv beeinflusst. Verkürzt die Kortison-Stoßtherapie vor allem die Dauer eines Schubes oder hat sie einen Einfluss auf die Langzeitprognose? Prof. Mathias Mäurer: Es gibt keine verlässlichen Studien, die irgendwie zeigen, dass Kortison an der Langzeitprognose der Multiplen Sklerose was macht. Das hat sich nie in Studien wirklich beweisen lassen. Es ist noch nicht mal so, dass man jetzt unbedingt sagen kann, dass Kortison auch im Schub irgendwas macht. Es gibt sogar Arbeiten, also im Tiermodell, die zeigen, dass Kortison schädlich sein kann bei einer Opticus Novartis. Wir gehen davon aus, dass Kortison schon in der Lage ist, gerade hoch dosiert, bestimmte Entzündungszellen in den programmierten Zelltod zu schicken. Also dass die Entzündungszellen Selbstmord begehen, und dass dieser Selbstmord, relativ positiv ist für die Entwicklung des Schubes. Aber eben nur als Akutmaßnahme und sicherlich nicht als Langfrist-Maßnahme. Ich weiß, dass viele Patienten auf diese wiederholten Kortisonstöße schwören, gerade auch in späteren Krankheitsphasen. Das hat aber unter Umständen damit zu tun, dass Kortison auch ein bisschen euphorisierend wirkt, dass es anti-spastisch wirkt und dass es natürlich so einen doch kurzen Effekt hat, das man sich besser fühlt. Aber diese langfristigen Effekte, die manche auch propagieren, die sind wirklich nie bewiesen worden. Also man kann das Kortison, und das machen wir ja auch im akuten Schub, natürlich einsetzen und das ist auch eine wichtige therapeutische Maßnahme, aber für die Langzeitprognose der Erkrankung und für den Langzeitverlauf zählt eigentlich nur die immunmodulatorische Therapie und da zählt das Kortison gar nicht dazu. Weder als Hochdosis und schon gar nicht als orale Dauertherapie. Auch diese Meinung ist manchmal noch anzutreffen und da schlage ich immer die Hände über dem Kopf zusammen. Weil das, was wir bei der MS machen, das funktioniert ja auch nur bei diesen wirklich sehr, sehr hohen Dosen. Kortison niedrig dosiert, da nimmt man nur die Nebenwirkungen mit und hat eigentlich diesen Vorteil, dass man Entzündungszellen in den programmierten Zelltod schickt überhaupt nicht. Da braucht man Hochdosis-Konzepte dafür und nicht diese niedrig dosierten oralen Konzepte. Also ich würde ganz klar propagieren Kortison bitte aus der Liste der Langzeitprophylaxen komplett streichen. Das ist eine Schubtherapie. Nele Handwerker: Ja. So hatte ich es auch verstanden. Aber Ihre Erläuterungen dazu sind nochmal sehr wertvoll. Gibt es einen Unterschied was die Langzeitprognose angeht, bei der Blutwäsche? Nele Handwerker: Wenn man die vornimmt, ist da schon irgendwas klar? So lange wird die Blutwäsche ja noch nicht eingesetzt. Prof. Mathias Mäurer: Ja, also das ist gar nicht so einfach zu beantworten die Frage. Es gibt natürlich bestimmte MS-Pathologien, wo auch Antikörper eine Rolle spielen. Das kann man aber im Moment jetzt noch nicht unbedingt von außen festlegen. Deswegen ist es so, die Blutwäsche spielt dann eine Rolle, wenn die Kortisontherapie in einem Schub keine deutliche Verbesserung bringt. Das Schema ist ja so, dass man erst mal einen Kortisonstoß geben soll. Wenn das nicht zu einer Verbesserung führt, dann kann man so nach ein zwei Wochen entweder den Steroidschuss wiederholen oder alternativ die Blutwäsche einsetzen. Und wenn man da sehr gute Erfolge dann hat, dann ist es unter Umständen auch bei den nächsten Schüben sinnvoll man fängt gleich mit der Blutwäsche an, weil dann scheinbar die Antikörperpathologie im akuten Schub eine größere Rolle spielt als die T-Zell-Pathologie. Wahrscheinlich ist es bei jedem irgendwo eine Mischung sein. Aber vermutlich gibt es individuell Unterschiede, wie viel Anteil pathologische Antikörper im Schub haben, um eine Funktionsstörung hervorzurufen und wie viele Anteile die zelluläre Immunität hat. Das ist dann leider ein bisschen Versuch und Irrtum. Man kann nicht von außen vorhersagen, wer auf was besser anspricht. Deswegen ist es zumindest bei den ersten schweren Schüben immer Versuch und Irrtum. Aber da die Blutwäsche ein bisschen invasiver ist als die Kortisongabe, man braucht ja in der Regel einen sehr großvolumigen Katheter in der Jugularvene, das ist nicht so angenehm, wird man das nicht bei milder Schubsymptomatik machen. Das sind Maßnahmen, die für schwere Schübe mit Erblindung, mit schwerer motorischer Störung, mit einer schweren Gleichgewichtsstörung vorbehalten sind. Wenn es nur kribbelt, verzichtet man auf Blutwäsche. Das wissen vielleicht auch viele Zuhörer, so ein sensibler Schub, der kann manchmal hartnäckig sein und länger dauern, bis er wirklich komplett weggeht. Kortison ist k eine Garantie dafür, dass das Kribbeln weggeht. Da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Denn wir müssen immer Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen, auch in der Schubtherapie. Deswegen die Blutwäsche hat eine wichtige Bedeutung, vor allen Dingen eben bei schweren Schüben, wenn das mit dem Kortison nicht so klappt, wie man es sich wünscht. Nele Handwerker: Ja, so war es bei mir auch. Ich hatte vor Therapiebeginn einen Sensibilitätsschub. Da wurde nichts gemacht, sondern einfach gesagt, okay, jetzt bitte die verlaufsmodifizierende Therapie beginnen, weil beim Abwägen von Nutzen und Risiko, entschwieden wurde auf Kortison zu verzichten. Und die Blutwäsche habe ich zum Glück bisher noch nicht benötigt. Meine Therapie wirkt. Prof. Mathias Mäurer: Ja, das ist tatsächlich eine Methode, die eher seltener angewandt wird auf die Gesamtzahl von Schüben. Wie gesagt, die meisten Schübe der MS sind ja so, dass man sie unter Kontrolle kriegt. Und häufig haben sie nicht so ein ganz extremes Ausmaß. Nele Handwerker: Ja, zum Glück. Jetzt haben Sie schon die verlaufsmodifizierende Therapie angesprochen. Können Sie bitte erklären, was man genau mit der verlaufsmodifizierenden Therapie erreichen will? Und wie sie wirkt? Prof. Mathias Mäurer: Na ja, alle verlaufsmodifizierenden Therapien, also die ganze Palette von, ich glaube, jetzt mehr als 17 Medikamenten, die wir haben, sind Medikamente, die versuchen das Immunsystem ein wenig zu unterdrücken. Also MS ist ja eine Erkrankung, wo kein Immundefekt vorliegt, im Gegenteil, MS-Patienten haben eher ein Immunsystem, was ein bisschen zu gut funktioniert. Und alle diese Medikamente versuchen dieses etwas zu gut funktionieren wegzunehmen, die Spitzen wegzunehmen, und dennoch die normale Immunfunktion zu erhalten. Das Prinzip ist letztlich bei allen das Gleiche, das Immunsystem auf irgendeine Art und Weise zu beruhigen. Und da gibt es verschiedene Strategien. Unterschiedliche Wirkstoffklassen haben unterschiedliche Ansätze. Grundsätzlich ist es so, dass man versucht, diese Überaktivität des Immunsystems langfristig runterzufahren. Und das ist genau das, was dabei hilft, dass es nicht zu Attacken auf das zentrale Nervensystem kommt und das auch die subklinische Krankheitsaktivität unterbunden wird, die man vielleicht als Patient gar nicht merkt. Letztlich geht es langfristig darum, Entzündungsaktivität, egal ob das jetzt Schübe sind oder neue MRT-Läsionen möglichst effizient zu unterdrücken. Nele Handwerker: Und damit auch die neurologische Reserve zu schonen, damit es dann bitte nie in den chronischen Verlauf übergeht. Prof. Mathias Mäurer: Genau, Sie können jetzt nämlich eigentlich fragen, ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt selten Schübe habe und vielleicht auch gar nicht so viele MRT-Läsionen, ist das dann wirklich sinnvoll, so was auch zu machen? Das Problem ist, dass wir mittlerweile ganz gut wissen, dass diese Entzündungseinwirkungen auf das Gehirn auch am Hirngewebe selber wahrscheinlich irgendeine Art von, ich sage mal, Sollwertverstellung macht. Also irgendwie wissen wir, dass wohl die ortständigen Entzündungszellen im Gehirn anfangen überzureagieren. Und dass es dann sogar unabhängig von Schüben, die ja von außen, also im peripheren Immunsystem getriggert werden, auch im Hirn selber eben gewisse Veränderungen des ortständigen Immunsystems gibt. Wir haben vor allen Mikrogliazellen im Verdacht, dass sind so ortständige antigenpräsentierende Zellen, Unterstützungszellen für Entzündungszellen, dass die anfangen so ein bisschen durchzudrehen. Und die drehen umso mehr durch, je mehr man letztlich auch Entzündungsreaktionen hat einwirken lassen. Man hat im Moment schon die Ahnung, dass das wahrscheinlich bereits mit Beginn der Erkrankung losgeht, diese Gefahr, dass man so eine, ja, wir nennen das Entzündung im Hirnkompartement selber bekommt. Deswegen bin ich ein Freund davon, auch wenn das sich am Anfang vielleicht harmlos anlässt, so eine MS, von Anfang an wirklich sehr, sehr konsequent zu therapieren, weil die Konsequenzen wahrscheinlich noch umfangreicher sind, als wir bisher gedacht hatten. Und der Nutzen, den man gerade früh erreichen kann, der scheint noch größer zu sein, als wir bisher gedacht haben. Ich bin wirklich dafür, von Anfang an Therapien zu empfehlen. Und dieses ‚Watch and Wait‘ ist nicht mein Ding, ja, weil ich einfach die MS doch als ernsthafte Bedrohung für die langfristige Gesundheit sehe. Nele Handwerker: Ich auch. Und diese Aufklärung, wie sie es gerade machen, ist mit ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Prof. Mathias Mäurer: Wie gesagt, am Anfang wird das alles gut weggesteckt. Am Anfang ist das kein Problem. Da tut man die paar Schübe, die paar Entzündungsläsionen mit seiner Hirnreserve relativ gut kompensieren, also ungeschehen machen. Aber man verbraucht natürlich einen Kredit. Und das halte ich für sehr gefährlich. Deswegen ist mein Ansatz, bei allem, sagen wir mal Verständnis, dass man natürlich als junger Mensch nicht unbedingt dauerhaft Medikamente nehmen will oder dass man auch Angst hat, sich da irgendwie zu belasten oder unnötige Nebenwirkungen einzukaufen, dass man eben nicht vergessen soll, dass dagegen durchaus eine Bedrohung von einer Erkrankung steht, die einem im Laufe des Lebens einfach Ärger machen kann. Und man ist ja nicht immer 20. Also ich kann es jetzt sagen, man möchte auch mit Mitte 50 noch ein gutes Leben haben. Und nicht unbedingt an irgendwelchen Symptomen leiden, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Auch eine Blasenstörung kann einem das Leben vermiesen zu dem Zeitpunkt. Und wenn eine Chance hat, das zu unterdrücken, dann würde ich die nehmen und würde mich nicht auf irgendein Achtsamkeitsgeschwurbel einlassen, dass man auf die Therapie auch verzichten kann und dass man selber entscheiden kann. Natürlich kann man selber entscheiden, was man macht, aber bitte auf einer Wissensbasis entscheiden und nicht auf irgendeinem Blödsinn, der verbreitet wird. Oder was, was man sich vielleicht selber ausdenkt oder sich von irgendwelchen Influencern im Internet abgeguckt hat. Bitte mal die Fachliteratur lesen. Ich bin total liberal, wenn ich merke, der Patient hat sich sorgfältig informiert und trifft die Entscheidung wirklich auf einer informierten Basis. Da gehe ich mit. Weil letztlich jeder für sich selber entscheiden muss. Aber wo ich echt aggressiv werde ist, wenn man mir irgend so einen Scheiß erzählt, der überhaupt keinerlei Entsprechung hat in dem, was wir wissenschaftlich im Moment wissen. Irgendein Mist, der so mit Allgemeinplätzen und, ja, ich sag mal, Wellness-Blabla bestückt ist. Also da kann ich überhaupt nicht mit. Nele Handwerker: Ja, das habe ich ja auch schon zum Teil angesprochen. Es ist eine Sache, wenn man wissend, sehenden Auges da reinläuft und sagt, ich kann damit leben, dass ich irgendwann mal chronisch belastet sein könnte. Prof. Mathias Mäurer: Oder auch sagt, ich gehe das Risiko ein. Das ist in Ordnung. Aber nicht praktisch mit so einer kompletten Beschränktheit. Also dann erwarte ich schon, wenn man sagt, ich stehe für mich selber ein, dass ich mich dann auch anständig informiert habe. Und anständig informieren heißt eben auch nicht irgendeinem, sagen wir mal, Laien auf den Leim gehen, sondern sich wirklich bei denen informieren, die auch ein bisschen Ahnung haben von dem Thema. Nele Handwerker: Ja, übrigens, was Sie angesprochen haben, ist ja diese ‚Hit Hard and Early‘-Strategie. Für dich da draußen, falls du es noch nicht kennst. Dazu hatte ich eine Folge mit Professor Schwab aufgenommen. Er erklärt darin sehr schön, warum man zeitig mit einer hochwirksamen Therapie einsteigen sollte und das ganze Drumherum. Und ich hatte jetzt neulich erst von einem guten amerikanischen Podcast gehört, dass die eine Studie in Schweden durchgeführt wurde, wo Daten mit Dänemark verglichen wurden. Ähnliche Gesundheitssysteme und Rahmenbedingungen, und wer zeitig und stark einsteigt… Prof. Mathias Mäurer: Ja das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte der skandinavischen Register, die sind ja sehr, sehr gut. Da wird jeder Patient auch sehr sorgfältig eingeschlossen, also die Datenqualität ist super. Und es ist tatsächlich so, dass die Schweden wesentlich aggressiver therapieren als der Rest von Europa. Die haben halt Rituximab für sich entdeckt, also so eine B-Zellen depletierende Therapie, die wird da auch staatlich unterstützt, dass man sie gibt. Und da ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der schwedischen MS-Patienten, die Rituximab kriegen. Ich glaube, um die 34 %, wohingegen in Dänemark mit so einer Therapie nur in knapp 7 % der Fälle begonnen wird. Und wenn man die Dänen und die Schweden einfach so nebeneinander laufen lässt ge-machted, dann haben die Schweden ein wesentlich niedrigeres Progressionsrisiko als die Dänen. Und das ist echt eine gut gemachte Studie. Die finde ich auch von der Anzahl her gut. Es wurde eine hohe Anzahl an Patienten eingeschlossen. Bei anderen Studien gab es immer die Kritik, das sind viel zu wenig Patienten, die ihr da aus den Registern rauszieht, aber bei diesen beiden Registern, das sind schon so knapp 2000 Datensätze, die man miteinander vergleichen kann, das ist schon ein Wort. Und dementsprechend verhärtet sich die Theorie, dass eine konsequente Therapie gleich am Anfang wirklich Sinn macht. Was bedeutet denn genau Therapietreue? Prof. Mathias Mäurer: Ja, also sagen wir mal, man kann das wissenschaftlich als sogenannte Medikation Procession Rate ausdrücken. Praktisch bedeutet es, dass man einfach die eingenommene Medikation mit den Tagen abgleicht, wo sie hätte eingenommen werden sollen. Man sagt eine gute Therapietreue ist, wenn 80 % der Medikation genommen wurde. Mehr wäre wünschenswert, aber man weiß ja, wie das Leben so ist, dass man das nicht immer auf die Reihe kriegt ein Medikament regelmäßig zu nehmen. Und dementsprechend sind wir mit 80 % schon ganz zufrieden. Aber man weiß auch, wenn der Wert unter 80 % fällt, dann kriegt man nicht mehr die volle Wirkung des Medikamentes. Also Therapietreue ist schon ein ganz entscheidender Punkt, weil Medikamente, die nicht genommen werden können nicht wirken. Und natürlich ist es dann auch entscheidend, was habe ich für eine ‚Burden of Therapy‘, also eine Therapiebelastung habe. Die steht immer dagegen. Deswegen sind wir durchaus begeistert von Medikamenten, die nur relativ selten gegeben werden müssen. Wo man eventuell mit halbjährlichen Infusionen oder eben auch mit Tabletteneinnahmen zweimal im Jahr gute Ergebnisse erzielt. Denn da hat man meistens eine sehr hohe Adherenz. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob Tysabri auch gerade deswegen so ein Knaller war als Medikament ist, weil es eben immer von Ärzten gegeben wurde. Schließlich hat man die Patienten somit immer voll unter Kontrolle. Und da war die Therapietreue natürlich wahnsinnig hoch. Wohingegen wir wissen, dass zum Beispiel Interferon, was ja auch unangenehm zu nehmen ist, manchmal nur so eine Medikation Possession Rate von um die 40 % hat. Und da können Sie natürlich die Wirkung vergessen. Also von daher Adhärenz, ist ganz wesentlich. Natürlich entdecke ich manchmal auch dieses Schema. Ich gehe immer davon aus, dass ein Patient sich bemüht, die Medikamenteneinnahme ganz gut zu machen. Dennoch frage ich auch immer nach, ob man es geschafft hat, das einzuhalten. Ich gehe gar nicht davon aus, dass das regelmäßig ist. Jemand, der mir sagt, ich habe es immer genommen, dem glaube ich sowieso nicht, weil das geht nicht. Geht mir auch selber so, ich versage schon bei Antibiotika, die regelmäßig einzunehmen, was ja wirklich wichtig ist und kurz. Von daher fragt man eher, wie viel haben Sie jetzt versäumt oder hat es ganz gut geklappt oder nicht? Und ja, das ist letztlich schon ein wesentlicher Punkt mit der Therapietreue, dass man verhindert, dass dann so Schemata aufkommen wie, ich nehme das nur, wenn es mir schlecht geht. Also wenn man so was entdeckt, dann muss man noch mal ernsthaft miteinander reden, dass das so nicht gedacht ist. Und man kann ja auch über alles reden. Wenn das Schema wirklich zu anstrengend ist für jemanden durchzusetzen, dann muss man schauen, was noch an Alternativen möglich ist. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit zu einer individualisierten Therapie, eben weil wir so viele Präparate haben. Irgendwas wird man finden, was mit dem persönlichen Leben gut vereinbar ist. Aber dieses, ich mach das mal so zwischendurch, wenn es mir nicht so gut geht oder mal nach einem Schub, das geht am Ziel vorbei. Nele Handwerker: Ja, da bin ich doch froh, dass meine Eltern mir klare Linie beigebracht haben. Ich musste mein Medikament die ersten Jahre siebenmal die Woche spritzen, irgendwann wurde das Präparat angepasst und seitdem muss ich mir nur noch dreimal die Woche spritzen. Und ja, ich habe mir dann mal zum Geburtstag frei gegeben oder zu Weihnachten. Aber ansonsten, wenn es ging, nachgeholt. Prof. Mathias Mäurer: Da habe ich auch ganz hohen Respekt, wenn das jemand so durchzieht. Ich finde das schon bewundernswert und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Deswegen, versuche ich meine Patienten immer zu ermuntern, dass sie klar sagen, was sie meinen zu schaffen und was eben nicht. Grundsätzlich ist das, wie wir eben besprochen haben, mit der Therapietreue eine ganz, ganz wesentliche Sache, um auch Therapieerfolge zu erzielen. Und ich finde, jeder Patient hat das Recht zu sagen, ja, das schaffe ich oder das schaffe ich nicht. Es macht ja keiner mir zuliebe. Davon sollte man sich lösen. Mir tut niemand einen Gefallen damit, wenn er seine Medikamente regelmäßig einnimmt. So erwachsen muss man sein, dass man sagt, das ist letztlich für mich. Ich bin nur dafür da, um zu helfen, wie man es möglichst optimal hinbekommt. Welche medizinisch sinnvollen Gründe gibt es, eine verlaufsmodifizierende Therapie zu wechseln oder gar auszusetzen? Nele Handwerker: Es gibt ja bestimmt welche, wo Sie sagen, das ist okay an der Stelle. Prof. Mathias Mäurer: Na ja, wir haben über den Convenience-Aspekt gesprochen. Da darf man natürlich wechseln. Man darf wechseln oder man soll sogar wechseln, wenn das Medikament nicht das macht, was es tun soll. Man darf natürlich auch wechseln, wenn irgendwie Nebenwirkungen nicht beherrschbar sind. Das sind alles Gründe. Und natürlich darf man auch das Absetzen mal ins Feld führen. Wir haben da auch von den Leitlinien schon eine klare Vorstellung, wo man sagen kann, hier kann ich auf ein Medikament verzichten. Also wenn tatsächlich jemand über Jahrzehnte mit einer Basistherapie komplett stabil war und auch nach den initialen Schüben nichts mehr gekommen ist, kann man selbstverständlich auch mit dem Patienten, wenn es dann schon ein höheres Lebensalter ist, über 45, besprechen, dass man es absetzt. Es gibt die Leitlinien die sagen, nach fünf Jahren mit einer moderat wirksamen Therapie kann man darüber sprechen. Ich habe viele gesehen, die dann doch wieder Schübe bekommen haben. Von daher, bin ich da etwas vorsichtiger, auch bei den moderat wirksamen und würde sagen, eigentlich sollte man vor dem 45. Lebensjahr die Diskussion nicht unbedingt beginnen. Aber wenn es in diese Altersklasse geht und die MS war lange stabil und es war jetzt auch keine allzu schwere Verlaufsform, dann kann man darüber reden. Ein bisschen anders ist es bei den hochaktiven Patienten, die von Anfang an eine sehr hohe Krankheitlast gehabt haben, die man nur mit sehr hochwirksamen Medikamenten still bekommt. Da wäre ich insgesamt sehr, sehr zurückhaltend überhaupt abzusetzen, weil das häufig in die Hose geht. Letztlich muss man sich ja auch vor Augen halten, wenn so eine MS stabil ist, die einen als chronische Erkrankung begleitet über zumindest das mittlere Lebensalter, dann hat man genau das erreicht, was man will. Und dann ist das Absetzen zwar ein verständlicher Wunsch, aber eigentlich hat man wahrscheinlich nur durch das Medikament diese Situation erreicht und dementsprechend sollte man es beibehalten. Also ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, aber klar, man kann auch Absetzen besprechen unter bestimmten Voraussetzungen. Nele Handwerker: Also ich kann dazu nur sagen, bei mir war die MS auch lange stabil und ich nutze quasi Medikamentenklasse 1, Basismedikation. In der Schwangerschaft habe ich anderthalb Jahre ausgesetzt und ich hatte nach der Geburt auch eine kleine sensitive Störung und habe meine Therapie dann wieder fortgesetzt. Nun habe ich noch nicht die 45 erreicht. Dreieinhalb Jahre habe ich noch bis dahin. Aber ich persönlich rechne im Moment auch damit, dass ich das bis an mein Lebensende nehme. Und hoffe dann darauf, dass ich dank funktionierender Therapie und gesunder Lebensweise mit 80 Jahren fitter bin als meine Klassenkameraden, die über die Stränge geschlagen haben. Das ist meine Hoffnung. Welche Therapieoptionen haben Frauen mit Kinderwunsch, die eine aktive MS haben? Nele Handwerker: Denn da kenne ich mich wirklich nicht aus. Gibt es da Möglichkeiten von den hochwirksamen Medikamenten oder macht es Sinn zumindest auf eine weniger wirksame Therapie zu wechseln? Wie verträgt sich das? Prof. Mathias Mäurer: Genau, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also in der Regel ist es so, man sollte stabil in eine Schwangerschaft reingehen, weil man weiß, da ist eine ganz gute Korrelation zwischen der Schubhäufigkeit vor Beginn der Schwangerschaft und dem, was man nach Entbindung zu erwarten hat, wo ja manchmal die Schubhäufigkeit auch etwas steigt. Also wenn man stabil reingeht, ist die Chance, dass man auch stabil rauskommt aus der Schwangerschaft ziemlich gut. Und jetzt muss man unterscheiden, es gibt ja wie gesagt auch moderate MS-Formen, die jetzt gar nicht so eine hohe Entzündungsaktivität haben. Bei denen ist die Schwangerschaft meistens auch ausreichend, um die Medikation zu ersetzen, weil die Schwangerschaft per se ja auch ein bisschen immunsublimierend wirkt. Man muss ja das Kind tolerieren, was ja zur Hälfte vom Vater ist, deswegen reguliert sich das Immunsystem selber runter. Und das führt auch dazu, dass man eben mit zunehmender Schwangerschaft immer weniger Schübe bekommt. Man holt das dann zwar statistisch wieder auf in der Perinatalphase. Aber grundsätzlich, wenn man eine moderate MS hat, kann man eigentlich bis zum Eintritt der Schwangerschaft so ein Medikament nehmen und dann setzen es viele ab und das funktioniert mit der Schwangerschaft ganz gut. Ein bisschen anders ist es, wenn man eine sehr hoch aktive MS hat, die nur mit hoch aktiven Medikamenten stabil ist. Zum Beispiel die Frauen, die unter Tysabri sind, das sind ja meistens Frauen, die eine sehr hochaktive MS haben, denen empfehlen wir heutzutage, das Tysabri auch über die Schwangerschaft zu nehmen. Nur kurz vor Entbindung sollte es abgesetzt werden, um danach gleich wieder zu starten. Auch bei Therapien wie Ocrelizumab, die alle halbe Jahr gegeben werden, kann man eigentlich die Schwangerschaft ganz gut mit den Infusionen planen. Man kann letztlich die Schutzwirkung, die man durch diese zyklischen Infusionen hat, so ausnutzen, dass man auch in der Schwangerschaft noch ganz gut protegiert ist. Auch da haben wir mittlerweile ganz gute Konzepte. Nele Handwerker: Super. Schön. Prof. Mathias Mäurer: Deswegen einfach den Neurologen fragen, wie man da in der individuellen Phase mit Kinderwunsch verfahren kann. Aber unsere Maßgabe ist, wir wollen natürlich jeder Frau, auch mit MS, eine ganz normale Schwangerschaft ermöglichen und natürlich auch ihren Kinderwunsch absolut realisieren lassen. Das war ja früher furchtbar mit den ganzen Verboten, die es da gab. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Schicksale da zerstört worden sind mit komplett falschen Empfehlungen. Wir versuchen heute alles möglich zu machen, aber man sollte halt vorher drüber sprechen, wie man das am besten realisiert. Nele Handwerker: Okay, super. Das heißt, es gibt Medikamente, die kann man nehmen. Das finde ich sehr schön. Was passiert denn, wenn ich eine aktive MS mit einer verlaufsmodifizierenden Therapie zum Stillstand gebracht habe und denke, jetzt ist alles gut und jetzt setze ich die Medikamente ab? Nele Handwerker: Das lese ich leider immer mal wieder, auch bei Social Media. So nach dem Motto, jetzt ist es super und jetzt kann ich endlich wieder auf diese, in Anführungsstrichen, bösen Medikamente verzichten. Prof. Mathias Mäurer: Na ja, die Krankheitsaktivität wird wiederkommen. Das kann, wie gesagt, bei einer moderaten MS auch klappen, dass man nicht unbedingt sofort irgendwas bekommt oder dass es lange dauert. Obwohl, wenn man so in Studien guckt, auch Absetzstudien mit Interferonen, merkt man schon, dass eben die Gruppe, die abgesetzt hat, schlechter läuft. Also zumindest im statistischen Mittel. Im Einzelfall kann es natürlich klappen, genauso wie es im Einzelfall auch ziemlich in die Hose gehen kann. mit Einzelfällen kann man sowieso nichts entscheiden. Es wird immer jemanden geben, der sagt, bei mir hat das ganz gut geklappt, aber das kann man eben nicht auf die Allgemeinheit ausrollen. Wenn man aber eine hochaktive Therapie oder eine hochwirksame Therapie stoppt, da kann man ziemlich auf die Nase fallen. An der Stelle sei gesagt, zum Beispiel Patientinnen, die auf Fingolimod sind oder auf den S1P-Modulatoren, wenn die absetzen, die machen halt gerne mal einen Rebound, also das er dann so richtig zuschlägt der Schub. Auch bei Tysabri hat man häufig eine Wiederkehr der Krankheitsaktivität und Rebound-Phänomene. Das Absetzen sollte man in der Tat mit seinem Neurologen sehr gut besprechen und zusammen durchsprechen, wie das persönliche Risiko ist, zumindest statistisch, wenn ich jetzt das Medikament weglasse? Wie gesagt, ich habe teilweise auch diese Beiträge im Internet gesehen. Da gruselt es mir natürlich ein bisschen. Das sind einfach ziemlich dämliche Empfehlungen. Welche Risiken sind mit einem wiederholten Wechsel von Therapie und Therapieabbruch verbunden? Nele Handwerker: Also ich mache jetzt Therapie, weil ich einen Schub hatte und sobald die Aktivität gestoppt ist, höre ich wieder auf damit. Anstatt dankbar zu sein und das weiter zu nutzen, höre ich auf und spiele dieses Ping Pong Spiel. Prof. Mathias Mäurer: Na ja, zum einen gibt es tatsächlich Medikamente, dazu gehören die S1P-Modulatoren, so First Dose Effekte. Das heißt, man bringt sich dann natürlich mit so einem On/Off-Schema auch immer wieder in eine blöde Situation, weil man halt diese First Dose Effekte als Nebenwirkung mitnimmt. Das ist nicht besonders klug bei solchen Medikamenten. Dann ist es natürlich auch so, Medikamente müssen sich auf ein gewisses Steady State einpendeln. Die meisten Basismedikamente zum Beispiel, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie die volle Wirksamkeit entfalten. Also wenn man diese Medikamente drei Monate nimmt, dann absetzt, dann irgendwann mal wieder drei Monate nimmt, dann wird man nie den Effekt haben, den man eigentlich versprochen bekommt durch das Medikament. Deswegen sollte man es so nehmen, wie es auch im Beipackzettel drinsteht. Das haben wir ja am Anfang schon durchgegangen, es geht um eine Art Prophylaxe. Das ist nichts, was die akute Entzündung bremst. Sondern diese Medikamente sind dafür da, um für die Zukunft weniger Entzündungslast auf das Hirn einwirken zu lassen. Das heißt, diese Medikamente sind wie eine Versicherung. Ist ja auch nicht so, dass sie ständig Ihre Reiseversicherung kündigen, wenn sie mal gerade nicht im Urlaub sind. Das macht man ja auch nicht. Man lässt sie weiterlaufen. Und so muss man das auch bei den MS-Medikamenten betrachten. Das ist eine Art Versicherung, die lässt man einfach laufen und freut sich, wenn das gut funktioniert. Und wenn es nicht gut funktioniert, dann kann man nach Alternativen suchen. Und nicht funktionieren können eine mangelnde Wirksamkeit oder zu viele Nebenwirkungen sein. Aber eben keine, aus meiner Sicht, eigenen Ideen verwirklichen. Nele Handwerker: Ja, das bitte für den kreativen Bereich lassen, nicht für die medizinische Behandlung. Prof. Mathias Mäurer: Genau. Nicht kreativ werden mit den Medikamenten. Also, das sage ich auch ärztlichen Kollegen. Das ist auch manchmal so der Fall, dass man sich dann irgendwelche Schemata ausdenkt. Bitte nicht. Welcher Prognose sehen Menschen entgegen, die die MS mit, in Anführungsstrichen, nur einer gesunden Lebensweise eindämmen wollen? Prof. Mathias Mäurer: Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also ich habe überhaupt nichts gegen natürlich diese supportiven Konzepte, gesunde Lebensweise, Achtsamkeit, viel Sport, auch wegen mir, alles mögliche Komplementäre, wenn es guttut, geschenkt. Aber bitte immer als zusätzliches Konzept. Die Basistherapie für jede MS ist, dass man das Immunsystem in seiner Wirksamkeit bremst, in seiner Auswirkung. Und dem Immunsystem ist ziemlich egal, wie sie sich ernähren. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen vollmundig ausgedrückt. Es gibt natürlich schon so gewisse Ideen, was jetzt dem Immunsystem besser und schlechter gefällt, aber sie brauchen da keine speziellen Diäten. Es reicht einfach, wenn man gesunden Menschenverstand walten lässt und eigentlich den Gesundheitsempfehlungen folgt, die eigentlich für alles gelten, wenn man im Leben gut zurechtkommen will. Das ist auch als MS-Patient absolut ausreichend. Aber wie gesagt, wenn jemand Spaß an bestimmten Diäten hat, Spaß an bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, solange es nicht gefährlich ist, ist das von meiner Seite aus kein Problem. Aber wie gesagt, bitte mit einer vernünftigen Immuntherapie, angepasst an den Schweregrad der Erkrankung. Nele Handwerker: Und eine gegensätzliche Frage: Wie sieht die Prognose von MS-Patienten aus, die eine wirksame Therapie nutzen, wo wirklich die Aktivität komplett unterdrückt wird, auch im subklinischen Bereich? Nele Handwerker: Wo auch die MRTs, keine Aktivität zeigen, möglichst noch ergänzt durch einen gesunden Lebenswandel. Prof. Mathias Mäurer: Ich glaube, dass es denen langfristig wahrscheinlich besser gehen wird. Ich meine auch das kann man jetzt individuell nicht für jeden sagen, weil es gibt in der Tat auch wirklich schon sehr, sehr aggressive Verläufe, wo man auch manchmal der Erkrankung bei bestem Willen auch als Arzt so ein bisschen hinterherläuft. Aber ich sage mal, mit einer normalen MS, die vernünftig behandelt ist, erzielen wir schon heute doch ganz gute Verläufe. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt Daten angucke, was die Transition in diese sekundär chronisch progrediente Erkrankungsphase angeht, da gibt es ja noch diese alten Daten, die auch noch in den alten Lehrbüchern drinstehen und meistens auch in irgendwelchen Ratgebern, dass so nach zehn Jahren doch 50 % eben eine sekundäre, chronisch progrediente Verlaufsform auch in Kauf nehmen müssen. Also die letzten Daten, die ich gesehen habe, die das systematisch ausgewertet haben, also nach der Ära der Immunmodulatoren, die ist mittlerweile schon weit unter 20 %. Und wenn man hochwirksame Therapien anguckt, kann man sogar das noch weiter drücken, sogar in den einstelligen Bereich. Und die Studie, die Sie eben angesprochen haben, Dänemark/Schweden, die zeigt ja auch, dass man letztlich Progression durch eine frühe, konsequente Therapie ganz gut verhindern kann. Und dann gibt es auch noch einige Registerauswertungen, die zeigen, dass es von Vorteil ist, je früher man anfängt mit der Therapie, desto weniger wahrscheinlich eben den Übergang auch in so progressive Phasen zu erleben. Es gibt schon einige, wirklich gut gemachte Daten, die zeigen, dass das vernünftig ist da auch was zu machen. Noch mal, im Endeffekt ist es natürlich immer die eigene Entscheidung. Und wenn die eigene Entscheidung auf der Basis von Wissen und Evidenz getroffen ist, ist das alles in Ordnung. Ich würde dann zwar auch versuchen, dagegen zu argumentieren. Aber da kann ich gut mit umgehen, wenn ich jemanden gegenüber habe, der mir letztlich evidenzbasiert versichert, dass er das verstanden hat, wie MS funktioniert. Wo ich aber, wie gesagt, gar nicht mit kann, das ist mit irgend so einem Geschwurbel, wo ich merke, da hat sich eigentlich niemand die Mühe gemacht, sich mal damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet und dass das eben doch eine chronische Erkrankung ist, die auch nicht zwischen den Schüben weg ist. Sondern die ist da und die ist auch bei den meisten aktiv da und es lohnt sich, diese Aktivität auch langfristig gesehen zu unterdrücken. Wie umkehrbar sind Spätfolgen, die sich im progredienten Verlauf der MS zeigen, nach aktuellem Stand der Forschung und Behandlungsoptionen? Nele Handwerker: Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die denken, ach und dann erfindet die Forschung was in zehn Jahren und dann kann das alles wieder rückgängig gemacht werden, mein Gehirn wird wieder größer, alles wird wieder toller. Und ich kann hüpfen wie ein Kind. Prof. Mathias Mäurer: Da wird natürlich dran gearbeitet und das ist auch eine große Hoffnung. Das wünschen sich ja viele, dass man die Sache wieder reparieren kann. Irgendwelche Remyelinisierungsstrategien oder auch Neuroprotection oder vielleicht sogar auch ein Wiederaufbau mit Stammzellen oder so. Klar, da wird dran geforscht. Nur da muss man ganz klar sagen, das ist noch so weit weg von einer klinischen Realität, dass ich da nicht drauf warten würde. Da geht nämlich viel Zeit ins Land. Also natürlich ist das mal ein Ziel, dass man eben auch denjenigen helfen kann, die durch die Erkrankung ernst zu nehmende Symptome bekommen haben. Aber im Moment können wir das nicht zurückdrehen. Was passiert ist, ist häufig dann auch fixiert. Man kann das zwar durch Reha auch kompensieren, das Gehirn ist ja wirklich sehr leistungsfähig, auch sogar in späteren Phasen der Erkrankung kann man da noch viel durch Kompensation erledigen. Aber man wird bestimmte Dinge nicht zurückdrehen können oder hat auch noch keine Möglichkeiten in der Hand, das zurückzudrehen. Das erfolgreichste Konzept ist in der Tat eben die frühe entzündungshemmende Therapie. Das ist das, wo wir eigentlich doch in den letzten Jahren gesehen haben, das hat eine ganze Menge Fortschritt gebracht bei der Erkrankung. Nele Handwerker: Jetzt sind Sie schon eine Weile MS-Spezialist. Sind Ihnen denn schon Patienten begegnet, die ihre frühere Entscheidung gegen verlaufsmodifizierende Medikamente bereut haben? Prof. Mathias Mäurer: Ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren, dass ich in der MS-Ambulanz arbeite und ich habe wahrscheinlich schon mehrere 1000 Patienten gesehen. Ich bin niemand, der zurück guckt. Natürlich denkt man sich manchmal, Mensch, das hätten wir besser machen können oder hätten wir irgendwie ein bisschen früher begonnen. Aber das interessiert mich eigentlich in so einer Situation nicht mehr. Ich nehme jeden so, wie er kommt und versuche das Beste rauszuholen. Dieser Blick zurück, der ist sowohl von Arztseite Schwachsinn als auch von Patientenseite. Sie können es ja nicht mehr ändern. Der Blick muss immer nach vorne gehen und da muss man die Situation so nehmen, wie sie zu dem Zeitpunkt ist. Ich bin auch der Meinung, man kann, egal zu welchem Zeitpunkt und in welcher Phase immer irgendwas rausholen. Sei es durch Reha, sei es durch symptomatische Therapie und natürlich auch wenn in frühen Phasen vielleicht dieser Sinneswandel passiert dann auch noch durch eine gut gewählte Immunmodulation. Ich sage mal so, ich habe noch keinen MS-Patienten erlebt, der, wenn er sich auf das eingelassen hat und nicht so ein Grundmisstrauen gegen uns als Mediziner mitbringt, der nicht verstanden hat, was wir ihm damit sagen wollen und der dann auch selber sagt, ja, das sehe ich irgendwo ein, das überzeugt mich. Häufig ist es tatsächlich diese Situation, wenn man sich überhaupt nicht auf unsere Sichtweise der Dinge einlässt, sondern nur stur auf auf seinem Modell beharrt, das man dann wahrscheinlich falsche Berater hat, denen man eben mehr vertraut als den Profis. Nele Handwerker: Vielen Dank, war ein tolles Interview. Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben zum Schluss? Prof. Mathias Mäurer: Ich sage mal so: Bleiben Sie in dem, was Sie tun entspannt, aber nicht so entspannt, dass Sie den Kopf in den Sand stecken und denjenigen hinterherlaufen, die Ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Die Erkrankung ist saublöd und letztlich erfordert das auch, dass man sich damit auseinandersetzt und teilweise in manche saure Äpfel beißt oder manche Kröten schlucken muss. Aber irgendwelchen falschen Propheten hinterherzulaufen mit Heilversprechen, das ist auf lange Sicht nicht gut. Nele Handwerker: Ein sehr gutes Schlusswort. Prof. Mathias Mäurer: Ja, das würde ich mitgeben. Nele Handwerker: Vielen, vielen Dank, Herr Professor Mäurer, das war ein tolles Interview. Ich freue mich und ich hoffe, ich darf Sie noch mal irgendwann zu einem schönen Thema einladen. Nochmals danke. Prof. Mathias Mäurer: Immer gerne. Hat mich auch gefreut. Und auch an alle Hörer und Leser noch einen schönen Tag. Nele Handwerker: Tschüss. Prof. Mathias Mäurer: Tschüss. ++++++++++++++++++++ Ich wünsche Dir bestmögliche Gesundheit, Nele Mehr Informationen rund um das Thema MS erhältst du in meinem kostenlosen MS-Letter. Hier findest Du eine Übersicht über alle bisherigen Podcastfolgen.
Die Pille als Sex-Killer?
Lina ist einfach nie feucht geworden und die Lust auf Sex hielt sich auch stets in Grenzen. Klar, denn ohne Schmiere tut der Akt halt auch einfach weh! Der Grund dafür? Wahrscheinlich die Pille! Seit frühesten Teenager-Jahren wegen Menstruationsschmerzen und Pickeln verschrieben bekommen, und dies auch nie wirklich in Frage gestellt. Als Lina vor zwei Jahren zum ersten Mal ever und nach einer schlimmen Trennung die Pille abgesetzt hat, konnte sie nicht fassen, was sie alles verpasst hat: Richtig Bock auf Rummachen und wirklich feuchte Schlüppis! Außerdem: Welche Vorteile die Tablette dann doch hat, welche echten Alternativen es ohne Hormone gibt und warum man nach Suff-Durchfall Angst um die Schutzwirkung hat. Kennen eigentlich alle Pille-Nehmerinnen Wassereinlagerungen und Libidoverlust? Und selbstverständlich feuchtfröhliche Würdest-du-lieber-Fragen, z.B.: “Lieber den dreckigen Schlüpfer Sunny Side Up im Badezimmer vergessen oder lieber vergessen zu spülen?”. Und warum zur Hölle weiß noch nicht einmal die Frauenärztin wie das mit dem Diaphragma wirklich läuft? Die Pille nach der Trennung abgesetzt und plötzlich zum ersten Mal richtig Lust auf Bumsen, aber keinen passenden Sexualpartner am Start? Dann mach's wie Lina und bestell' dir endlich mal den Satisfyer! Hier geht's lang: https://ffrl.ch/p/satisfyer3 Diese Folge wird präsentiert von RelaxRadio: dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit! SoftHits und LoveSongs nonstop auf: https://relaxradio.de Schreib' uns jetzt auch direkt über WhatsApp! Wir sind sooo gespannt, von dir zu hören. Hast du Themen, über die wir unbedingt sprechen sollten, oder Tipps und Anregungen? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? WhatsApp an +49 176 568 637 98 oder über Instagram: @feuchtfroehlich.show. Außerdem würde es uns sehr helfen, wenn du uns auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform nicht nur abonnierst, sondern auch positiv bewertest! Vielen Dank im Voraus und bis zur nächsten feuchtfröhlichen Folge, deine Heidi & Lina!
Die Pille als Sex-Killer?
Lina ist einfach nie feucht geworden und die Lust auf Sex hielt sich auch stets in Grenzen. Klar, denn ohne Schmiere tut der Akt halt auch einfach weh! Der Grund dafür? Wahrscheinlich die Pille! Seit frühesten Teenager-Jahren wegen Menstruationsschmerzen und Pickeln verschrieben bekommen, und dies auch nie wirklich in Frage gestellt. Als Lina vor zwei Jahren zum ersten Mal ever und nach einer schlimmen Trennung die Pille abgesetzt hat, konnte sie nicht fassen, was sie alles verpasst hat: Richtig Bock auf Rummachen und wirklich feuchte Schlüppis! Außerdem: Welche Vorteile die Tablette dann doch hat, welche echten Alternativen es ohne Hormone gibt und warum man nach Suff-Durchfall Angst um die Schutzwirkung hat. Kennen eigentlich alle Pille-Nehmerinnen Wassereinlagerungen und Libidoverlust? Und selbstverständlich feuchtfröhliche Würdest-du-lieber-Fragen, z.B.: “Lieber den dreckigen Schlüpfer Sunny Side Up im Badezimmer vergessen oder lieber vergessen zu spülen?”. Und warum zur Hölle weiß noch nicht einmal die Frauenärztin wie das mit dem Diaphragma wirklich läuft? Die Pille nach der Trennung abgesetzt und plötzlich zum ersten Mal richtig Lust auf Bumsen, aber keinen passenden Sexualpartner am Start? Dann mach's wie Lina und bestell' dir endlich mal den Satisfyer! Hier geht's lang: https://ffrl.ch/p/satisfyer3 Diese Folge wird präsentiert von RelaxRadio: dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit! SoftHits und LoveSongs nonstop auf: https://relaxradio.de Schreib' uns jetzt auch direkt über WhatsApp! Wir sind sooo gespannt, von dir zu hören. Hast du Themen, über die wir unbedingt sprechen sollten, oder Tipps und Anregungen? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? WhatsApp an +49 176 568 637 98 oder über Instagram: @feuchtfroehlich.show. Außerdem würde es uns sehr helfen, wenn du uns auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform nicht nur abonnierst, sondern auch positiv bewertest! Vielen Dank im Voraus und bis zur nächsten feuchtfröhlichen Folge, deine Heidi & Lina!
(106) Coronavirus-Update: Weihnachten mit Omikron
Das Omikron-Wachstum ist noch unsichtbar. Warum Booster wichtig sind und doch keine absolute Sicherheit bieten. Die Themen mit den Timecodes: 00:02:10 Maßnahmen und Ausbreitungsgeschwindigkeit 00:14:09 Erkenntnisse aus Omikron-Ausbruch in Oslo 00:22:23 Virusvermehrung in den Atemwegen 00:26:14 Antikörperneutralisation von Omikron nach Impfstatus 00:37:31 Infrastruktur-Ausfälle durch Omikron 00:48:48 Reinfektion Genesener nach Labordaten 00:50:30 Erkenntnisse zur T-Zell-Antwort 00:59:20 Boosterstrategie ausweiten? 01:07:39 Dritte Dosis für Minderjährige? 01:08:39 Geboosterte weiter testen 01:11:19 Schutz von Pflegeheimen durch PCR-Tests und Booster 01:15:15 Monoklonale Antikörper und andere Medikamente 01:22:34 Schutzwirkung des neuen Impfstoffs von Novavax 01:30:25 Präventionsparadoxon und Weihnachtsempfehlung Mehr Wissenschaft gibt es im Podcast „Synapsen“ – jetzt ganz neu: Science Slam! https://www.ardaudiothek.de/sendung/synapsen-ein-wissenschaftspodcast/75565374/ Im Podcast „Die Idee“ spricht Norbert Grundei diesmal mit der Physikerin Viola Priesemann: https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-idee-ideen-leute-stories/86337840/ Praktische Lebenshilfe und witzige Gespräche gibt es im „Flexikon“ – die aktuelle Folge bereitet perfekt auf Weihnachten vor: https://www.ardaudiothek.de/sendung/flexikon/94228018/ Im Bücherpodcast eat.READ.sleep. geht es um Lieblingsbücher, Bestseller und literarische Anekdoten: https://www.ardaudiothek.de/sendung/eat-read-sleep-buecher-fuer-dich/76502470/
EMA genehmigt Novavax - "Ein guter Impfstoff, der helfen kann"
Der Impfstoff Novavax aus den USA wird von der Europäischen Arzneimittelbehörde empfohlen. "Die ersten Ergebnisse sehen sehr gut aus", sagt der Immunologe Leif Erik Sander von der Charité. Novavax löse sehr positive Antikörperreaktionen aus; die Schutzwirkung gegen eine Corona-Infektion liege bei 90 Prozent.Finthammer, Volker; Sander, Leif Erikwww.deutschlandfunkkultur.de, Studio 9Direkter Link zur Audiodatei
Neue "Totimpfstoffe", Omikron, Labore am Limit: Wie ist die Lage, Herr Professor Dalpke?
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit zwei neue Impfstoffe. Das Besondere an den Präparaten der US-Firma Novavax und des französischen Konzerns Valneva: Es handelt sich um Vakzine, die auf konventionelle Weise hergestellt werden. Nicht-Wissenschaftler bezeichnen die Präparate auch als "Totimpfstoffe" und sehen sie als Mittel, um bisher Unentschlossene zur Impfung zu bewegen. Im CoronaCast bei Sächsische.de erklärt der Dresdner Virologe Alexander Dalpke die Unterschiede zwischen den beiden neuen Impfstoffen und was sie von den bisher zugelassenen Präparaten abgrenzt. Außerdem blickt der Virologe voraus und ordnet die von der Omikron-Variante ausgehenden Gefahren ein. Eins ist Dalpke, der an der TU Dresden das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie leitet, immer wichtig: die Dinge wissenschaftlich korrekt einzuordnen. "Und da fängt es beim Begriff an", sagt er. Das Wort "Totimpfstoff" könne man tatsächlich nur in Anführungszeichen verwenden, um die beiden neuen von Novavax und Valneva von den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen zu unterscheiden. "Formal sind das alles tote Impfstoffe, weil darin jeweils vermehrungsfähige Viren fehlen." Bei Valneva und Novavax, das noch im Dezember zugelassen werden könnte, handele es sich fachlich richtig ausgedrückt demnach um "proteinbasierte Impfstoffe". Doch diese beiden haben untereinander auch Verschiedenheiten. Hier eine Kurzfassung der Erläuterungen des Virologen: Valneva: Bei diesem Impfstoff wird im Labor das Virus künstlich angezüchtet und in einem chemischen Verfahren deaktiviert. Anschließend wird es einem Wirkverstärker, einem sogenannten Adjuvant, versehen und verimpft. Klinische Studien zur Wirksamkeit fehlen noch. Allerdings sei beobachtet worden, dass über 95 Prozent der Probanden nach einer Impfung Antikörper bildeten. "Das ist per se erst mal eine gute Aussage." Novavax: "Dieser Impfstoff funktioniert etwas anders", erklärt Dalpke. Dabei werde das Spike-Protein - also das Protein, das verantwortlich für das Eindringen des Coronavirus in den menschlichen Körper ist - gezielt in einer Zellkultur nachgebildet. "In einem speziellen Verfahren wird das gewonnene Protein gereinigt und anschließend ebenfalls mit einem Impfstoffverstärker gespritzt". Im Gegensatz zu dem Präparat von Valneva gebe es für diesen Impfstoff klinische Daten. "Es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt eine Wirksamkeit von 89,7 Prozent gegen symptomatische Infektionen und von fast 100 Prozent gegen schwere Verläufe." Und sollten bisher Unentschlossene nun tatsächlich warten, bis einer der beiden neuen Impfstoffe in Europa zugelassen wird? "Eigentlich lohnt es sich nicht. Viel wichtiger wäre jetzt, sich impfen zu lassen", sagt Dalpke und verweist auf die nach wie vor rollende Delta-Wella und die schon millionenfach verimpften wie erprobten bisher zugelassenen Präparate. "Aber", schränkt er ein, "wenn trotz wissenschaftlicher Einordnungen weiterhin bei Menschen größere Ängste entgegenstehen, dann ist es natürlich immer noch besser, sich später mit einem der jetzt in Zulassung befindlichen Impfstoffe impfen zu lassen, als es gar nicht zu tun." Wie viele Impfungen nötig sein werden, um einen ausreichend hohen Impfschutz zu erlangen, sei noch nicht klar. "Nach meinem Kenntnisstand werden auch zumeist zwei Impfdosen notwendig sein." Dalpke geht aber davon aus, dass auch bei den neuen Impfstoffen eine dritte Dosis zum Erreichen einer vollständigen Schutzwirkung erforderlich sein könnte. Genaueres müssten nun Studien zeigen. Außerdem Inhalte des Gesprächs: Warum Omikron ansteckender aber offenbar nicht gefährlicher sein könnte Die Inzidenz ist rückläufig: Sehen wir ein Abebben der Welle? Diskussion zur vierten Impfung läuft: Müssen wir uns bald wirklich ständig impfen?
CDU-Politiker fordert Verfallsdatum für Impfzertifikat
Wer vollständig geimpft ist, bekommt ein digitales Impfzertifikat. Jedoch lässt die Schutzwirkung der mit der Zeit nach. Der CDU-Politiker Georg Kippels fordert deshalb, die Gültigkeit des Impfausweises zu begrenzen.
EinBlick Podcast – u.a. #Weltgesundheitsgipfel, Booster-Impfungen, Innovationsfonds des G-BA vergibt weiter Mittel
»Einblick – Der Podcast«, der Podcast für den tieferen aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Immer freitags um 12 Uhr. In dieser Ausgabe: In Berlin tagte der Weltgesundheitsgipfel und forderte mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Die Corona-Fallzahlen steigen deutlich – zum Winter sollen Booster-Impfungen die Schutzwirkung besonders für Risikopatient:innen und ältere Bürger:innen erhöhen. Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses vergibt auch in den kommenden Jahren Mittel für innovative Projekte. Wir berichten weiter von den neuen Lieferdiensten für Arzneimittel – deren Potenzial unterschiedlich eingeschätzt wird. Fachkräftemangel droht in den Praxen – gleichzeitig wachsen die Aufgaben. Der Virchowbund fordert eine Konzertierte Aktion. Wir schauen auf e-AU und E-Rezept – wie ist bei den aktuellen Großprojekten der Digitalisierung des Gesundheitswesens der aktuelle Stand.
BGB Schuldrecht AT - Folge 22: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
§ 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Erfüllungsübernahme, Schuldbeitritt, Vertragsübernahme, Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
BGB Schuldrecht AT - Folge 23: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis; Gläubiger- und Schuldnermehrheiten
Noch § 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Voraussetzungen, Rechtsfolge, Beispiele, Vorverlagerung in das Vertragsanbahnungsverhältnis (§ 311 III BGB); § 15 Gläubiger- und Schuldnermehrheiten: Schuldnermehrheit (§ 420 ff BGB): Teilschuld (§ 420 BGB), Gesamtschuld (§ 421 BGB), "Gesamthandsschuld"
Schutzrechte anmelden ist das eine. Seine Rechte durchzusetzen ist etwas anderes. Heute ein paar Gedanken zum Thema der Wirksamkeit von Schutzrechten. Inhalt der Folge: * Schutzwirkung mit Patenten * Schutzmöglichkeit ohne Patente * Mein gemischtes Fazit Der Beitrag IF150 – Wirksamkeit der Schutzrechte erschien zuerst auf Ingenieurbüro David C. Kirchner.
«Puls» klärt die wichtigsten Fragen rund um die Auffrischimpfung und zeigt, weshalb die Schutzwirkung der mRNA-Impfstoffe mit der Zeit nachlässt – dazu auch ein Live-Chat. Ausserdem: Hilfe für ungepflegte Füsse. Booster-Impfung – Die fünf grossen Fragen Was erhofft man sich vom Zusatz-Piks? Warum macht die dritte Impfung Sinn? Wer kommt dafür infrage? Und wann? Wo wird schon heute geboostert? «Puls» klärt die wichtigsten Fragen in der Debatte um die Booster-Impfung und zeigt, wieso und bei wem der mRNA-Schutz gegen Covid mit der Zeit nachlässt. Studiogast: Christoph Berger Daniela Lager spricht mit dem Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Impffragen über die dritte Covid-Impfung, wann sie in der Schweiz kommen wird und wer ein drittes Mal geimpft werden soll. Puls-Chat «Covid-19-Impfung» Dorothea Horschik, Barbara Jakopp, Steve Pascolo und Anda-Petronela Radan haben Ihre Fragen beantwortet. Warzen, Fusspilz und Co. – Tipps und Tricks für gepflegte Füsse Noch geniessen die Füsse ein paar letzte freie Sonnentage, dann verschwinden sie mit Fusspilz, Warzen und Co. wieder in den Schuhen. Dabei wäre die Behandlung meist ebenso einfach wie effektiv. «Puls» geht im Freibad Frauenfeld auf «Fussfang» und gibt Tipps und Tricks für gesunde Füsse. Studiogast: Severin Läuchli Daniela Lager spricht im «Puls»-Studio mit Severin Läuchli vom dermatologischen Zentrum Zürich über Schwitzfüsse und was dagegen unternommen werden kann. Er ist Facharzt für Dermatologie und hat lange die Dermatochirurgie am Universitätsspital Zürich geleitet.
Nr. 46 Vertrag mit Schutzwirkung zug. Driter, Drittschadensliquidation (Kammergericht Berlin)
Kammergericht Berlin, Beschluss vom 08.01.2021 - 21 U 1064/20 Beschädigung von Baumaterialen eines Bauunternehmens auf einer Baustelle durch Mitarbeiter eines anderen Bauunternehmens: Greift ein vertraglicher Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB? Abonnieren und weiter empfehlen! Instagram: rechtsprechung_news Website: www.rechtsprechung-news.webnode.com Jura; Urteil; Rechtsprechung; News; Referendariat; Rechtswissenschaften; Prozess; Recht; Gericht; Gesetz; Klage; Rechtsanwalt; Staatsexamen; Paragraf; Jurist; Examen; StEx; Rechtsreferendariat; Anwalt; Ref; Paragraph; Referendar; Justiz; Bundesverfassungsgericht; Rechtsreferendar; Richter; law; Justiz; Jurastudent; Jurapodcast; Staatsanwalt; Zivilrecht; BGB; BGH; Bundesgerichthof; Landgericht; Oberlandesgericht; OLG; LG; Amtsgericht; AG; ZPO; Rechtswissenschaft
Globaler Kampf gegen Corona - Mehr Impftempo mit geringeren Dosen?
Um das weltweite Impftempo zu erhöhen, kursiert in der Forschung der Vorschlag, reduzierte Impfdosen zu verabreichen. Neben der geringeren individuellen Schutzwirkung bleiben jedoch offene Fragen, nicht zuletzt, wie eine solche Impfkampagne umgesetzt werden soll. Volkart Wildermuth im Gespräch mit Lennart Pyritz www.deutschlandfunk.de, Forschung aktuell Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Um den Präsenzunterricht nach den Ferien wieder möglich zu machen, fordern Eltern, Schüler und Lehrerinnen schon lange Luftfilteranlagen für alle Schulen. Wie es um den Ausbau von Luftfilteranlagen in den Bundesländern steht, berichtet Christian Parth im Nachrichtenupdate. Aller guten Dinge sind drei: Das gilt wahrscheinlich auch bei den Impfungen gegen das Corona-Virus. Da die Impfstoffhersteller Pfizer und BioNTech davon ausgehen, dass die Schutzwirkung ihres Produkts nach sechs Monaten sinkt, empfehlen sie eine dritte Impfung. Außerdem im Update: Mehr als 50 Menschen sind bei einem Brand einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch ums Leben gekommen. Und: Spanien wird Risikogebiet. Was noch? Die 49 kommen wieder zu Wort. Moderation und Produktion: Jannis Carmesin Redaktion: Ole Pflüger Mitarbeit: Hannah Grünewald Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de. Weitere Informationen zur Folge: - Luftfilter an Schulen: Worauf warten sie noch? (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-07/luftfilter-schulen-kitas-debatte-kosten-corona-massnahmen-aerosole-lueften) - Corona-Luftfilter: Lüften oder Filtern? (https://www.zeit.de/hamburg/2021-07/corona-luftfilter-cdu-hamburg-schulen) - Impfstrategie: Wir brauchen eine kalte Impfpflicht, um Kinder zu schützen (https://www.zeit.de/gesundheit/2021-07/impfstrategie-corona-kinder-jugendliche-impfpflicht-beschraenkungen) - BioNTech: Wie lange hält der Impfschutz? (https://www.zeit.de/gesundheit/2021-07/biontech-corona-impfung-immunitaet-haltbarkeit-auffrischung-delta-variante) - Bangladesch: Mehr als 50 Tote bei Fabrikbrand (https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-07/bangladesch-rupganj-fabrikbrand-40-tote) - Serie: Die 49 (https://www.zeit.de/serie/die-49)
Warum England eine Warnung für uns sein sollte. Neue Daten zur Immunantwort Älterer nach Impfung. Und: Long-Covid. Die Themen mit den Timecodes: 00:01:47 Debatte um Maskenpflicht in Deutschland 00:03:46 Daten zur Delta-Variante in England 00:09:54 Anteil der Delta-Variante in Deutschland 00:11:58 Bedeutung von Reisen für Variantenausbreitung 00:15:52 Schutzwirkung für Ungeimpfte in Israel 00:20:12 US-Berichte zu Myokarditis als mögliche Nebenwirkung nach mRNA-Impfung 00:31:36 Neue Daten zu Risikofaktoren für schweren Covid-Verlauf bei Kindern 00:42:30 Novavax veröffentlicht Studiendaten zu proteinbasiertem Impfstoff 00:45:39 Schwächere und verzögerte Immunantwort Älterer nach Corona-Impfung 01:05:16 Monoklonaler Antikörper als Nasenspray 01:10:40 Forschungslage zu Long-Covid 01:18:14 Mögliche Risikofaktoren und Pathomechanismen bei Long-Covid 01:29:45 Therapieansätze gegen Long-Covid 01:33:35 Einfluss der Impfung auf Long-Covid Alle Infos zum NDR Info Podcast Coronavirus-Update: https://www.ndr.de/coronaupdate Die Manuskripte aller Folgen: https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcastcoronavirus102.html Alle Fragen und Antworten zu Corona auf unserer FAQ-Seite: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/corona100.html Kein Tag vergeht ohne neue Nachrichten zum Coronavirus Sars-CoV-2. Längst haben wir uns an Maßnahmen wie Mundschutz, Abstand und Hygieneregeln gewöhnt. Und noch immer ist kein Ende der Pandemie in Sicht. In unserem wöchentlichen Podcast wollen wir verlässlich über neue Erkenntnisse der Forschung informieren. Wie steht es um einen Impfstoff? Wie entwickelt sich die Test-Strategie? Besteht Hoffnung auf ein Medikament? Die NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig und Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion sprechen dazu im Wechsel mit Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, und mit Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Dabei soll es nicht um Panikmache gehen - sondern ganz im Gegenteil: Der Podcast "Coronavirus-Update" will informieren, einordnen und Hintergründe liefern. Wer eine Frage für die Podcast-Interviews mit Christian Drosten und Sandra Ciesek hat, kann diese gerne per Mail schicken an: meinefrage@ndr.de NDR Info auf Instagram: https://www.instagram.com/ndr.info NDR Info auf Facebook: https://www.facebook.com/ndrinfo #coronavirus #covid19 #covid_19 #coronavirusupdate
Warum England eine Warnung für uns sein sollte. Neue Daten zur Immunantwort Älterer nach Impfung. Und: Long Covid. Die Themen mit den Timecodes: 00:01:47 Debatte um Maskenpflicht in Deutschland 00:03:46 Daten zur Delta-Variante in England 00:09:54 Anteil der Delta-Variante in Deutschland 00:11:58 Bedeutung von Reisen für Variantenausbreitung 00:15:52 Schutzwirkung für Ungeimpfte in Israel 00:20:12 US-Berichte zu Myokarditis als mögliche Nebenwirkung nach mRNA-Impfung 00:31:36 Neue Daten zu Risikofaktoren für schweren Covid-Verlauf bei Kindern 00:42:30 Novavax veröffentlicht Studiendaten zu proteinbasiertem Impfstoff 00:45:39 Schwächere und verzögerte Immunantwort Älterer nach Corona-Impfung 01:05:16 Monoklonaler Antikörper als Nasenspray 01:10:40 Forschungslage zu Long Covid 01:18:14 Mögliche Risikofaktoren und Pathomechanismen bei Long Covid 01:29:45 Therapieansätze gegen Long Covid 01:33:35 Einfluss der Impfung auf Long Covid
Impfstoff und Corona-Mutanten: die Weiterentwicklung
Die Wissenschaft hat in Rekordzeit mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt. Doch weltweit machen sich nun immer mehr Mutanten des Virus breit, die sich auch auf die Schutzwirkung des Impfstoffs auswirken. Darum wird in verschiedenen Laboren daran gearbeitet, die Impfstoffe weiterzuentwickeln. Was da gemacht wird und wie schwer das überhaupt ist, darüber redet Moderatorin Anja Kopf mit dem Infektiologen Professor Peter Kremsner. Er leitet die Impfstoffstudie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac.
Januar 1976: Obwohl die Schutzwirkung von getragenen Sicherheitsgurten wissenschaftlich unumstritten ist, gurtet sich nur eine Minderheit der Bevölkerung an. Um die Zahl der Verletzten und tödlich Verunglückten bei Verkehrsunfällen zu reduzieren, führt der Bundesrat per Verordnung die Gurtentragpflicht ein. Die "Vereinigung gegen technokratische Missbräuche" will sich das Gurtenobligatorium nicht gefallen lassen. Ihr Sekretär, der Walliser Jean-Pierre Favre, provoziert eine Busse und ficht die Gurtentragpflicht vor Bundesgericht an.
In kleiner Dosis kann ein Fünkchen dessen, was uns schaden würde, auf einmal eine Schutzwirkung entfalten: So macht uns nicht nur ein Fetzen Erreger immun gegenüber einer Ansteckung, sondern womöglich auch ein Fetzen Skepsis immun gegenüber einer voll ausgewachsenen Eifersucht. So zumindest Frank Wedekinds Theorie. Während du also nach deiner Impfung brav im Wartezimmer sitzen bleibst, um eine allergische Reaktion auszuschließen, liest Nathalie Claus "Die Schutzimpfung". Hier der Link zum Text: http://www.zeno.org/Literatur/M/Wedekind,+Frank/Erz%C3%A4hlung/Die+Schutzimpfung
BGB Schuldrecht AT - Folge 22: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
§ 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Erfüllungsübernahme, Schuldbeitritt, Vertragsübernahme, Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
BGB Schuldrecht AT - Folge 23: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis; Gläubiger- und Schuldnermehrheiten
Noch § 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Voraussetzungen, Rechtsfolge, Beispiele, Vorverlagerung in das Vertragsanbahnungsverhältnis (§ 311 III BGB); § 15 Gläubiger- und Schuldnermehrheiten: Schuldnermehrheit (§ 420 ff BGB): Teilschuld (§ 420 BGB), Gesamtschuld (§ 421 BGB), "Gesamthandsschuld"
«Emix Trading» hat mit dem Handel mutmasslich gefälschter Masken Millionen gemacht. In einem Kantonsspital kamen Masken fast ohne Schutzwirkung zum Einsatz. Zudem: Flüchtlinge berichten aus dem abgeriegelten Lager auf Lesbos. Und: Extremer Kampfsport in Russland. Masken-Debakel: Überteuert, gefälscht, nutzlos Die zwei jungen Masken-Millionäre der «Emix Trading» haben der Armee 650'000 mutmasslich gefälschte Masken verkauft. Jetzt deckt die «Rundschau» auf: Die Händler drehten auch einem Kantonsspital überteuerte und gefälschte Masken an. Der Test zeigt: Deren Filterleistung ist so schlecht, dass das Gesundheitspersonal damit kaum geschützt war. Die Hölle von Lesbos: Inside-Bericht aus dem Flüchtlingslager Das grösste Flüchtlingslager Europas galt als Hölle – im September brannte Moria mitten in der Pandemie nieder. Die internationale Betroffenheit war gross, auch die Schweiz schickte Geld und Helfende. Aber fünf Monate nach dem Inferno ist die Lage auf Lesbos hoffnungsloser denn je. Für die «Rundschau» berichten Flüchtlinge selbst aus dem neuen Lager, das nach dem Brand aufgebaut wurde. Im Interview stellt sich Mario Gattiker, Chef des Staatssekretariats für Migration, der Frage, warum die Schweiz nicht mehr Flüchtlinge aus Lesbos aufnimmt. Russlands Extrem-Kämpfer: Mit Fäusten aus der Armut In Russland ist der extreme Kampfsport viel mehr als Sport: Mixed-Martial-Arts-Kämpfer sind Superstars, angehimmelt von den Fans, umgarnt von Politikern. Der Kampfsport ist ein Weg sozialen Aufstiegs aber auch ein Instrument für Politik und Propaganda: Der russische Mann wird gefeiert als unbesiegbarer Verteidiger des Vaterlandes.
«Emix Trading» hat mit dem Handel mutmasslich gefälschter Masken Millionen gemacht. In einem Kantonsspital kamen Masken fast ohne Schutzwirkung zum Einsatz. Zudem: Flüchtlinge berichten aus dem abgeriegelten Lager auf Lesbos. Und: Extremer Kampfsport in Russland. Masken-Debakel: Überteuert, gefälscht, nutzlos Die zwei jungen Masken-Millionäre der «Emix Trading» haben der Armee 650'000 mutmasslich gefälschte Masken verkauft. Jetzt deckt die «Rundschau» auf: Die Händler drehten auch einem Kantonsspital überteuerte und gefälschte Masken an. Der Test zeigt: Deren Filterleistung ist so schlecht, dass das Gesundheitspersonal damit kaum geschützt war. Die Hölle von Lesbos: Inside-Bericht aus dem Flüchtlingslager Das grösste Flüchtlingslager Europas galt als Hölle – im September brannte Moria mitten in der Pandemie nieder. Die internationale Betroffenheit war gross, auch die Schweiz schickte Geld und Helfende. Aber fünf Monate nach dem Inferno ist die Lage auf Lesbos hoffnungsloser denn je. Für die «Rundschau» berichten Flüchtlinge selbst aus dem neuen Lager, das nach dem Brand aufgebaut wurde. Im Interview stellt sich Mario Gattiker, Chef des Staatssekretariats für Migration, der Frage, warum die Schweiz nicht mehr Flüchtlinge aus Lesbos aufnimmt. Russlands Extrem-Kämpfer: Mit Fäusten aus der Armut In Russland ist der extreme Kampfsport viel mehr als Sport: Mixed-Martial-Arts-Kämpfer sind Superstars, angehimmelt von den Fans, umgarnt von Politikern. Der Kampfsport ist ein Weg sozialen Aufstiegs aber auch ein Instrument für Politik und Propaganda: Der russische Mann wird gefeiert als unbesiegbarer Verteidiger des Vaterlandes.
Corona-News mit Dr. Christoph Spinner (23.02.2021)
Eine Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks mit Dr. Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar rund um Corona: Klinikalltag, Therapie von Covid-19-Patienten und aktuelle Forschungsthemen. Am 23. Februar 2021 geht es um Impfstoffe und ihre Schutzwirkung, um Pooltests, Priorisierung von Lehrer*innen beim Impfen und den Sinn und Unsinn von Doppelmasken.
RKI räumt ein: Geringe Evidenz für eine Wirksamkeit der Impfung bei alten Menschen | Von Paul Schreyer
Ein Standpunkt von Paul Schreyer. Betrachtet man die Berichterstattung in den großen Medien, dann springt einem überall eine Zahl entgegen: Die Wirksamkeit des Impfstoffes betrage „95 Prozent“. Die Tagesschau hatte schon Anfang Dezember unter der Überschrift „Keine Bedenken gegen Biontech-Impfstoff“ entsprechend berichtet: „Wenige Tage vor der Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA dem Impfstoff von Biontech und Pfizer ein gutes Zeugnis ausgestellt. Es bestehe eine hohe Schutzwirkung, hieß es. (…) Zudem bestätigte die FDA Angaben von Pfizer und Biontech, dass ihr Impfstoff zu 95 Prozent wirksam ist.“ Der SPIEGEL zitierte vergangene Woche eine Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) – das in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen verantwortlich ist –, wo diese Zahl ebenfalls wiederholt wurde: „Die Schutzwirkung gegen eine Covid-19-Erkrankung beträgt nach der zweiten Impfdosis bei Moderna sowie bei Biontech/Pfizer ungefähr 95 Prozent, bestätigte der PEI-Präsident Cichutek. Damit seien fast alle Menschen mit einer Impfung geschützt, bis auf wenige Ausnahmen. Bisher seien das aber vor allem 'statistische Unsicherheiten', konkrete Fälle einer Nichtwirksamkeit gibt es in Deutschland bisher noch nicht.“ Statistische Unsicherheiten? In einer Fachpublikation des RKI, dem „Epidemiologischen Bulletin“, wurden am 8. Januar die Studienergebnisse von Biontech und Moderna, die der amtlichen Zulassung zugrunde liegen, detailliert auf 74 Seiten vorgestellt. Autoren sind die Mitglieder der AG Covid-19 der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim RKI. Offenbar haben viele Journalisten ein gründliches Studium der dort dargelegten Einzelheiten bislang nicht für nötig gehalten. Ansonsten müssten die aktuellen Schlagzeilen anders lauten. Denn das Papier enthält Sprengstoff – der allerdings mit Rhetorik und Fachjargon kaschiert wird. „Effektivität der Impfung mit hoher Unsicherheit behaftet“ So heißt es in dem Dokument mit Blick auf den Biontech-Impfstoff, die Wirksamkeit der Impfung sei bei Menschen ab 75 Jahre „nicht mehr statistisch signifikant“ schätzbar und „mit hoher Unsicherheit behaftet“. Anders gesagt: Inwieweit alte Menschen durch die Impfung vor Corona geschützt sind, ist vollkommen unklar. Im RKI-Papier liest sich das so…weiterlesen hier: https://kenfm.de/rki-raeumt-ein-geringe-evidenz-fuer-eine-wirksamkeit-der-impfung-bei-alten-menschen-von-paul-schreyer/ Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde https://de.tipeee.com/kenfm https://flattr.com/@KenFM Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/ Du kannst uns auch mit Bitcoins unterstützen. BitCoin-Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/ KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/ Website und Social Media: https://www.kenfm.de https://www.twitter.com/TeamKenFMhttps://www.instagram.com/kenfm.de/ https://soundcloud.com/ken-fm See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
31.12.2020 – Langsam gesprochene Nachrichten
Langsam gesprochene Nachrichten | Deutsch lernen | Deutsche Welle
Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Donnerstag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.China genehmigt ersten Impfstoff Der Impfstoff des Arzneimittelherstellers Sinopharm erhält eine bedingte Zulassung im Herkunftsland China. Die Daten hätten gezeigt, dass das Vakzin die einschlägigen Standards der Weltgesundheitsorganisation und der Nationalen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde erfülle, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. In Zukunft müssten die Haltbarkeit und die Schutzwirkung der Impfimmunität kontinuierlich beobachtet werden. Nach Angaben von Sinopharm bietet der Impfstoff einen mehr als 79-prozentigen Schutz vor COVID-19. Merkel nennt Pandemie "Jahrhundertaufgabe" In ihrer letzten Neujahrsansprache stimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Deutschen auf weitere Belastungen in der Corona-Krise ein. Der Winter werde hart, und jeder müsse seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, heißt es in dem vorab verbreiteten Redetext. Das Virus habe die Menschen dort getroffen, wo sie am allermenschlichsten seien: im engen Kontakt, im Gespräch, beim Feiern. Die Pandemie war und sei eine "politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe", sagte Merkel. Angesichts der angelaufenen Impfungen blicke sie aber hoffnungsvoll ins neue Jahr. Irland wieder im Corona-Lockdown In Irland hat die Regierung wegen der Corona-Pandemie einen Lockdown von mindestens einem Monat verhängt. Ab sofort sind private Besuche ebenso verboten wie öffentliche Versammlungen. Ausnahmen gibt es nur für Hochzeiten und Beerdigungen im kleinen Kreis. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch für die Arbeit, die Ausbildung und andere notwendige Zwecke wie Einkäufe oder Arztbesuche verlassen. Regierungschef Micheál Martin begründete den inzwischen dritten Lockdown mit dem starken Anstieg der Neuinfektionen und der schnellen Verbreitung der neuen Virus-Variante aus Großbritannien. Brexit-Handelsabkommen nimmt letzte Hürden In Großbritannien haben beide Kammern des Parlaments das Post-Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt. Königin Elizabeth II. setzte das Ratifizierungsgesetz noch in der Nacht als Staatsoberhaupt in Kraft. Damit ist der Weg für den Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union frei. Mit dem Abkommen wird ein harter wirtschaftlicher Bruch vermieden, wenn Großbritannien in der Nacht zum Freitag nach elf Monaten Übergangsfrist auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion austritt. Die EU-Spitze hatte den Brexit-Handelspakt bereits am Mittwochmorgen unterzeichnet. Migranten zurück im Lager Lipa In Bosnien ist der Versuch gescheitert, rund 500 Migranten aus dem ausgebrannten Camp Lipa bei Bihac in einer leerstehenden Kaserne bei Sarajevo unterzubringen. Nach Protesten von Politikern und Anwohnern der Ortschaft, die nicht möchten, dass die Menschen in ihrer Nachbarschaft untergebracht werden, wurde die Verlegung der Migranten gestoppt. Hunderte Menschen sind ins ausgebrannte Lager zurückgekehrt, nachdem sie die Nacht über in Bussen auf ihren Transport in ein Ersatzquartier gewartet hatten. Neue US-Strafzölle auf EU-Produkte Im Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing liegen die USA und die EU weiter im Clinch. Die Vereinigten Staaten haben nun ihre Strafzölle ausgeweitet. Besonders betroffen sind Flugzeugbauteile aus Frankreich und Deutschland, aber auch bestimmte Weine und andere Spirituosen. Die Europäische Union hatte im November Zusatzabgaben auf bestimmte US-Produkte angekündigt. Daraufhin beschuldigte die US-Regierung Brüssel, bei der Verhängung der Zölle unfaire Entscheidungen getroffen zu haben. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, ihre Flugzeugbauer rechtswidrig zu unterstützen. Anschlag auf Airport Aden Bei Explosionen auf dem Flughafen der jemenitischen Stadt Aden sind mindestens 26 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Ärzten wurden mehr als 50 Menschen verletzt. Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich nach der Landung eines Flugzeugs mit Mitgliedern der neuen Einheitsregierung, die erst vor kurzem in Saudi-Arabien vereidigt worden war. Jemens Informationsminister Muammar al-Irjani machte die schiitischen Huthi-Rebellen für den Angriff verantwortlich. Nach seinen Angaben kamen keine Regierungsmitglieder zu Schaden. Das deutsche Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Tat als "feigen Anschlag".
Der Störenfriedrich. Ein Amtsarzt widerspricht Markus Söder und wird zwangsisoliert.
Der Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg hat zunächst intern, dann öffentlich die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung zur Bekämpfung der Corona-Krise infrage gestellt. Friedrich Pürner kritisiert unter anderem Massentests, die Gesunde zu Kranken machen, und Communitymasken ohne echte Schutzwirkung. Sein Einspruch hat ihn den Job gekostet, aber viel Aufmerksamkeit und Anerkennung eingebracht. Im Interview mit den NachDenkSeitenWeiterlesen
Die Firma Biontech aus Mainz hat gemeinsam mit ihrer Partner Pfizer aus den USA angekündigt, in naher Zukunft eine Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zu beantragen. Zwar sind noch keine genauen wissenschaftlichen Daten veröffentlicht worden, doch sorgen die bisherigen Aussagen über den Stoff für Optimismus, da von einer 90% Schutzwirkung gegen symptomatische Erkrankungen an Covid-19 ausgegangen wird. Ich spreche wider mit Lars Fischer, was wir bisher wissen, welchen Funktionsweg dieser Impfstoff im Körper nimmt und auf welche Art und Weise er gegen eine Infektion schützt. Wir diskutieren auch, welche Fälle hier ggf. noch nicht abgedeckt sind und wie eine Verteilung dieses Impfstoffes aussehen könnte.
Gut geschützt durch den Tag. So haben fremde Energien keine Chance.
Energetischer Schutz ist eines der grundlegenden Themen in der Spiritualität, ähnlich wie gute Erdung (Podcast Folge Nr. 18) und ein gesundes Energiefeld (Podcast Folge Nr. 13). Deshalb ist diese Podcast Folge allein diesem Thema gewidmet. Warum schützen? Damit Du nicht die Energien anderer Menschen Wenn Du z.B. an stark besuchten Plätzen bist, ins Fußball Stadion gehst, auf einer Demo bist etc. Wenn Du empathisch oder hochsensibel bist, kann es dir leicht passieren, dass Du Energien und Emotionen anderer Menschen aufnimmst und diese Dich beeinträchtigt. Damit sich Elementale & Dämonen nicht anhaften können. Elementale sind abgespaltene Energien und Emotionen, die sich verselbständigen und sich frei von ihrem „Erschaffer“ bewegen können. Dies kann z.B. geschehen, wenn Du Dich lange mit einem Gefühl nicht beschäftigst und es ständig unter den Teppich kehrst. Wenn Du z.B. nach dem Tod eines geliebten Menschen Dich nicht mit dem Verlust und der Trauer beschäftigen möchtest. Du verdrängst die Gefühle, doch verlieren sie dadurch nicht ihre Energie. Im Gegenteil. Die Energie sammelt sich und sammelt sich und wird irgendwann so stark, dass sie unabhängig von Dir ein „Eigenleben“ führen kann. Im genannten Beispiel würde ein Trauer-Elemental entstehen. Diese Energie kann sich dann auch an andere Menschen anhaften. Dämonen: Menschen gemachte Dämonen entstehen nach dem gleichen Prinzip wie Elementale. Allerdings sind sie stärker. Sie üben oft eine Schutzwirkung für ihren „Erschaffer“ aus. (Mehr Infos auch unter dem Punkt „energetische Angriffe“) Erdgebundene Seelen: Wenn Menschen sterben, verabschieden sich ihre Seelen erst einmal in Ruhe von der Erde und den Liebsten. Das ist normal. Aber manchmal bleiben Seelen länger. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Sie können sich nicht von geliebten Menschen trennen. Oder ihr Tod war so plötzlich, dass sie nicht realisieren, dass sie gestorben sind. Manche haben eine große Angst vor der Hölle und wollen deshalb nicht gehen. Auch nach einem Suizid ist die Seele oft erst einmal sehr verstört und hat keinen Bick für das Licht, mit dem sie aufsteigen könnte um die Erde zu verlassen. Hierzu ein sehr persönliches Beispiel: Meine Stiefmutter starb bei einem Autounfall. Mein Vater saß neben ihr auf dem Beifahrer Sitz. Da er 10 Jahre zuvor bereits meine Mutter aufgrund einer Krebserkrankung verloren hatte, kam er nicht über diesen weiteren Verlust hinweg. Die Seele meiner Stiefmutter blieb daraufhin über 15 Jahre bei ihm. Man konnte es z.B. daran merken, dass er sich sehr häufig versprach und andere Menschen mit ihrem Namen ansprach. Erst als ich meine spirituelle Coaching Ausbildung gemacht hatte, konnte ich ihr helfen, ins Licht zu gehen. Solche erdgebundenen Seelen können sich an andere lebende Menschen heften. Meist suchen sie Hilfe. Wenn Du sehr lichtvoll bist, kann es auch sein, dass eine Seele Dich mit "dem Licht" verwechselt. Manche spirituelle Menschen ziehen erdgebundene Seelen magnetisch an und haben eine große Last damit. Denn sie stören das eigene Energiesystem, man empfindet plötzlich ihre Emotionen, ist nicht mehr sich selbst, kann sich nicht mehr gut entscheiden. In diesem Fall ist energetischer Schutz angebracht. Vor allem wenn Duauf den Friedhof oder zu einer Beerdigung gehst. Energetische Angriffe: Worte haben mehr Macht, als wir denken. Etwas unbedacht im Zorn gesprochen kann einen anderen Menschen stark beeinflussen. Ich hatte einmal eine Freundin, die plötzlich eine massive Eifersucht auf mich entwickelte. Weil mir alles leichter fiel, ich Klient*innen anzog, eine Beziehung hatte, eine schöne Wohnung etc. Mir ging es in dieser Zeit furchtbar. Ihre Ablehnung mir gegenüber war für mich körperlich spürbar. Ich bekam Gelenkschmerzen. Meine Computer-Technik versagte, ein Webinar brach zusammen. Plötzlich blieben die Klient*innen aus. Sie hatte mich unbewusst sogar verflucht. Ihr Eifersuchts-Dämon wütete in meinem Leben. Hier ist Schutz unabdingbar. Allerdings hat es in diesem Fall bei weitem nicht ausgereicht, denn da sie mir sehr nah war, kam sie trotz Schutz an mich ran. Ich habe vier Wochen gebraucht, bis ich alle Anker- und Schadenspunkte aufgelöst hatte, so dass sie nicht mehr an mich rankam. Ich musste leider den Kontakt zu ihr ganz abbrechen. Warum kann fremde Energie an uns haften? Nicht jeder Mensch hat das Problem, dass sich fremde Energien an ihn binden. Wenn wir dauerhaft in einer hohen Frequenz sind, optimal geerdet und unsere eigenen Themen weitgehend bearbeitet haben, wird dies weniger und weniger. Hier die Gründe in der Übersicht: Deine Frequenz sinkt aufgrund von Stress, Müdigkeit oder Krankheit. Durch diesen „Energie-Abfall“ bist Du nicht mehr in einem optimalen Energie Fluss und schädliche Energien können eher an Dir haften. Je negativer eine Energie, je niedriger schwingt sie. Scham ist z.B. eine der am niedrigsten schwingenden Emotionen. Fühlst Du Dich furchtbar, kann auch „Fürchterliches“ an Dir haften. (Weiterführende Informationen zu der Frequenz von Emotionen und Zuständen gibt es hier https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Skala#toc2) Resonanz zu einem Thema: Du hast ein ähnliches Thema wie Deine Freundin, die Dir gerade ihr Herz ausschüttet? Es ist wahrscheinlich, dass Du Energie von ihr aufnimmst und dich selbst plötzlich schlecht fühlst. Ich habe früh in meinem Leben geliebte Menschen an den Tod verloren. Ich habe also häufig getrauert und war tief traurig. Deshalb habe ich bevorzugt die Traurigkeits-Energie anderer Lebewesen aufgenommen. Heute hängt sich nur noch sehr selten fremde Traurigkeit an mich an. Kollektive Felder: Kollektive Energien stammen nicht nur von einem Menschen sondern sie werden von vielen Personen gleichzeitig genährt. Zur Zeit des Corona Lock-Downs gab es besonders viele Beispiele kollektiver Felder und es war schwer, sich immer davon zu lösen. Z.B. waren die Angst vor dem Tod, die Angst vor Mangel und die Angst vor Krankheit sehr aktiv. Bist Du ein sensibler Mensch, dann spürst Du diese kollektiven Emotionen intensiv. Obwohl es Dir eben noch gut ging, kann Deine Stimmung plötzlich kippen und Du fühlst Dich ängstlich. Das kann mit kollektiven Feldern zu tun haben. Rissige Aura: Hast Du in Deinem Leben viele Verletzungen erfahren? Dann geht das auch nicht spurlos an Deinem Energiesystem (Aura und Chakren) vorüber. Dein erlittener Schmerz ist noch in Dir gespeichert und macht Dich anfällig. Zu diesem Thema gibt es bereits eine Podcast Folge (Nr. 13). Wie schützt Du Dich am besten? Es gibt viele Möglichkeiten, Dich zu schützen und im Podcast stelle ich dir einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten zusammen. So ist auf jeden Fall auch die richtige Methode für Dich dabei: Visualisiere Dir eine Schutzkugel um dich herum. Mache sie so groß, dass Du Dich optimal in ihr wohl fühlst. Wenn Du möchtest, gib ihrer Hülle eine Farbe. Blau ist z.B. eine gute Schutzfarbe. Oder stelle Dir vor, sie ist von außen verspiegelt und alles was nicht zu Deinem höchsten Wohle dient, wird reflektiert und kann Dich nicht erreichen. Nutze die Diamamt-Technik zum Wegschicken fremder Energien. Diese Methode habe ich bereits im Podcast Nr. 13 erklärt. Stelle Dir vor, Du stehst in einem Diamant. Er ist genauso groß, dass Du Dich optimal wohl fühlst. Der Edelstein reinigt und verfeinert jede Energie, die ihn durchfließt. Bis sie bei Dir angekommen ist, ist sie vollkommen gereinigt. Bitte Dein Schutztier/ Seelentier, Dich zu unterstützen. Jeder Mensch hat einen tierischen Begleiter. Wenn es ein wehrhaftes Tier ist, wird es Dich sehr gerne verteidigen, wenn Du es darum bittest. Stelle Dich gedanklich in einen Würfel. So wie Du eine Schutzkugel visualisierst, kannst Du Dir vorstellen, Du stehst in einem Würfel. Im Unterschied zur Kugel erdet diese geometrische Form intensiv. Außerdem werden Deine Energien komprimiert und gespeichert. So bist Du energetisch kompakt und Fremdes kann nicht mehr so leicht in Dich eindringen. Energien durchfließen lassen. Ich habe mich lange eingesperrt gefühlt, wenn ich eine Schutzkugel um mich herum visualisiert habe. Deshalb bin ich dazu übergegangen, fremde Energien einfach durch mich durch fließen zu lassen. Ich stelle mir vor, wie nichts an mir haftet, sondern einfach nur vorbei strömt oder durch mich durch. Es kommt - aber ebenso schnell geht es auch wieder. Lichtdusche. Diese Methode ähnelt dem „Energien durchfließen lassen“. Stelle Dir vor, dass Dich göttliches (oder universelles) Licht dauerhaft durchflutet. Es strömt konstant aus dem Himmel zu Dir hinunter. Durch den permanenten Energiestrom kann sich nichts an Dich binden, was Dir nicht zu 100% dient. Gute Erdung und eine permanente Anbindung zwischen Himmel und Erde stärken dein Energie System (siehe Podcast Folge 18). Erhöhe Deine Frequenz: z.B. durch Lachen, Dankbarkeit, Liebe. Erinnere Dich an eine Situation, in der Du unglaublich viel Liebe oder Dankbarkeit gefühlt hast und verteile dieses Gefühl in Deinem Körper. Schutzsteine: schwarzer Turmalin oder schwarzer Onyx schützen vor fremden Energien, in dem sie diese an sich binden. Deshalb ist gute Reinigung dieser Steine enorm wichtig, dass sie nicht die niedrigen Frequenzen wieder an Dich abgeben. Lass Dich in einem Edelsteinladen beraten. Energetische Hilfsmittel: Es gibt energetisierte Aura-Sprays, die Schutz versprechen. Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn Du schon müde und erschöpft bist oder Dich angegriffen fühlst. Dann kann evtl. Deine Kraft für einen guten Schutz nicht mehr ausreichen. Visualisiere Schutzzeichen: z.B. das Jerusalem Kreuz (siehe Bild) oder sogar das Stoppschild. Stelle Dir vor, in alle vier Himmelsrichtungen stellst Du das Zeichen auf, ebenso nach oben und unten. Setze dabei die Absicht, dass Dich nur noch die Energie erreicht, die Dir zu 100% körperlich, geistig und seelisch dient. Leuchtturm sein - nicht Schwamm: Wenn Du Energie aussendest, leuchtest und strahlst, dann kommt wenig an Dich heran. Du hebst sogar Deine Frequenz und die der Menschen und der Erde um Dich herum. Bleibe in deinem Körper. „Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“. Wenn Du mit Deiner Seele und Deinem Geist nicht in Deinem Körper bist, dann ist es wahrscheinlicher, dass fremde Energien diesen Platz einnehmen. ______________________________________________________________________ Möchtest Du noch mehr Folgen von Higher Love hören? Hier findest Du alle Folgen und Abo-Möglichkeiten meines Podcasts: https://www.britta-trachsel.de/podcast/ Lust auf aktuelle Neuigkeiten von mir? Abonniere meinen Newsletter: https://seu2.cleverreach.com/f/250823-247206/ Mehr über mich auf meiner Homepage: https://www.britta-trachsel.de/ Folge mir auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/brittatrachsel_higherlove/ Facebook: https://www.facebook.com/Britta-Trachsel-Higher-Love-101889911559391/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/britta-trachsel/
Das Schönste zum Schluss: Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, Drittschadensliquidation!
S1|F29: Der Gemüseblatt-Fall – C.i.c. und Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
In der heutigen Episode geht es um den Gemüseblatt-Fall: Der Klassiker schlechthin, um den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu erörtern. Dabei stellt sich die Frage, ob die vertragliche Schutzwirkung aus §§ 311 II, 241 II BGB auch auf Dritte übertragen werden kann – und woher sich diese dogmatische Frage überhaupt herleiten lässt.
von Jürgen Vagt 02.01.20 Delphi Methode: Mit der Delphi – Methode wird in der heutigen Podcast Episode eine Methode der Zukunftsforschung vorgestellt. Die Delphi Methode ist eine gestufte Befragung von Experten aus verschiedenen Disziplinen, um eine Zukunftsversion zu bestimmen. Das Meinungsspektrum wird durch einen gestuften Prozess auf einen Mittelwert verengt, sodass ein breiter und mit Expertenmeinungen fundierter Konsens gefunden wird. Allerdings ist die Delphi Methode eine sehr aufwändige Methode, die hauptsächlich gesellschaftliche Veränderungen mit Zeithorizonten von mehreren Jahrzehnten prognostiziert wird. Blockchain-Strategie Deutschland: Die Bundesregierung hat ihre Blockchain Strategie vorgelegt und für Verwirrung gesorgt. Einerseits soll die Blockchain bürokratisiert und zentralisiert werden und damit soll die Wettbewerbsposition Deutschlands verbessert werden. Leider kann das Bundesfinanzministerium diese Strategie und wie die Bundesregierung auf die neue Facebook- Währung Libra reagieren nicht erklären. Fragen über Fragen. Sozialunternehmen: Sozialunternehmen sind eine neue Form und man kann Sie als Zwischending zwischen den konventionellen, gewinnorientierten Unternehmen und den klassischen NGOs verstehen. Hier kann das unternehmerische Effizienzstreben mit sozialen Zielsetzungen kombiniert werden und es gibt eben auch ähnliche Strukturen wie in der normalen Unternehmensgründung. Mindmapping: Mindmapping ist eine sehr bekannte Kreativitätstechnik, die selbst in Schulen angewendet wird. In meinem Beitrag schaue ich mir die Grundlagen, dieser Technik an. Mindmapping ist gehirngerecht und passt sehr gut zu unserer Art des Denkens und so ist Mindmapping auch hilfreich beim Lernen. Zudem sind Mindmaps auch hilfreich, um mit der Informationsüberflutung unsere Zeit fertig zu werden. Wenn man die 1990er Jahre als Referenz nimmt, dann gibt es immer mehr Informationen alleine durch das Internet. Innovation und Patente: Patente haben an Bedeutung verloren, aber trotzdem sollte man verstehen, was Patente sind und welche Ideen durch Patente geschützt werden können. Kann man Patente mit Innovationen gleichsetzen? Nein, aber trotzdem gibt es eine interessante Schutzwirkung und wie das Beispiel Elektromobilität zeigt. Sind Patente Innovationsbremsen und können den Markthochlauf einer Innovation verhindern? Insbesondere in der Softwarewelt sind Patente problematisch. § 5 TMG: Jürgen Vagt Birkenweg 3 23858 Reinfeld Telefon: +49 4533 – 36 90 Email: juergen.vagt@elektroautovergleich.org § 55 Abs. 2 RStV: Jürgen Vagt Birkenweg 3 23858 Reinfeld http://elektroautovergleich.org/ http://automatisiertes-auto.de/
#126 - Was ist eigentlich ein Captcha?
IT Manager Podcast (DE, german) - IT-Begriffe einfach und verständlich erklärt
Jeder kennt sie, niemand mag sie: CAPTCHAs. Vermutlich haben Sie auch des Öfteren Straßenschilder abgetippt, verzerrte und oftmals undefinierbare Ziffern wiedergegeben oder auch nur Tierbilder ausgewählt, um zu bezeugen, dass sie kein Roboter, sondern ein echter Webseitenbesucher mit Herz & Seele sind, richtig? Der Begriff “CAPTCHA” steht für “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”. Frei übersetzt handelt es sich dabei also um einen „Test zur Unterscheidung zwischen Menschen und Computer“. CAPTCHAs dienen der IT-Sicherheit und werden oft als Sicherheitsmechanismus eingesetzt, um interaktive Webseiten vor Missbrauch zu schützen und automatische Eingaben oder Abfragen von Spam- und Click-Robotern (Bots) abzuwehren. Man findet sie heutzutage nahezu in allen Bereichen, in denen es menschliche Nutzer von Bots zu unterscheiden gilt. Das betrifft beispielsweise Anmeldeformulare für E-Mail-Services, Newsletter, Communities und soziale-Netzwerke, aber auch Online-Umfragen oder Web-Services wie Suchmaschinendienste. In der Regel handelt es sich bei CAPTCHAs meist um Challenge-Response-Tests, bei denen der Webseitenbesucher eine Aufgabe, die sogenannte Challenge, lösen und das entsprechende Ergebnis (Response) zurückschicken muss. Diese Art von Sicherheitsabfragen können menschliche Nutzer ohne weiteres bewältigen, während sie automatisierte Bots vor ein nahezu unlösbares Problem stellen. Welche Arten von CAPTCHAs gibt es heutzutage? Grundsätzlich lassen sich CAPTCHAS in text- und bildbasierte CAPTCHAs, Logik- und Frage-CAPTCHAs, Audio CAPTCHAs und Gamification CAPTCHAs unterteilen. Textbasierte CAPTCHAs: Sie ist die älteste Form der Human Verifikation. Textbasierte CAPTCHAs zeigen verzerrte Wörter, Buchstaben oder Zahlen mit zusätzlichen grafischen Elementen wie Linien, Bögen, Punkten oder Farbverläufen. Der Webseitenbesucher muss diese entziffern und ins Eingabefeld eintragen. Klassische Verfahren, die bei der Erstellung textbasierter CAPTCHAs zum Einsatz kommen, sind Gimpy, ez-Gimpy, Gimpy-r und Simard’s HIP. reCAPTCHA: Eine prominente Variante des klassischen Text-CAPTCHAs bietet Google mit reCAPTCHA an. Statt zufällige Lösungswörter zu generieren, bekommen Nutzer beispielsweise Straßennamen, Hausnummern, Verkehrs- und Ortsschilder sowie Fragmente eingescannter Textabschnitte angezeigt, die sie entziffern und über die Tastatur in ein Textfeld eingeben müssen. Bildbasierte CAPTCHAs zeigen mehrere Bilder an und fordern den User etwa dazu auf, sämtliche Bilder mit einer Ampel zu markieren. Die Anwendung fällt leichter und die Schutzwirkung gilt als relativ hoch. ● Audio-CAPTCHAs ermöglichen auch sehbehinderten Menschen einen Zugang zu catch-geschützten Bereichen einer Webanwendung. In der Regel werden text- oder bildbasierte Prüfverfahren mit sogenannten Audio-CAPTCHAs kombiniert. Oft wird dazu eine Schaltfläche implementiert, mit der Nutzer bei Bedarf ersatzweise eine Audio-Aufnahme abrufen – zum Beispiel eine kurze Zahlenfolge, die in ein dafür vorgesehenes Eingabefeld eingetippt wird. Logik-CAPTCHAs zeigen beispielsweise leichte Mathematik-Aufgaben, wie „Was ist die Summe aus 3+6?“. Die Aufgabe können aber auch Bots leicht lösen. Schwieriger ist eine Aufgabe wie „Berechne 3+6 und trage die ersten zwei Buchstaben der errechneten Ziffer ins Feld ein“. Hier wäre „ne“ der richtige CAPTCHA-Code. Gamification CAPTCHAs, sind mehr oder weniger unterhaltsame Minispiele, bei denen der Anwender beispielsweise Puzzleteile mit der Maus an die richtige Stelle rücken muss. Bevor wir zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, möchte ich noch ganz kurz auf die Frage eingehen: Gibt es alternative Lösungen zu CAPTCHAs? Obwohl CAPTCHAs zu den weitverbreitetsten Sicherheitsabfragen zur Erkennung von maschinellen Zugriffen zählen, gibt es auch alternative Sicherheitsmechanismen. Zu bekannten Alternativen gehören unter anderem: Black-Lists: Sobald Webseitenbetreiber vermehrt Spambeiträgen oder massenhafte, automatische Abfragen aus einer bestimmten Quelle verzeichnen, können sie die Black List, eine sogenannte Sperrliste nutzen, um alle Server oder IP-Adressen aufzuführen, die bei zukünftigen Abfragen blockiert werden sollen. Honeypots: Ein Honeypot ist ein für den Nutzer nicht sichtbares Formularfeld. Es stellt eine Falle für die Bots dar. Diese füllen in der Regel alle Formularfelder aus. Sie können nicht erkennen, dass das Honeypot-Feld für den Nutzer nicht sichtbar ist. Folglich wird es von Bots mit ausgefüllt. Der Nutzer hingegen sieht das Feld ja nicht und lässt es leer. Somit kann der übertragene Inhalt von der Webseite leicht als Spam erkannt werden. Content-Filter: Content-Filter bieten eine Möglichkeit, Kommentarspam auf Blogs, in Onlineshops oder Foren entgegenzuwirken. Auch diese arbeiten mit Black-Lists. Dabei definieren Webseitenbetreiber sogenannte „Hot Words“, Keywords die in erster Linie im Rahmen von Spam-Kommentaren vorkommen, um verdächtige Eingaben automatisch als computergeneriert zu identifizieren. Kommen Content-Filter zum Einsatz, steigt jedoch die Gefahr, dass auch Beiträge menschlicher Nutzer blockiert werden, sofern diese Keywords der Black-List enthalten. Serverseitige Filterung: Auf den meisten Webservern kommt eine Filter-Software zum Einsatz, die es ermöglicht, auffällige Interaktionen mit bestimmten Bereichen einer Website zu erkennen und so den Schaden durch Spam-Bots zu begrenzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, CAPTCHAs können effektiv vor automatisierten und maschinell verbreiteten Spam-Nachrichten schützen. Obwohl die CAPTCHA-Technologie mit Einbußen in der Benutzerfreundlichkeit einhergeht und insbesondere Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen eine zusätzliche Barriere darstellt, ist sie für den Schutz einer Website oder eines Dienstes unverzichtbar. Kontakt: Ingo Lücker, ingo.luecker@itleague.de
Impfungen gegen Masern werden von den meisten Eltern befürwortet
Die Mehrheit der Eltern spricht sich für eine verpflichtende Impfung gegen Masern aus. Rund acht von zehn Eltern befürworten, dass Kinder gegen Masern geimpft werden müssen. Etwa vier von zehn Befragten erwarten zudem, dass diese Pflicht auf alle Impfungen ausgeweitet wird, die für den Nachwuchs empfohlen werden. Das sind Ergebnisse der Studie "Junge Familien 2019" der pronova BKK, für die 1.000 Menschen mit mindestens einem Kind unter zehn Jahren im Haushalt befragt wurden. Demnach lehnen nur sieben Prozent jeglichen Impfzwang ab und sind der Ansicht, dass eine Entscheidung dafür oder dagegen einzig und allein im Verantwortungsbereich der Eltern liege. 18 Prozent sagen, sie könnten die Gründe der Impfgegner zumindest nachvollziehen. "Unsere Studie zeigt, dass das Thema zumindest unter Eltern weniger umstritten ist, als es die mediale Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen und Monaten vermuten ließ", sagt Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der pronova BKK. Das Bundeskabinett hat die Masern-Impfpflicht Mitte Juli verabschiedet. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab März 2020 Kinder nur dann in Kindergärten und Schulen aufgenommen werden dürfen, wenn sie gegen Masern geimpft sind. Die Impfpflicht gilt auch für Tagesmütter und das Personal in Schulen, Kitas, in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen. Der Impfschutz muss laut Gesetzesentwurf bis spätestens 31. Juli 2021 nachgewiesen werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Der Bundestag muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Insbesondere von Impfgegnern wird das Gesetz strikt abgelehnt. Klare Haltung von Seiten der Eltern "Junge Familien, die das Thema Impfungen am stärksten betrifft, positionieren sich in unserer Befragung eindeutig: Die große Mehrheit der Eltern weiß um die Schutzwirkung der Masernimpfung und möchte sie nicht missen. Die bestehende Impflücke macht daher vielen Eltern Sorgen", berichtet Herold von der pronova BKK. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind rund 93 Prozent der Schulanfänger wie empfohlen zwei Mal gegen Masern geimpft. Angestrebt wird eine Impfquote von 95 Prozent, damit die so genannte Herdenimmunität gewährleistet ist. Das bedeutet, dass die hochansteckende Krankheit sich nicht weiter ausbreiten kann und auch Menschen geschützt sind, die nicht geimpft werden können - zum Beispiel Säuglinge, die für eine Masernschutzimpfung noch zu jung sind. Impfen beschäftigt Familien im Alltag Jede vierte Familie berichtet, dass es in ihrem Alltag schon einmal Diskussionen oder Probleme rund um das Thema Impfen gab. So waren bei zehn Prozent der Befragten unterschiedliche Standpunkte im Familien- oder Freundeskreis Gesprächsthema. Sieben Prozent haben die Erfahrung gemacht, dass ein ungeimpftes Kind ein anderes oder einen Erwachsenen angesteckt hat. Impfskeptiker begründen ihre ablehnende Haltung vor allem mit möglichen Nebenwirkungen oder Komplikationen - in der Praxis haben laut der Umfrage jedoch lediglich vier Prozent der Eltern schon einmal unerwünschte Begleiterscheinungen nach einer Impfung bei ihrem Kind beobachtet. "Es ist wichtig, das Thema Impfen sachlich zu diskutieren und Aufklärungsarbeit zu leisten. In der Debatte beobachten wir, dass mitunter Ängste geschürt werden, die mit Fakten ausgeräumt werden könn(t)en", so Herold von der pronova BKK. pronova BKK Weitere Informationen zu Gesundheits- und Medizinthemen finden Sie auf MEDIZIN ASPEKTE
Schuldrecht AT - Folge 24
§ 14: Schuldbeitritt, Vertragsübernahme, Vertrag zugunsten Dritter und Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Schuldrecht AT - Folge 25
§ 14: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte § 15: Gläubiger und Schuldnermehrheiten § 16: Schadensersatzrecht
Folge 2: BGHZ 187, 86
LMU Wiederholung und Vertiefung zum Schuldrecht - Lehrstuhl für Bürgerliches Recht
"Klausurmäßige" Aufbereitung von BGHZ 187, 86: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, Drittschadensliquidation; Zurechnung von Mitverschulden des Gläubigers zu Lasten des Dritten (§ 334 BGB); Begriff des Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB); AGB-Kontrolle von einseitigen Rechtsgeschäften; Haftungsausschluss und § 309 Nr. 7 a, b BGB; Anrechnung der Tiergefahr (§ 833 BGB) im Rahmen des Mitverschuldens
Folge 3: BGHZ 187, 86 (Fortsetzung), BGH NJW 2013, 152
LMU Wiederholung und Vertiefung zum Schuldrecht - Lehrstuhl für Bürgerliches Recht
"Klausurmäßige" Aufbereitung von BGHZ 187, 86: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, Drittschadensliquidation; Zurechnung von Mitverschulden des Gläubigers zu Lasten des Dritten (§ 334 BGB); Begriff des Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB); AGB-Kontrolle von einseitigen Rechtsgeschäften; Fortsetzung der Veranstaltung vom 8.5.2013; "Klausurmäßige" Aufbereitung von BGH NJW 2013, 152 (Unmöglichkeit; Verweigerungsrecht nach § 275 II BGB); Domainnamensrecht, Prioritätsprinzip
BGB Schuldrecht AT - Folge 24: Vertrag zugunsten Dritter; Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis, Vertrag zug. Dritter; Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
BGB Schuldrecht AT - Folge 21: Schuldübernahme, Schuldbeitritt, Vertragsübernahme, Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Noch § 14: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis, Schuldübernahme, Schuldbeitritt, Vertrag zug. Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
BGB Schuldrecht AT - Folge 22: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte; Gläubiger- und Schuldnermehrheiten; Inhalt von Schadensersatzansprüchen
Noch § 14: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte § 15: Gläubiger- und Schuldnermehrheiten, insbes. Gesamtschuld § 16: Inhalt von Schadensersatzansprüchen
BGB Schuldrecht AT - Folge 25: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
Noch § 14: Vertrag zugunsten Dritter - insb. Wiederholung, Einwendungserhalt; Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte - Voraussetzungen, Fallbeispiele, Vorverlagerung in das vorvertragliche Schuldverhältnis, einseitige Rechtsgeschäfte, Haftungsmilderung
Folge 4: VSD & GoA
Kurznachrichten: BGH v. 17.03.2017 - V ZR 7/16 2002, 2875; Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter: BGH NJW 2011, 139 (Reitturnier), BGH NJW 2004, 3035 (Gutachterfälle), Vorverlagerung in das vorvertragliche Schuldverhältnis, Haftungsmilderung (Wachmannfälle); Geschäftsführung ohne Auftrag: Zentrale Anspruchsgrundlagen, Voraussetzungen
Folge 3: Werkvertragsrecht; VSD & DSL
Neues zur "Schwarzarbeit", Zeitpunkt des Entstehens der Rechte aus § 634 BGB, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, Drittschadensliquidation, Nitrirofen-Fall, Werkstattfall, "Verhütungsvertrag"
BGB Schuldrecht AT - Folge 25: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
§ 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertragsübernahme, Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
BGB Schuldrecht AT - Folge 26: Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis, Gläubiger und Schuldnermehrheiten
Achtung: Aufgrund technischer Probleme bei der Aufnahme besteht diese Folge aus den entsprechenden Folgen 25 und 26 des Grundkurses 2015/16! Noch § 14 Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis: Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Fallbeispiele, Vorverlagerung in das Vertragsanbahnungsverhältnis (§ 311 III BGB), Schutzwirkung für Dritte bei einseitigen Rechtsgeschäften; § 15 Gläubiger- und Schuldnermehrheiten: Schuldnermehrheit (§§ 420 ff. BGB): Teilschuld, Gesamtschuld: Charakteristik und praktische Bedeutung, Voraussetzungen, Gesamt- und Einzelwirkung (§§ 422 ff. BGB), Haftung im Innenverhältnis (§ 426 BGB)
BGB Schuldrecht AT - Folge 28: Schadensersatzrecht
Noch § 16 Der Inhalt von Schadensersatzansprüchen (Schadensersatzrecht): Grundsätze: Mitverschulden, Zurechnung des Mitverschuldens Dritter; Haftungsausfüllende Kausalität: Differenzhypothese, Einschränkungen: Adäquanztheorie, Schutzzweck der Norm; Drittschadensliquidation: Konstellation, Zufällige Schadensverlagerung, Abgrenzung zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, Fallgruppen, Folgen
15 Schutzbedürftigkeit Verträgen mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (Zivilrecht | Jura-Podcast)
Weitere Hinweise zum Urteil unter: www.examenspodcast.de/post/folge15
Untersuchung zur Wirksamkeit einer One-Shot-Impfung gegen Mycoplasma hyopneumoniae im Vergleich zu einer Two-Shot-Impfung bei Schweinen in einem Feldversuch
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
In der vorliegenden Studie wurden keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Tageszunahmnen, dem Lungenscore und der Mortalität zwischen zwei Impfgruppen ermittelt, die entweder mit der One-Shot-Vakzine Ingelvac MycoFLEX oder mit der Two-Shot-Vakzine Stellamune Mycoplasma geimpft wurden. Die Ergebnisse der serologischen Untersuchung ließen aufgrund der Serokonversion die Manifestation einer Feldinfektion mit M. hyopneumoniae am Ende der Aufzucht oder in der Mast vermuten. Eine impfinduzierte Serokonversion konnte nur bei maximal 25 % der Ferkel in der Stellamune-IG nachgewiesen werden. Anhand der humoralen Immunantwort auf die Impfung war in der vorliegenden Studie kein Rückschluss auf die Schutzwirkung möglich.
Untersuchungen zur Wirksamkeit einer homologen Ölemulsionsvakzine gegen die Paramyxovirose der Tauben basierend auf einem schwach virulenten Tauben-Stamm (P201)
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/07
Ein Tauben APMV-1 Impfstoff (ParamyxovacÒ, Fa. Intervet), der auf einem schwach virulenten homologen Tauben APMV-1 Stamm basiert, wurde auf seine Schutzwirkung nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten getestet. Anhand ungeimpfter Kontrolltiere wurde die Manifestation der experimentellen APMV-1 Infektion bei Tauben untersucht, unter besonderer Berücksichtigung der feingeweblichen Veränderungen. Bei den ungeimpften Kontrolltauben wurden durch die Infektion (10 5,5 EID50, i.m.) klassische neurologische APMV-1 Krankheitsanzeichen in Form von motorischen Ausfallserscheinungen der Flügel induziert. Histologisch war mit dem siebten Tag im Rückenmark im Bereich des Plexus lumbosacralis eine nicht-eitrige Panmyelopathie sowie eine nicht-eitrige Neuritis bzw. Ganglionitis nachweisbar. In den geschädigten Gebieten des Rückenmarks wurde immunhistochemisch APMV-1 Antigen nachgewiesen. Auch die histopathologischen Befunde der inneren Organe wiesen auf eine generalisierte Infektion hin. Neben einer nicht-eitrigen Pankreatitis, die bei 22 von 39 der Tauben auftrat, wurden bei 16 von 39 Tieren Nekrosen des Pankreasparenchyms und bei 3 von 29 Nekrosen des Nebennierenparenchyms beobachtet. Gegenüber uninfizierten Negativ-Kontrolltauben, bei denen in der Niere eine geringgradige Infiltration mit mononukleären Entzündungszellen zu beobachten war, trat bei den experimentell infizierten Tauben eine mittel- bis hochgradige nicht-eitrige, interstitielle Nephritis auf. Für den quantitativen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Gruppen wurde ein Histologischer Pathogenitätsindex (HPI) herangezogen. Neu im Zusammenhang mit der APMV-1 Infektion der Taube ist der Befund einer nicht-eitrigen Polyserositis, der bei 23 von 39 der APMV-1 infizierten Kontrolltauben erhoben wurde. Bei den geimpften Tauben wurde nach Belastungsinfektion, die drei, sechs und neun Monate nach der Impfung erfolgte, keine klinischen Symptomatik beobachtet. In der Gruppe D, die zwölf Monate nach der Impfung infiziert wurde, zeigte eine von 15 Tauben reduzierte Flugfähigkeit bis Flugunfähigkeit, so dass der prozentuale Anteil der kummulativ erkrankten Tauben in dieser Gruppe bei 7,7 % lag. Histologisch konnte aufgezeigt werden, dass die Impfung eine Reduktion der APMV-1 induzierten Veränderungen an den inneren Organen vermittelt. So trat zwar bei 14 von 52 APMV-1 geimpften Tieren eine nicht-eitrige Serositis auf, der HPI weist jedoch in Bezug auf Häufigkeit und Ausprägungsgrad eine statistisch signifikant geringere Ausprägung (p = 0,001) gegenüber den ungeimpften Tauben nach. Durch Betrachtung des HPI konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die geimpften gegenüber den ungeimpften Tauben vor spezifischen Veränderungen am Pankreas (Pankreasnekrosen, mononukleäre Infiltrate) sowie an der Niere geschützt waren. Durch die Impfung wurde ebenfalls eine deutliche Reduktion der Virusausscheidung erreicht.
Studien zur Spezifität und Klonalität von tumorreaktiven T-Zellen aus Triom-immunisierten Mäusen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Der Triom-Ansatz hat sich als überaus potente Möglichkeit erwiesen, um gegen das murine A20-B-Zell-Lymphom zu vakzinieren. Das Prinzip beruht auf der Redirektion von Tumorantigenen an Antigen-präsentierende Zellen des Immunsystems durch sogenannte Triom-Zellen. Diese entstehen durch die Fusion der Lymphomzellen mit Hybridomen, die Antikörper gegen internalisierende Fc-Rezeptoren auf Antigen-präsentierenden Zellen exprimieren. Der Tumorschutz wird dabei weniger über eine humorale Immunabwehr vermittelt als vielmehr über CD4- und CD8-T-Zellen. Im Rahmen dieser Arbeit sollten daher Aspekte der zellulären Immunantwort in Triom-immunisierten Mäusen untersucht werden. Es sollte geklärt werden, ob tumorspezifische T-Zellen vorhanden sind und ob diese möglicherweise gegen den Immunglobulin-Idiotyp des Tumors gerichtet sind. Dazu wurden T-Zellen aus präimmunisierten Mäusen im Vergleich zu solchen aus unbehandelten und tumortragenden Mäusen in vitro mit verschiedenen Tumorantigenen stimuliert und expandiert. Eine tumorspezifische Aktivierung erfolgte bei den Zellen aus den Triom-immunisierten Mäusen am schnellsten und effektivsten. Nach häufigeren Stimulationen stellten sich jedoch bei allen T-Zellen ähnliche Aktivierungswerte ein. In Versuchen mit Idiotyp-negativen A20-Tumorzellen stellte sich heraus, dass der Idiotyp als tumorspezifisches Antigen bei der Aktivierung der T-Zellen zwar eine gewisse Rolle spielt, aber nicht essentiell ist. Auch konnte gezeigt werden, dass alle Zellpopulationen einen CD4+-Phänotyp besaßen. Um über das tumorprotektive Verhalten dieser in vitro reaktiven CD4-T-Zellen auch in vivo einen Überblick zu bekommen, wurden die Zellen nach mehreren Stimulationsrunden zusammen mit Tumorzellen in eine unbehandelte Maus transferiert: Nur die Zellen aus der Triom-immunisierten Maus konnten einen vollkommenen Langzeit-Tumorschutz vermitteln. Dagegen konnten die Zellen aus der tumortragenden Maus das Tumorwachstum nur verlangsamen, und die Zellen aus der unbehandelten Maus zeigten keinerlei Schutzwirkung. Um zu prüfen, ob die unterschiedlichen In-vitro- und In-vivo-Daten zur Tumorspezifität auf der Benutzung von unterschiedlichen T-Zell-Rezeptoren (TZR) beruhten, wurden Studien zum TZR-Repertoire der untersuchten Zellen durchgeführt. In TZR-Vβ-spezifischen RT-PCR-Versuchen konnte gezeigt werden, dass das ursprünglich polyklonale TZR-Repertoire der Zellen erst nach vielen Stimulationsrunden starke Einschränkungen zeigt. Nach kurzer Stimulationszeit fallen hingegen im Vergleich zum Zustand ohne Stimulation keine nennenswerten Unterschiede auf. Die Befunde deuten darauf hin, dass für die Induktion tumorprotektiver T-Zellen eine In-vivo-Aktivierung ablaufen muss, die in vitro nicht simuliert werden kann. In dieser Arbeit wird zum ersten Mal gezeigt, dass eine Einschränkung des TZR-Repertoires mit einem Tumorschutz nach adotivem Transfer der T-Zellen korreliert.