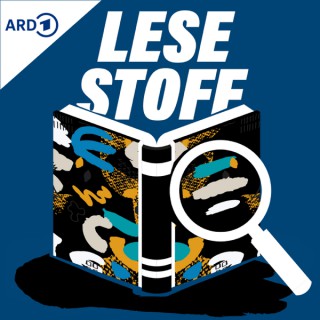Podcasts about rezensenten
- 40PODCASTS
- 69EPISODES
- 34mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 4, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about rezensenten
Latest podcast episodes about rezensenten
OverExposition: The Long Walk (Kritik & Interpretation)
Endlich mal wieder eine Stephen-King-Verfilmung, die Daniel sehr gut gefällt! Zwar hat King The Long Walk seinerzeit gar nicht unter seinem gewohnten Namen als Horrorautor veröffentlicht - dass die Story von ihm stammt, ist inzwischen aber hinlänglich bekannt und King selbst hat es eigentlich auch längst nicht verheimlicht. Warum diese Verfilmung ganz großartig ist, erzählt Daniel euch nun in unserem Podcast, samt seiner ausführlichen Interpretation des Films - aber wohlgemerkt ohne großen Vergleich zum Buch, mit dem wir nicht die große Vorgeschichte verbinden wie andere Rezensenten, die im Gegensatz zu uns wohl mit der Originalgeschichte aufgewachsen sind.
Kazuo Ishiguro: Klara und die Sonne
Kürzlich stolperte ich über diese Liste mit "Fünf Must-Read Büchern" und diesmal ging es um "Science Fiction, empfohlen von Wissenschaftlern". Nerd, der ich bin, hatte ich vier davon schon gelesen und irgendetwas bewog mich dazu, mich der Lobpreisungen der Anne Findeisen zu erinnern und, obwohl bisher enttäuscht, sagte ich mir, gehen wir also nochmal in einen Kazuo Ishiguro rein, ich meine, der Mann ist Literaturnobelpreisträger. Der Name des empfohlenen Werkes: "Klara und die Sonne".Wie es sich (für mich) gehört, ohne das Lesen von Klappentexten, Einführungen oder gar Rezensionen, wusste ich nicht im Ansatz, worum es geht, doch mit ein bisschen Detektei war bald klar, "KF"s, wie die zunächst hauptsächlich handelnden Personen genannt werden, sind keine solche - es sind Künstliche Freunde, in einem Spezialgeschäft zum Kauf angebotene Androiden, gedacht als Begleiter für die Kinder reicher, wohlangesehener, berufstätiger Menschen.Wir verstehen, das Konzept der KFs muss eingeführt werden, wir lernen zwei Exemplare kennen, die eine etwas dumm und desinteressiert, die andere, Klara die künftige Hauptheldin, hyperaufmerksam und ungewöhnlich intelligent, wir sehen die Welt durch ihre Augen, ein enger Straßenausschnitt, ein Hochhaus, eine Baumaschine; aber die vierte Beschreibung des beschränkten Ausschnittes einer Straßenszenerie aus der Sicht der künstlich freundlichen Schaufensterpuppen ist nicht interessanter als die dritte. Wann geht's nun endlich los?Schlussendlich, ein paar dutzend Seiten im Buch, wird KF Klara gekauft, von der Mutter von Josie und es kommt leicht Fahrt in die Geschichte und damit wir hier nicht ins Spoilertrauma geraten, lassen wir diese im Buch geschehen und nicht in der Rezension und kommen zur viel, viel interessanteren Frage:Ist Herr Falschgold ein Zoni aus dem literarischen Hinterland?Man muss nicht jeden Literaturnobelpreisträger kennen und schon gar nicht jedes Preisträger Biografie studieren, aber man kann schon wissen, dass nicht jeder Schriftsteller mit einem japanischen Namen aus Japan kommt, point in case, Kazuo Ishiguro. Der wuchs in England auf und schreibt schon immer auf Englisch, was die Frage des Herrn FG nach der Ursache der seltsam schlechten Übersetzung des Romans aus dem Japanischen zunächst in eine herrlich peinliche Richtung führte. Das diskutierte er gottlob mit sich selbst und seinen verschiedenen Suchmaschinen- und AI-Chatbot-Abonnements, die ihm, wie sich das für derlei Geräte in 2025, wie für die KFs im Buch, gehört, zunächst in allen seinen Meinungen und Vorurteilen bestätigten: Ja, sagte Claude, im Japanischen gibt man Kleidungsstücken gerne einmal Eigenschaften wie "hochgestellt", was ja eher den Träger charakterisiert und das ist zweifellos schwer übersetzbar, ergo, so die KI, ein "hochgestellter Anzug" sollte nicht so genannt werden! Dass es im Deutschen die durchaus gebräuchliche Bezeichnung "vornehm", zum Beispiel bei einem Kostüm gibt, kam weder der LLM noch dem Rezensenten in den Sinn, das hätte ja die Grundannahme in Frage gestellt.Was nichts an der Tatsache ändert, dass ich mit der deutschen Übersetzung, vermeintlich aus dem Japanischen, überhaupt nicht zu Rande gekommen bin. Ja, ich schob es auf die Inkompatibilität des Japanischen zu westlichen Sprachen und hatte mich aufgrund dieser Annahme bewusst entschlossen, die deutsche Übersetzung zu lesen - warum soll man ein Buch sprachlich zweimal verschieben, einmal von der Übersetzerin und ein zweites Mal im Kopf? Aber so unlesbar war das Werk, dass ich denn doch mal die englische Version holte, um zu schauen, ob dort besser gearbeitet wurde und stoße dann auf die offensichtliche Information, dass "Barbara Schaden[..] den Roman "Klara und die Sonne" von Kazuo Ishiguro aus der englischen Sprache ins Deutsche übersetzt…" hat.Ok, da wird vieles klarer, denn das starre Subjekt-Prädikat-Objekt des Englischen und die generelle Abneigung dem Schachtelsatz gegenüber machen das vermeintlich japaneske Stakkato der Sätze erklärbarer und wenn man die dann genauso fantasielos und ohne Rücksicht auf Wortwiederholungen ins Deutsche prügelt, kommt das raus, was der Leser der deutschen Übersetzung von "Klara und die Sonne" durchleiden muss: Starre, unnatürliche Formulierungen, die grammatikalisch sicher richtig sind, aber so im Deutschen nicht gesprochen werden. Denn Kazuo Ishiguro schreibt ein seltsames Englisch. Zumindest in "Klara und die Sonne". Er scheut die Wiederholung nicht, er schreibt der Sonne ein Geschlecht zu, was im Englischen möglich, aber höchst ungewöhnlich ist (und für deutsche Ohren umso mehr, als dass diese im Englischen männlich beartikelt wird). Es werden angesprochene Personen im Satz in die dritte Person gesetzt, es werden ausgedachte Eigennamen eingeführt und bleiben unerklärt.Nachdem es mir ein paar Tage auf der Zunge lag und im Hinterkopf hin- und herschepperte, kam ich dann drauf, an welches Buch mich das Ganze erinnert: An das letztens hier besprochene "Narrenschiff" von Christoph Hein. Ok, "recency bias" heißt das in der Fachsprache, es gibt sicher bessere Beispiele, aber die Beschreibungen der Welt von Klara und ihrer Sonne sind für mich als, vielleicht hinterwäldlerischen Zoni, so steif und formalistisch, so unverständlich wie für einen Wessi die Nomenklatura, die Begriffe, die Namen in der DDR. Und während ich bei Christoph Hein die "Kunstsprache" SED-Deutsch verteidigt habe, oder wenigstens zu "Kunst" erklärt, tu ich mich hier schwer. Ja, Kazuo Ishiguro will uns eine Welt nahebringen, in der künstliche Helfer genetisch verbesserte Kinder in einer streng hierarchischen Gesellschaft betreuen und dass diese künstlichen Helfer nicht den größten intellektuellen Spielraum und -willen haben, will vermittelt sein. Es ist ein wenig wie die Erzählung einer Welt aus der Sicht und mit der Sprache eines Kindes. Kann man machen, aber mir verdirbt das den Lesegenuss.Wie angedeutet, besonders unverständlich im zweifachen Sinne sind die Eigennamen. Da gibt es Bürogebäude, Baumaschinen, Universitäten, die ausgedacht sind, aber real sein könnten, so real, dass man sie kurz googelt und merkt, dass Ishiguro das auch getan und englisch klingende Namen solange variiert hat, bis er keine Ergebnisse mehr gefunden hat. Ok, kann man machen. Aber dann sollte man doch irgendeinen Hinweis hinterlassen, was diese "Atlas Brookings” Uni darstellen soll, in die ein Nebenheld aufgenommen werden möchte: ist es eher Oxford oder Berkeley, Yale oder Stanford. Genau die gleiche Frage stellt sich, wenn ein Gebäude zehnmal im Buch erwähnt wird, sodass man als Leser denken muss, dass das irgendwie wichtig wäre. Aber nichts wird erklärt, kein Kontext nirgendwo.Ich habe am Ende sogar gecheckt, ob "Klara und die Sonne" vielleicht Teil einer Buchreihe ist, wo man voraussetzen kann, dass die Leserin weiß, was die Eigennamen bedeuten. Nein, ist es nicht, es wird einfach nicht erklärt und man liest als Leser immer ahnungsloser durch einen Roman, der keinen Sinn ergibt. Das betrifft nicht nur Eigennamen. Auch die Verben "gehoben" und "ungehoben" ("lifted/unlifted" im Englischen) als Adjektiv für Kinder, bleiben bis weit nach der Hälfte des Romans unerklärt, was eine künstlerische Entscheidung ist, nur halt keine gute - speziell, wenn man das dann in einer Übersetzung liest und davon ausgehen muss, dass hier Sinn verloren gegangen ist.Dazu kommen fragwürdige Entscheidungen im Setting: Jede Fiktion braucht ein klein wenig Übersehen von Lücken in Konzeption oder Handlung, aber ein KI-gesteuerter Android in der Zukunft, der ein Telefon als solches nicht erkennt und es Rechteck nennt, ist ein bisschen viel verlangt. Mütter, Kinder, Väter schauen in ihre Rechtecke, Gartentore sind Bilderrahmen, harmlose Baumaschinen die Ursache globaler Umweltverschmutzung und so wird dann der Weg bereitet, dass der solarbetriebene Android die Sonne für einen Gott hält, dem es, wenn man ihm nur genug Opfer bringt, ein Leichtes ist, ein todsterbenskrankes Kind zu retten (sorry für den Spoiler). Klingt als Elevatorpitch irgendwie stimmig, nach 350 Seiten weiß man dann - leider nur als dieser.Dabei wäre das Ganze zu retten gewesen, die Story ist eine hervorragende Basis für philosophische Betrachtungen. Nicht nur über Künstliche Intelligenz und deren Servilität und dem Nach-dem-Mund-reden. Wie wir (viel zu spät) lernen, sind alle "gehobenen" Kinder genetisch verbessert, warum nimmt der Autor diesen Handlungsstrang nicht auf? Und es dienen in der Buchwelt Androiden nicht nur der Kinderbetreuung, sondern haben auch viele Menschen arbeitslos gemacht (wir lernen das buchstäblich in einem Nebensatz und hören nie wieder davon). Und man kann und muss über die Normalisierung unser aller Interaktionen mit künstlichen Intelligenzen sprechen, siehe oben, was, zugegeben, im Jahr 2020 noch kein etabliertes Phänomen war, aber, Kazuo Ishiguro schreibt hier Science Fiction, wie toll wäre es gewesen, wäre er darauf gekommen!All das passiert nicht, die Sprache ist anstrengend, die Story nicht inspiriert, der Tiefgang, er fehlt. Was uns leider zu einem harten Urteil führt: Man muss "Klara und die Sonne" weder wegen der Story noch der Sprache lesen und auch die philosophischen Ideen muss die Leserin leider in sich selbst finden und das geht einfacher draußen, unter der realen Sonne, solange sie noch scheint, als in ein Buch versunken, welches keine dieser Ideen aufnimmt.Sehr schade. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Burns kleines GeBlauder 37…Neubi packt mal wieder aus.
Folge Nummer 37 von Burns kleinem GeBlauder. Heute wieder einmal Neubi. Sozusagen als Antwort auf die Antwort. Neubi - Simon-Philipp - Neubi. Ihr dürft gespannt sein, was dem findigen Rezensenten mit dem exotischen Geschmack heute wieder alles einfällt... Und hier die passenden Titel, beziehungsweise Reihen oder Autoren: Comics & Graphic Novels: Bastien Vivès: In meinen Augen Reprodukt 18,- Euro Gipi: MSGL - Mein schlecht gezeichnetes Leben Reprodukt 20,- Euro Martin Panchaud: Die Farbe der Dinge Edition Moderne 35,- Euro Chris Ware: Building Stories Random House LLC US ca 100,- Euro Chris Ware: Jimmy Corrigan - Der klügste Junge der Welt Reprodukt 39,- Euro Thomas Ott: The Number 73304-23-4153-6-96-8 Edition Moderne 29,- Euro
Was stört es Igor Strawinsky, wenn sich die deutsche Kritik …
Zwei kurze Opern und in der Mitte ein kleines Ballett – Igor Strawinsky durfte sich im Frühsommer 1925 gleich mit einem Triptychon eigener Werke an der Berliner Staatsoper vorstellen. Seine Geschichte vom Soldaten aus dem Jahr 1918 hatte bereits eine gewisse Aufführungsgeschichte in Deutschland (und mit schon zwei vertonten Rezensionen auch in diesem Podcast). Beim Tanzstück Pulcinella und der Reineke-Fuchs-Adaption Le Renard hingegen, erfahren wir im Hamburgischen Correspondenten vom 12. Juni, handelte es sich um deutsche Erstaufführungen – die den Rezensenten wenig überzeugten. Auch wenn eine gewisse hanseatische Differenziertheit im Urteil gewahrt bleibt, weht durch die Kritik doch ein Hauch des Kulturkampfes, den die musikalische Moderne seinerzeit fast überall umgab. Neben benennbaren künstlerischen Vorbehalten stößt sich der Text dabei ausdrücklich auch an der russischen Herkunft des Komponisten und erklärt die ‘heil'ge deutsche Kunst‘ darob für bedroht. Es liest Frank Riede.
Sonys neue Premium-Kopfhörer: Das sagen Experten zum WH-1000XM6
Sony bringt mit dem WH-1000XM6 ein neues Modell seiner beliebten Noise-Cancelling-Kopfhörer auf den Markt. Die ersten Rezensenten sind sich weitgehend einig: Es handelt sich um eines der besten Over-Ear-Modelle überhaupt – doch perfekt ist es nicht.
Tele-Hørst 89: Cringe Party – Filme, die uns fremdschämen lassen
Fremdscham ist keine Schande! Ebenso wenig, wenn zwei Filme hintereinander denselben Titel tragen – passiert den Besten. Richtig unangenehm wird's allerdings erst, wenn keiner von beiden das liefert, was der Podcast-Titel verspricht: echtes Fremdschämpotenzial. Zum Glück gibt es da ja noch Film Nummer 3, der so übel war, dass einer der Rezensenten ihn gar nicht erst zu Ende geschaut hat (*hust* Andi *hust*). Aus gutem Grund?
Wer erinnert sich noch an den 7. Sinn? Die Fernsehsendung des Westdeutschen Rundfunk, die zwischen 1966 bis 2005 ausgestrahlt wurde. Sie klärte alle Beteiligten am motorisierten Verkehr über Gefahren und korrekte Verhaltensweisen auf und wird als Mutter aller Verkehrserziehungssendungen bezeichnet. Vielleicht wurde dieser Titel aber voreilig vergeben. Im Hamburger Echo vom 25. Januar 1925 erfahren wir von einem Lehrfilm der Bayerischen Filmgesellschaft, der das richtige Navigieren durch den städtischen Verkehr veranschaulichte. Interessant ist daran, dass er, zumindest aus der Sicht des Rezensenten, auch wertvolle Impulse für die Hamburger Polizei beinhaltete. Rosa Leu weiß welche.
Barbara Kingsolver: Demon Copperhead
Liebe Leserinnen und Leser,Pulitzerpreisgekrönte Werke zu rezensieren ist heutzutage eine dankbare Aufgabe: da haben schon die Fachleute draufgeschaut, die beruflichen Rezensenten gewerkelt und eingeschätzt, die Marketingmaschine der weltweit beteiligten Verlage läuft auf Hochtouren - zumindest für eine gewisse Zeit vor und nach der Preisverleihung - , und auch die lokalen Buchhandlungen schmücken ihre Fensterauslagen und Buchtische.Im letzten Jahr gewann diesen Preis im Bereich der Belletristik - denn die Pulitzerpreise gibt es auch für Sachbücher, zuallererst aber für herausragende journalistische Arbeiten - Barbara Kingsolver mit dem heute hier vorgestellten "Demon Copperhead", im Deutschen ebenfalls: "Demon Copperhead".Warum dieses Werk seinen englischen Titel behalten durfte, ist sicherlich zum einen der Fakt, dass es sich um den Rufnamen des Protagonisten - mit bürgerlichem Namen Damon Fields - handelt, zum anderen, dass sich Demon Copperhead die Inspiration des Werkes, die Initialen und einen Teil des Nachnamens, nämlich mit Charles Dickens "David Copperfield" teilt.Worum geht es: Damons Vater stirbt, bevor er auf die Welt kommt. Seine Mutter, noch minderjährig, kämpft mit Drogenabhängigkeit. Seine Verhältnisse sind ärmlich, und der Plot entfaltet sich in den abgeschiedenen Bergen der Appalachen, einem Gebirgszug an der Ostküste der USA.Man muss kein Anhänger von Karl Marx sein, um die These "Das Sein bestimmt das Bewusstsein." oder einfacher "die materielle Grundlage prägt das gesellschaftliche Leben" nachvollziehen zu können. Zunächst wird Demon von seiner Mutter und den älteren Nachbarn, den Peggots, großgezogen. Währenddessen ist deren Enkel Matt, der bei ihnen aufwächst, weil seine Mutter im Knast ist, sein bester Freund. Bis hierher ist alles dufte soweit. Dann lernt Damons Mutter einen neuen Typen kennen, der sie zurück zu den Drogen bringt und auch nicht an ihrem "Anhang" interessiert ist. Die Oxycontin-Krise ist groß und spielt im Buch als gesellschaftliche Problematik eine große Rolle. Für Damon ist es eine sehr persönliche Problematik, denn seine Mutter stirbt, und er beginnt eine Odyssee durch verschiedene Pflegeeinrichtungen. In einem Werk zeigte sich die Autorin besonders erschüttert darüber, dass die Aufnahme und Pflege von Waisen oder elternlosen Kindern in den USA ein Geschäft ist, bei dem Mindeststandards zuverlässig verletzt werden und diejenigen, die mit ihrer Einhaltung beschäftigt sind, so schlecht bezahlt werden, dass sie diesen Job verlassen, wenn nur irgendwie möglich. Körperlicher und seelischer Missbrauch, Zwangsarbeit und Ausbeutung sind einige der Folgen.In "Demon Copperhead" lässt Barbara Kingsolver den Protagonisten von Anfang an zu Wort kommen. Dies zeigt zum einen, wie klein und von wenigen Faktoren abhängig Kinder auf ihren Weg geschickt und geprägt werden, zum anderen erkennen wir Zusammenhänge, weil sie uns durch kindliche Augen geschildert werden, und die wir über den Zynismus der Zustände längst verdrängt hatten.Es ist eine harte Geschichte. Und während sich Charles Dickens in "David Copperfied" ebenfalls mit heftigen Widrig- und Gefährlichkeiten auseinandersetzt, ist Barbara Kingsolvers Werk brutaler und direkter, weil es beschissene Verhältnisse sind, die JETZT, gerade eben so stattfinden oder stattfinden können.Das pralle Buch versammelt eine wachsende Zahl - ganz wie Kinder ihren Kreis beständig erweitern - von Menschen, die Demon feindlich gegenüberstehen, oft im besten Fall noch indifferent, aber bis auf wenige Ausnahmen eben nicht voller Liebe und Güte, wie es ein Kind braucht. Dabei sind die Ausnahmen rar, und umso wichtiger. Das sind Damons Freunde und Bekanntschaften, die aber ihrerseits mit Drogen und Armut zu kämpfen haben, aber es gibt auch Lehrer, die Damon ermutigen, seine Talente zu pflegen und ihm Achtung und Respekt entgegenbringen.Er findet die Liebe und verliert sie wieder. Er flieht, um seine Großmutter - die Mutter seines Vaters, den er nie kannte - zu suchen, und die Geschichte dieser Flucht ist das Herzzerreißendste, was ich seit langem gelesen habe.Barbara Kingsolver hat nach Selbstauskunft mit der Grundlage von Charles Dickens "David Copperfield" einen Weg gefunden, wie sie über die verlorenen Kinder der Appalachen schreiben, und dabei ein positives Ende, mit Fantasie und der Magie der Vorstellung erzählen kann.Ein Seitenstrang der Geschichte ist die Frage, warum die Einwohner der Appalachen so oft verhöhnt und als Rednecks und Hillbillies das kürzere Ende von Witzen sind. Es findet sich eine sehr überraschende Erklärung, die hier nicht verraten wird. Sie lässt allerdings noch einmal die Ostfriesenwitze, die Anfang der 1990er Jahre allgegenwärtig waren, in einem anderen Licht erscheinen.Das waren jetzt viele Punkte zum Hintergrund, aber worum es ja geht, sind Lobpreisung oder Verriss. Während in dieser Rezension die übergroßen Widrigkeiten im Vordergrund standen: das Erlebnis der Lektüre ist ein anderes als vielleicht vermutet. Voller Güte, Leidenschaft, Tempo, Fantasie und einem Augenmerk auf aufregenden und überraschenden Wendungen, ist es ein fantastischer Roman, Lobpreisung galore!Die diesjährige Gewinnerin des Pulitzerpreises für Belletristik ist Jayne Anne Phillips mit ihrem Roman "Night Watch", wir sind gespannt. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Die Hamburger Erstaufführung von Richard Strauss' ‘Intermezzo'
Dass Richard Strauss in den Jahren der Weimarer Republik der in Deutschland meistgespielte zeitgenössische Opernkomponist war, bedeutete nicht, dass alle seine Uraufführungen große Erfolge wurden. Seiner „bürgerlichen Komödie“ Intermezzo beispielsweise, mit der sich der Komponist selbst zum 60. Geburtstag beschenkte, war kein durchschlagender Erfolg beschieden. Zu den Kritikern dieses Werkes zählte nicht nur Strauss‘ etatmäßiger Librettist Hugo von Hofmannsthal, der des Komponisten Versuch, diesmal selbst den Text zu seiner Oper zu verfassen, für wenig gelungen hielt. Auch der Kritiker Rudolf Philipp, der am 13. November 1924 im Hamburger Anzeiger die hanseatische Erstaufführung des wenige Tage zuvor in Dresden welturaufgeführten Opus besprach, empfand Intermezzo eher als Peinlichkeit. Wie Strauss hier seine eigene Ehe auf die Bühne brachte und warum das dem Rezensenten viel zu privat war, erläutert uns Frank Riede.
[Podcast] Kultur, Kulinarik und Krimi: Natasha Korsakovas Tödliche Sonate verzaubert
In dieser Episode widmen wir uns der Rezension des fesselnden Krimis "Tödliche Sonate" von Natasha Korsakova. Der Klappentext eröffnet einen spannenden Fall in der Welt der klassischen Musik, in dem die gefürchtete Musikagentin Cornelia Giordano brutal ermordet wurde. Commissario di Bernado, frisch von Kalabrien nach Rom versetzt, taucht in die intrigante Welt der Musikagenten, Opernhäuser und aufstrebenden musikalischen Talente ein. Die Frage nach dem Mörder wird mit jedem Kapitel brisanter, während di Bernado die unliebsame Vergangenheit der Giordano beleuchtet. Die persönliche Rezension beginnt mit der Reflexion über das Verlangen, ein Buch voller Begeisterung zu lesen, und dem ständigen Kampf gegen äußere Ablenkungen. Es wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Geigenbau und klassischer Musik für den Rezensenten von großer Bedeutung ist, wobei die Handlung des Buches in den Hintergrund gedrängt wird durch die Hektik des Alltags. Der Rezensent teilt die Herausforderungen beim Lesen angesichts der zahlreichen italienischen Namen, ähnlich seiner Erfahrungen mit der Autorin Donna Leon, doch schnell wird die Faszination für die Thematik erweckt. Besonders faszinierend sind die historischen Einblicke in die Welt von Antonio Stradivari und die Handwerkskunst der Geigenbauer. Die Kreation der "Messias"-Violine und die Art, wie Korsakova die Violine in die Handlung integriert, wird als erfrischend und einzigartig hervorgehoben. Die Charaktere, insbesondere di Bernado und sein Team, werden als vielschichtig und ansprechend beschrieben, mit persönlichen Konflikten und einem besonderen Charme, der sie lebendig macht. Eine charmante Kulisse wird durch die Erwähnung von Roms Schönheit geschaffen, während die kulinarischen Elemente des Buches dem Rezensenten das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Die schmackhaften Gerichte schaffen eine Atmosphäre der Vertrautheit und ziehen den Rezensenten tiefer in die Welt des Kommissars. Diese Verbindung zur Stadt Rom und ihre kulturellen Schätze verleiht der Rezension eine zusätzliche Dimension. Das Buch zeichnet sich durch seine spannenden Wendungen und die Fähigkeit aus, den Leser bis zur letzten Seite im Unklaren über die Identität des Mörders zu lassen. Trotz des Krimi-Genres wird die Geschichte nicht als blutrünstig oder überwältigend empfunden; vielmehr erinnert sie an die Komplexität und Schönheit klassischer Musik. Es entsteht eine Sehnsucht nach mehr, sowohl nach den Abenteuern von Commissario di Bernado als auch nach der herzlichen und musikalischen Erzählweise der Autorin. Die Schlussfolgerungen der Episode regt zum Nachdenken an über die zukünftigen Werke der Autorin und die Möglichkeiten, die über die Grenzen der Musik hinausgehen. Der blendende Stil und das Talent von Natascha Korsakova lassen darauf hoffen, dass sie ihr Können nicht nur innerhalb der Musikszene, sondern auch in anderen Genres beweisen kann. Der Rezensent ist überzeugt davon, dass Korsakova mit ihrem feinen Gespür für Sprache und Charaktere auch in anderen Bereichen spannendere Geschichten erzählen könnte. "Tödliche Sonate", erschienen 2018 im Heyne Verlag und nun als E-Book im Penguin Verlag erhältlich, lädt zu einer aufregenden Lesereise ein, die sowohl Musikliebhaber als auch Krimifans begeistert.
Radiolegende - Friedrich Luft kultivierte "Gleiche Welle, gleiche Stelle"
Die "Stimme der Kritik" des Friedrich Luft ist bis heute eine Legende. In seinem Heimatsender, dem RIAS Berlin, feierte man 1961 den 50. Geburtstag des Rezensenten mit einer Sondersendung - eine besondere Wertschätzung. Von Isabella Kolar www.deutschlandfunkkultur.de, Aus den Archiven
040 - Die Medienpartnerschaft mit dem Rheinwerk Verlag
nerdcafe. Der Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web.
Willkommen im nerdcafe. In dieser Episode möchte ich dir etwas ausführlicher von der Medienpartnerschaft vom nerdcafe mit dem Rheinwerk-Verlag erzählen. Ich erzähle, wie ich den Verlag kennen gelernt habe und vom Kunden zum Rezensenten und schliesslich zum Medienpartner wurde. Im weiteren Verlauf der Episode geht's dann um die Projekte die wir umgesetzt haben und Dinge, die wir noch planen. Außerdem erzähle ich, warum das alles noch in einer Test-Phase ist und bin gerade deswegen mega gespannt auf dein Feedback, deine Wünsche und deine Ideen. Sowohl zu der Partnerschaft, aber auch ganz generell zum nerdcafe. besprochene Bücher im Rheinwerk-Verlag https://www.rheinwerk-verlag.de/branding-mit-linkedin/ https://www.rheinwerk-verlag.de/einstieg-in-wordpress/ https://www.rheinwerk-verlag.de/growth-hacking-mehr-wachstum-mehr-kunden-mehr-erfolg/ Was du von der Kooperation hast: 10% Rabatt auf Spotlight-Konferenz Ticket mit dem Code "NERDCAFE" 10% Rabatt auf das Rheinwerk 365-Jahres Abo mit dem Code "NERDCAFE" via Mail an service@rheinwerk-verlag.de Was ist das 365-Abo: https://www.rheinwerk-verlag.de/rheinwerk-365/abo/ Was ist das nerdcafe? Hier geht es um WordPress, Hosting, Content Management Systeme und Web-Themen. Aber natürlich auch um Sicherheit, Backup und Social Media. Kurz gesagt: Um alles, was dich interessiert, wenn du mit deinem eigenen Webseite Projekt starten möchtest. ⏰ Neue reguläre Episoden erscheinen jeden Dienstag um 7:00 Uhr Die nerdcafe to go Variante erscheint unregelmäßig, spontan und meist von unterwegs. Das nerdcafe live findet Donnerstags bei LinkedIn live statt - alle Themen und Termine auf meinem Profil ☕ Machs dir gemütlich und komm gern dazu. Viel Spaß im nerdcafe.
Im zweiten Teil des STONE PROG Podcasts zum Thema „Zukunft des deutschen Progrocks“ begrüßt Marek Arnold den Rezensenten und Szenekenner Nik Brückner sowie, zum Thema „AI Music“, den IT-Experten Konrad Inndorf zum spannenden Gespräch. stoneprog.de bside-music.de #stoneprog #marekarnold #podcast #prog #progrock #artrock
Verrückt nach Werther: Ein Weltbestseller entsteht
Die (deutschsprachige) Welt steht Kopf seit dem Herbst 1774: junge Männer kleiden sich wie Werther an seinem letzten Tag, Frauen wollen nicht mehr mit Lotte angesprochen werden, Rezensenten schimpfen und Werther-Bilder überall, selbst auf Tassen. Und Goethe gesteht noch rund 50 Jahre danach seinem Vertrauten Eckermann: "Es sind lauter Brandraketen! Es wird mir unheimlich dabei ...". Die Rede ist von seinem Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers", der seinen Weltruhm begründete. Wie es dazu kam, ob "Lotte" Buff wirklich die Ursache war und welche zusätzlichen Einflüsse der junge Goethe im kreativen Schaffensprozess verarbeitete, darüber sprechen wir in dieser Episode. Besuche die Lesedusche, um die von uns ausgewählten Passagen aus "Dichtung und Wahrheit" rund um die Entstehung des "Werther" anhören zu können: https://lesedusche.de/figuren/werther.html?utm_source=FEE&utm_medium=LIN-POD&utm_campaign=IRM-POD-LD ▶ ACHTUNG: Registriere dich jetzt KOSTENLOS auf https://lesedusche.de/fe/registrieren und erhalte exklusive BUCHTIPPS
Guess who's back? Richtig! Eure Laberer vom Dienst. Nach der kurzen einmonatigen Sommerpause, die sich aber nach Jahren anfühlt, gibt es so viel aufzuholen... *Eine kleine Triggerwarnung vorweg: Diese Episode ist rasant und toxisch! Es gab einfach mal so viel Stoff, dass "Schloss Einstein" dieses Mal nur eine untergeordnete Rolle spielt und das "Setgeflüster" gänzlich weichen musste. Wir tauschten in dem Sinne in dieser Folge das Internat Schloss Einstein in Seelitz gegen die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Aber der Reihe nach... Philipp betrieb im Juli aktive Erholung in der radikalsten Art und Weise. Sein Tag hat augenscheinlich mehr als 24 Stunden. So berichtet er von einem intensiven Amsterdam-Trip, der irgendwie auch mit Taylor Swift zu tun hatte. Außerdem fungierte er als "Burgherr" und zeigte einem amerikanischen Freund scheinbar alle deutsche Burgen, um ein wahres "Game of Thrones"-Gefühl aufkommen zu lassen. Nebenbei zelebrierte und organisierte er noch den Geburtstag seines Freundes (respektive seinen eigenen), machte den CSD unsicher, drehte verschiedene Projekte (und wahrscheinlich auch ein bisschen durch) und tanzte hier und da auf anderen Partys. Der Juli im Vollrausch gewissermaßen. Da kann Daniel hingegen mit einem Kurzurlaub an der Ostsee wahrlich nicht mithalten. Dafür gibt er Philipp noch diverse Sport-Updates und Gossip. So wird die EM noch einmal kurz rekapituliert, die Eröffnungsfeier von Olympia wird besprochen - dabei gab es einen Moment, der Daniel zu Tränen rührte - und er schlaut Philipp auf, mit wem Bill von Tokio Hotel wohl laut den neuesten Promi-News zusammen sein soll. Diese Info haut Philipp regelrecht aus den Latschen... Dabei ist Philipp doch der eigentliche Kaulitz-Experte! In unserer TV- und Serienrubrik nehmen die beiden Rezensenten unter anderem "Kaulitz und Kaulitz" auf Netflix auseinander und besprechen "Those About to Die" auf Amazon. Ist die Prestige-Antik-Serie echt so mies, wie die Kritiken es kundtun?! Ihr erfahrt es hier. Im "Cruel Summer" wird natürlich auch das Phänomen Taylor Swift von Philipp und Daniel erörtert. Wer von beiden ist nun der wahre Swiftie? Achja. Unser Lieblingszauberer "Harry Potter" hatte am 31.7. Geburtstag. Stolze 44 Jahre ist der Junge, der überlebte, nun alt. "Die Kids von heute" feierten einfach mit und machten gleich einmal einen HP-Häusertest. Ist Daniel etwa ein Slytherin? Philipp ein echter Griffindor? Hier gibt's die Antwort! Warum Daniel und Philipp nun auch noch in die Rollen von Harry und Ron schlüpften, erzählen sie außerdem hier. Freut euch auf eine Überraschung. Es wird magisch!
[Podcast] Rezension: Karl Marx beim Barbier - Uwe Wittstock
Das Buch "Karl Marx beim Barbier" von Uwe Wittstock erzählt von Karl Marx' Leben und seiner letzten Reise als deutscher Revolutionär. Im Jahr 1882 verlässt Marx zum ersten Mal Europa und begibt sich nach Algerien, wo er von Albert Fermé empfangen wird. Gezeichnet von persönlichem Verlust und gesundheitlichen Problemen, reflektiert Marx sein Leben und Wirken, von seinen jüdischen Wurzeln über seine politischen Ambitionen bis hin zu seinem ewigen Exil und der Armut, die er ertragen musste. Uwe Wittstock gelingt es, in seinem Buch elegant zwischen Biografie und Erzählung zu wechseln und die philosophischen Ideen dieser Zeit verständlich zu vermitteln. Der Autor beleuchtet eine zumeist übersehene Phase von Karl Marx' Leben und zeigt dabei dessen Widersprüchlichkeiten auf. Die Beschreibung von Marxs Aufenthalt in Algier sowie Einblicke in sein familiäres Umfeld und seine Freundschaft zu Engels geben dem Leser ein tiefgründiges Verständnis für die Person Marx. Für den Rezensenten war das Buch von Wittstock alles andere als leichte Lektüre, sondern regte zum Nachdenken über historische Zusammenhänge, politische Entwicklungen und persönliche Beziehungen an. Die Darstellung von Marxs Kampf um das Überleben seiner Familie und sein Ringen um politischen Einfluss bieten einen faszinierenden Einblick in sein komplexes Leben. Wittstocks Werk führt die Leser auf eine Reise in die Vergangenheit, um einen der bedeutendsten deutschen Denker näher kennenzulernen und seine Rolle in der Gesellschaft kritisch zu hinterfragen.
MonkeyTalk Podcast Episode #4.11 - BoardgameMonkey-Entwicklung. Mit Andreas und Marcus
Guuuuude und Servus,herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MonkeyTalk, dem Brettspiel-Podcast der BoardgameMonkeys und genau die stehen auch im Fokus in unserer heutigen Ausgabe. Marcus und Andreas beleuchten heute ein wenig den Werdegang eines Rezensenten bei den BoardgameMonkeys. Wir kritisch wird man im Laufe der Zeit? Spielt man anders? Solche Fragen werden geklärt. Dazu kommt, wie gehabt, unsere Affenspielplatz mit Next Station London und Die Weiße Burg. Und wenn Andreas und Marcus zusammen kommen darf es natürlich nicht fehlen: Anno 1800... LGeuer Monkey-Talk-TeamIhr könnt gar nicht genug von uns bekommen? Exklusive Podcastfolgen und viel mehr https://www.patreon.com/BoardgameMonkeys?fan_landing=true Lest ausführliche Rezensionen auf unserer Homepage https://www.boardgamemonkeys.com/ Diskutiert mit uns über die aktuelle Folge auf unserem Discord https://discord.gg/dFdWtSR3YJ Supportet uns über den Kauf von Brettspielen über unsere Affiliatelinks https://www.meeplebox.de/?affiliate=bgm https://www.fantasywelt.de/?bgm=g4GLChMaambJstx7Wdrt Oder checkt mal unseren Merch-Store ab https://boardgamemonkeys.myspreadshop.de/Support the showSupport the Show.
In dieser Episode tauchen wir ein in die Rezension des Krimis "Totenweg" von Romy Fölck. Die Geschichte handelt von einer jungen Polizistin und einem kurz vor der Pensionierung stehenden Kriminalkommissar, deren einzige Verbindung ein nie aufgeklärter Mord an einem Mädchen ist. Während es für den Kommissar ein ungelöster Cold Case ist, der ihn seit Jahren beschäftigt, ist es für die Polizistin ein Alptraum aus ihrer Vergangenheit, da sie die Leiche des Mädchens damals fand und ein Geheimnis damit verbunden ist. Die persönliche Rezension des Buches wird gegeben, wobei betont wird, dass der Zeitpunkt der Rezension inmitten einer Leseflaute lag. Dennoch wurde die Sperrfrist zu rezensieren nicht ignoriert, und so taucht der Rezensent in die Geschichte ein. Die Figuren des Kriminalkommissars Haverkorn und der Polizistin Frida Paulsen werden vorgestellt, deren Verbindung zum alten Fall und zueinander im Fokus steht. Mit vielen Geheimnissen, Konflikten und den Verflechtungen alter und neuer Ereignisse zieht die Handlung den Rezensenten immer tiefer in die Geschichte. Während die Spannung steigt und die Dynamik zwischen den Charakteren wächst, wird die Faszination für die Handlung und das Miträtseln, wer hinter den Ereignissen steckt, beschrieben. Die Autoren schaffen es, die Leselust des Rezensenten wiederzubeleben und ihn in die Welt von Frida und Haverkorn zu ziehen. Die Hoffnung auf eine starke Ermittlerpartnerschaft zwischen den unkonventionellen Protagonisten wird geweckt, während die Geschichte mit überraschenden Wendungen und falschen Fährten den Leser in Atem hält. Abschließend wird betont, dass "Totenweg" von Romy Fölck im Jahr 2018 veröffentlicht wurde und für 13 Euro erhältlich ist. Der Rezensent empfiehlt das Buch als eine Geschichte, die die Leser mitreißen und die Charaktere ins Herz schließen lässt. Mit ansprechenden Charakteren, einer fesselnden Story und einer gut gestalteten Umgebung wird das Buch als eine Bereicherung für alle Leseratten präsentiert.
Die Rezension zu "Die Kraft des Bösen", verfasst von Fabio Paretta, beschreibt die Handlung des Buches und die persönliche Erfahrung des Rezensenten damit. Der Roman handelt von Franco De Santis, einem Polizisten aus Neapel, der in die Ermittlungen um den vermeintlichen Selbstmord eines Gemeindepfarrers verwickelt wird. Obwohl alle den Vorfall als Selbstmord betrachten, glaubt Franco nicht daran und beginnt eigene Nachforschungen anzustellen. Die Handlung des Buches ist komplex, da Franco mit vielen Hindernissen konfrontiert wird, sei es von seinem Vorgesetzten, seiner Familie oder der kriminellen Camorra. Der Rezensent gibt an, dass er normalerweise Thriller bevorzugt, jedoch von "Die Kraft des Bösen" schnell gefesselt wurde. Die Charaktere werden lebendig dargestellt, insbesondere Franco De Santis mit seinen persönlichen Konflikten und dem starken Glauben an die Wahrheit. Die Ermittlungen führen den Leser durch das pulsierende Neapel, in dem die dunklen Machenschaften der Kirche und der Camorra aufgedeckt werden. Der Autor, Fabio Paretta, schafft es, die Atmosphäre der Stadt einzufangen und gleichzeitig einen intelligente und spannende Kriminalfall zu präsentieren. Der Rezensent lobt die Konstruktion des Falls und die Enthüllung am Ende des Buches, die gut durchdacht und überraschend ist. Zudem schafft es Pareta, durch seinen Roman Einblicke in die sozialen und politischen Probleme Italiens zu geben, insbesondere im südlichen Teil des Landes. Trotz der Tatsache, dass der Autor deutscher Herkunft ist, gelingt es ihm, die Lebensweise und Kultur Neapels authentisch darzustellen. Insgesamt wird "Die Kraft des Bösen" als intelligenter Krimi gelobt, der sowohl fesselnd ist als auch eine gewisse Tiefe in der Charakterentwicklung und der Handlung bietet. Der Rezensent freut sich bereits auf weitere Werke von Fabio Paretta und empfiehlt das Buch für Leser, die an gut durchdachten Kriminalromanen interessiert sind. Das Buch ist seit 2016 erhältlich und kann für 10 Euro erworben werden. Es wurde vom Penguin Verlag veröffentlicht.
Auf den ersten Blick scheint es hier keine besondere Neuheit zu geben. Die Fragen sind: Was wäre, wenn es Magie wirklich gäbe, wenn sie von einem geheimen Club kontrolliert und dazu benutzt würde, die Öffentlichkeit vor bösartigen Geistern und übersinnlichen Feinden zu schützen? Aber Ben Aaronovitch bietet etwas Neues, indem er die Metropolitan Police in den Mittelpunkt seiner magischen Welt stellt, und schon haben wir das Beste aus zwei Welten der Urban Fantasy, so nahe liegend, dass man glauben könnte, diese Art der Literatur gab es schon immer. Da mag man vor allem an die berühmten okkulten Detektive wie Hodgsons Carnacki, Blackwoods John Silence oder an LeFanus Dr. Hesselius denken, aber damit hat Peter Grant, der Held der Reihe, gar nichts zu tun (übrigens auch nicht mit Harry Potter, wie oberflächliche Rezensenten behaupten). Am ehesten ist noch die Thursday-Next-Reihe von Jasper Fforde mit Peter Grant verwandt, aber auch die verfolgt einen gänzlich anderen Ansatz. Wäre noch Harry Dresden, die Königsreihe der Urban Fantasy; das gilt aber nur, wenn man Kategorien unbedingt braucht. Und Scott Mebus mit seinen Gods of Manhattan. Folge direkt herunterladen
Moderatorin Anna Kalinowsky, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Abgepinnt: Ist der AI Pin mehr Schein als Sein? Das Start-up Humane trat mit dem Anspruch an, das Smartphone abzulösen. Doch der AI Pin fällt in ersten Tests durch. Sind die Rezensenten zu streng oder sieht die Zukunft doch anders aus? - Websperre: Blockieren deutsche Provider die Schattenbibliothek Sci-Hub voreilig? Große deutsche Provider haben eine Sperre errichtet, bevor irgendein Gericht urteilte. Zeigt sich jetzt das Gefahrenpotenzial von Websperren? Wie sehen Alternativen aus? - - Immer teurer: Wo ist die Schmerzgrenze bei Netflix und Co.? Netflix erhöht seine Preise erneut. Wann hören die Preisrunden bei den Streamingdiensten auf? Und wo liegt die Schmerzgrenze bei den Kunden? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
Moderatorin Anna Kalinowsky, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Abgepinnt: Ist der AI Pin mehr Schein als Sein? Das Start-up Humane trat mit dem Anspruch an, das Smartphone abzulösen. Doch der AI Pin fällt in ersten Tests durch. Sind die Rezensenten zu streng oder sieht die Zukunft doch anders aus? - Websperre: Blockieren deutsche Provider die Schattenbibliothek Sci-Hub voreilig? Große deutsche Provider haben eine Sperre errichtet, bevor irgendein Gericht urteilte. Zeigt sich jetzt das Gefahrenpotenzial von Websperren? Wie sehen Alternativen aus? - - Immer teurer: Wo ist die Schmerzgrenze bei Netflix und Co.? Netflix erhöht seine Preise erneut. Wann hören die Preisrunden bei den Streamingdiensten auf? Und wo liegt die Schmerzgrenze bei den Kunden? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
Moderatorin Anna Kalinowsky, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Abgepinnt: Ist der AI Pin mehr Schein als Sein? Das Start-up Humane trat mit dem Anspruch an, das Smartphone abzulösen. Doch der AI Pin fällt in ersten Tests durch. Sind die Rezensenten zu streng oder sieht die Zukunft doch anders aus? - Websperre: Blockieren deutsche Provider die Schattenbibliothek Sci-Hub voreilig? Große deutsche Provider haben eine Sperre errichtet, bevor irgendein Gericht urteilte. Zeigt sich jetzt das Gefahrenpotenzial von Websperren? Wie sehen Alternativen aus? - - Immer teurer: Wo ist die Schmerzgrenze bei Netflix und Co.? Netflix erhöht seine Preise erneut. Wann hören die Preisrunden bei den Streamingdiensten auf? Und wo liegt die Schmerzgrenze bei den Kunden? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
Jane S. Wonda: Very Bad Kings - »Für mich sind diese Bücher der Ausdruck von Feminismus«
Jane S. Wonda im Gespräch mit Wolfgang Tischer über ihre Bücher und ihr Leben als Autorin und Unternehmerin. Ein Podcast-Mitschnitt vom Forum autoren@leipzig der Leipziger Buchmesse 2024. Wie definiert man das Genre Dark Romance am besten? »Die Liebesgeschichte des Bösewichts«, erklärt es Jane S. Wonda im Gespräch zunächst selbst sehr vorsichtig. Googelt man nach dark romance definition so listet Google die Erklärung auf der Website der Autorin wondaversum.de ganz oben: »Dark Romance enthält viele grenzwertige Themen und dunkle Helden. Stell es dir vor, wie die Liebesgeschichte vom Joker mit Happy End und viel prickelnder Erotik. Die enthaltenen Themen gehen an die Psyche, Gewalt gehört zum Alltag und Moral sucht man vergebens.« Gelesen werden ihre Bücher – wie alle New-Adult-Titel – überwiegend von jungen Frauen. Dies wird bisweilen nicht nur auf TikTok kontrovers diskutiert. »Für mich sind diese Bücher der Ausdruck von Feminismus«, sagt Jane S. Wonda im Gespräch. Es sei immer ein Tanzen der Figuren in unterschiedlichen Konstellationen. Und der Böse bekommt am Schluss ein Happy-End. Wechselt man in Leipzig in die Halle 4, sieht man den Stand des Wondaversums, Janes eigene GmbH, die sie mittlerweile gegründet hat, in der sich 10 bis 20 Mitarbeiterinnen um Buchverkauf und Signierstunden kümmern. In der »Black Edition« verlegt Jane S. Wonda mittlerweile auch Bücher anderer Autorinnen – natürlich im gleichen Genre. Am Donnerstag ist noch viel leerer Platz um den Stand, am Freitag nach dem Bühnengespräch, sieht man, warum: Jane S. Wonda signiert und Menschenmassen stehen an, der leere Raum ist gut gefüllt. Im Gespräch erläutert die Autorin, wie sie und ihre Mitarbeiterinnen den Besucherstrom und den Verkauf organisieren. Bisweilen sind es so viele Menschen, dass vielleicht gar nicht alle bis zum Signiertisch gelangen werden. Wie hat es Jane S. Wonda als Self-Publisherin zu diesem Ruhm geschafft? Tatsächlich kam er, so die Autorin im Gespräch, bei ihr über Nacht mit E-Books in Verbindung mit TikTok-Videos. Und natürlich gibt es mittlerweile alle Bücher gedruckt mit Farbschnitt. Welchen Rat kann Jane S. Wonda Neuautorinnen geben? Für sie war es wichtig, »die Idee aufzugeben, dass man selbst zu 100 Prozent weiß, was das Beste für das eigene Buch ist.« Konstruktive Kritik und Rückmeldungen von Testleserinnen und Rezensenten sollte man erst nehmen, um das eigene Schreiben stets zu verbessern. Hören Sie das ausführliche Gespräch mit Jane S. Wonda, aufgezeichnet am 22. März 2024 auf der Leipziger Buchmesse, im Podcast des literaturcafe.de. Nutzen Sie den Player unten nach dem Beitrag. Der Podcast des literaturcafe.de ist zudem auf allen Portalen wie Apple iTunes, Spotify oder Deezer zu hören und zu abonnieren. So verpassen Sie künftig keine Folge mehr.
Club Zero | Gourmet-Kino oder ein Film zum Kotzen?
Club Zero | Gourmet-Kino oder ein Film zum Kotzen? Das könnte interessant werden, überlegte sich Stu, als er sich "Club Zero" ansah. Denn vor dem Film gibt es erst einmal eine fette (Pardon) Triggerwarnung, da Jessica Hausner sich in ihrer neuen Regiearbeit mit dem Thema Essstörungen auseinandersetzt. Dabei ist der Film, in dem "Alice im Wunderland"-Star Mia Wasikowska mitspielt, weniger ein Drama als vielmehr eine Satire. So zumindest empfand es Schlogger sowie auch Stu, als sie den Film sahen, der am 28. März in unsere Kinos kommt. Ob MJ ähnlich denkt oder vielleicht ganz anders, warum unsere Rezensenten mindestens eine Szene im Film zum Kotzen fanden und ob "Club Zero" die vielen negativen Kritiken nach seiner Premiere letztes Jahr in Cannes wirklich verdient hat, darüber und noch viel mehr sprechen sie in diesem Podcast. Also, Finger raus aus dem Rachen und ab auf den Play-Button. Viel Spaß mit der neuen Folge vom Tele-Stammtisch! Trailer Wir liefern euch launige und knackige Filmkritiken, Analysen und Talks über Kino- und Streamingfilme und -serien - immer aktuell, informativ und mit der nötigen Prise Humor. Website | Youtube | PayPal | BuyMeACoffee Großer Dank und Gruß für das Einsprechen unseres Intros geht raus an Engelbert von Nordhausen - besser bekannt als die deutsche Synchronstimme Samuel L. Jackson! Thank you very much to BASTIAN HAMMER for the orchestral part of the intro! I used the following sounds of freesound.org: 16mm Film Reel by bone666138 wilhelm_scream.wav by Syna-Max backspin.wav by il112 Crowd in a bar (LCR).wav by Leandros.Ntounis Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen Folgt uns ab sofort regelmäßig live auf Twitch: twitch.tv/dertelestammtisch
Kleine schmutzige Briefe | PS: Du kannst mich mal
Kleine schmutzige Briefe | PS: Du kannst mich mal 1920 sorgen obszöne und beleidigende Briefe einer anonymen Quelle in der englischen Ortschaft Littlehampton für Aufsehen und Entsetzen. Wer hat es nur auf die Idylle des gottesfürchtigen Städtchens abgesehen? Die Suche nach einem Schuldigen entwickelt sich schnell zu einer Mischung aus Kriminalkomödie und Gesellschaftsdrama, und es gibt zwei sehr gute Gründe, sich das ab dem 28. März in den deutschen Kinos anzusehen: Oscar-Preisträgerin Olivia Colman und Jessie Buckley spielen die Hauptrollen in "Kleine schmutzige Briefe". Doch was bietet der Film sonst noch? Schlogger und Stu gehen dem auf den Grund. Dabei geht es auch um die Macht der Worte und den Kampf um Selbstbestimmung. Klingt eigentlich ganz interessant. Doch warum unsere Rezensenten den Film zwar okay fanden, aber nie vollständig überzeugt waren und wie sie sich selbst beim Versuch, die Hörerschaft zu beleidigen, ins Abseits manövrierten, könnt ihr hören, sobald ihr auf Play klickt. Viel Spaß mit der neuen Folge vom Tele-Stammtisch! Trailer Wir liefern euch launige und knackige Filmkritiken, Analysen und Talks über Kino- und Streamingfilme und -serien - immer aktuell, informativ und mit der nötigen Prise Humor. Website | Youtube | PayPal | BuyMeACoffee Großer Dank und Gruß für das Einsprechen unseres Intros geht raus an Engelbert von Nordhausen - besser bekannt als die deutsche Synchronstimme Samuel L. Jackson! Thank you very much to BASTIAN HAMMER for the orchestral part of the intro! I used the following sounds of freesound.org: 16mm Film Reel by bone666138 wilhelm_scream.wav by Syna-Max backspin.wav by il112 Crowd in a bar (LCR).wav by Leandros.Ntounis Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen Folgt uns ab sofort regelmäßig live auf Twitch: twitch.tv/dertelestammtisch
"Die Wahrheit schreiben" George Orwell. Entwicklung und Methode seines Erzählens - von Dominic Angeloch, eine Rezension von Simon Scharf - Literaturkritik.de
"Die Wahrheit schreiben" George Orwell. Entwicklung und Methode seines Erzählens - von Dominic Angeloch, eine Rezension von Simon Scharf - Literaturkritik.de (Hördauer 14 Minuten) Eintauchen in Fremdheit und den Widerspruch atmen lassen.Dominic Angeloch seziert in „Die Wahrheit schreiben“ die Poetik George Orwells als kritische Schreib- und Lebenspraxis gegenüber den Verlockungen des falschen Bewusstseins Am Anfang muss das Geständnis des Rezensenten stehen, dass der eigene Zugang zum Werk George Orwells bisher auf die kanonischen Texte Animal Farm und 1984 beschränkt war. Die Auseinandersetzung des Literaturwissenschaftlers und Psyche-Chefredakteurs Dominic Angeloch vor allem mit dem frühen (und eher weniger bekannten) Orwell erweist sich auch vor diesem Hintergrund als besonders reichhaltig. Sie schärft in ihrer Detailtiefe, ihren close readings, der Zugänglichkeit des Stils und der alles in allem enorm umfassenden Kenntnis ihres Autors das Bild eines Schriftstellers, dessen Wirkmächtigkeit und Bedeutung in Angelochs Analysen dezidiert zum Ausdruck kommen. Augenöffnend ist dabei zum einen die unterschätzte Relevanz des Kolonialismus für das Orwellsche Leben und Werk, aber auch die literaturtheoretische Tragweite seiner Texte, die gewissermaßen ein umfassendes Bild seines kritischen Weltzugangs zutage fördert, dem Angeloch hellsichtig nachspürt. …“ Eine Rezension von Simon Scharf. Den Text der Rezension finden Sie hier. Sprecher Matthias Pöhlmann Hat Ihnen diese Rezension gefallen, mögen Sie vielleicht auch diese Sendung Kommen Sie doch einmal in unsere Live-Aufzeichnungen in München Schnitt Jupp Stepprath, Realisation Uwe Kullnick --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hoerbahn/message
Die alte Berliner Philharmonie befand sich zwar an der Bernburger Straße im Bezirk Kreuzberg, aber wenn einer der größten Virtuosen seiner Zeit dort konzertierte, schickte natürlich auch das Friedenauer Tageblatt einen Berichterstatter: Fritz Kreisler hatte mit dem Violinspiel bereits für einige Jahre aufgehört, nachdem ihn die Wiener Philharmoniker bei einem Vorspiel abgelehnt hatten, als er im Alter von schon Mitte zwanzig doch noch eine Solokarriere startete, die ihn zu einem der gefragtesten, wiewohl auch umstrittensten Interpreten seines Instruments auf dem Globus machte. Auch in seiner Wahlheimat Berlin – aus der die Nazis den gebürtige Wiener wegen seiner jüdischen Herkunft später vertreiben sollten – wurde Kreisler gefeiert, wie wir von dem mit den Initialen R.B. zeichnenden Rezensenten erfahren. Mit einem Kaufpreis von 120 Milliarden Mark war eine Stadtteilzeitung wie das Friedenauer Tageblatt übrigens kaum billiger als die großen Flaggschiffe der Hauptstadtpresse. Dass es trotzdem lohnte und lohnt, sie zu lesen, untermauert Paula Rosa Leu.
Flüchtlingskrise ergeben. Das Buch wird als komisch und gleichzeitig ernsthaft beschrieben. Der Rezensent kennt den Autor persönlich und erwähnt, dass er das Buch gerade rechtzeitig zur aktuellen politischen Lage gelesen hat. Er betont die Aktualität des Themas und die Parallelen zur realen Situation mit der AfD. Obwohl das Buch im Dialekt geschrieben ist, stellt es für den Rezensenten kein Problem dar, da er selbst aus Hessen stammt. Er lobt die humorvollen Charaktere des Buches, kritisiert jedoch die Handlung im letzten Drittel. Der Autor schafft es laut des Rezensenten, ernste Themen auf amüsante Weise anzugehen und die Taktiken der Populisten deutlich zu beschreiben. Der Rezensent findet dies wichtig und weist darauf hin, dass man dadurch zum Nachdenken angeregt wird. Das Buch wurde 2018 im Rowohlt Verlag veröffentlicht und ist für 10 Euro erhältlich.
[Podcast] Rezension: Der Präsident – Sam Bourne, gelesen von Dana Geissler
In dieser Folge besprechen wir das Buch "Der Präsident" von Sam Bourne, gelesen von Dana Geissler. Der Klappentext verspricht eine fesselnde Geschichte, in der die USA einen unberechenbaren Demagogen als Präsidenten wählen und die Welt den Atem anhält. Schon bald plant der Präsident einen nuklearen Angriff und ein Attentat wird als einziger Ausweg betrachtet, um den drohenden dritten Weltkrieg zu verhindern. Das Buch ist ein rasanter Thriller, der aktuelle politische Entwicklungen in Amerika aufgreift. Die Rezension beginnt mit dem Hinweis, dass es viele weitere tolle Hörbücher gibt, doch dieses Buch sticht heraus. Der Name des Autors, der an "Die Bourne Identität" erinnert, weckt bereits Assoziationen von Verschwörung und Machtmissbrauch. Die Geschichte hat den Rezensenten von Anfang an gefesselt, vor allem durch die Frage, wann die Ereignisse tatsächlich eintreten werden. Es wird sogar ein Vergleich mit Orson Welles' Hörspiel "Krieg der Welten" gezogen, das 1938 einige Hörer glauben ließ, dass der Präsident der USA auf eine Beleidigung aus Nordkorea mit atomaren Angriffen reagieren würde. Der Thriller hat deutliche Realitätsbezüge und kombiniert diese mit trockenem schwarzen Humor. Es gibt Elemente, die stark an die letzten US-Wahlkämpfe erinnern, und dies kommt sicher nicht von ungefähr. Der Rezensent findet dies jedoch charakteristisch für einen guten Thriller, der die Frage aufwirft, ob dies tatsächlich passieren könnte. Als Hauptkritikpunkt wird angemerkt, dass die Geschichte stellenweise vorhersehbar ist. Zudem verstärkt sie die Abneigung gegen zu viel Kontrolle durch Apps und technologische Entwicklungen, die auch gegen den Menschen verwendet werden können. Interessanterweise greift das Buch auf eine altmodische Methode, das Selbstattentat, zurück. Der psychische Kampf der Hauptfigur Maggie ist das zentrale Element der Geschichte. Sie stellt sich die Frage, wie weit sie gehen würde, um Schlimmeres zu verhindern, und ob sie zusehen könnte, wie ein Mensch getötet wird, wenn sie glaubt, dass er die Welt ins Verderben stürzen wird. Diese Fragen sorgen für Spannung beim Zuhören, auch wenn man zwischenzeitlich denkt, man habe alles durchschaut. Die letzte CD hält noch einige Überraschungen bereit. Insgesamt ist es eine gute und spannende Geschichte, nur das Ende wirkt etwas unbefriedigend, da zu viele Fragen offen bleiben, insbesondere bezüglich der Hauptfigur Maggie. Es bleibt die Frage, ob sie nur eine Schachfigur in einem großen Spiel ist. Das Hörbuch wurde 2017 veröffentlicht und hat eine Spielzeit von 464 Minuten. Es kann noch für 8,99 Euro in jeder handelsüblichen Buchhandlung bestellt werden.
Am 27. September 2023 präsentierte der Schriftsteller, Lyriker und Essayist Jörg Bernig seinen neuesten Roman „Eschenhaus“ und führte das Publikum mit sommerlich-sinnlichen Textpassagen durch Raum und Zeit. Trotz der von Rezensenten immer wieder vermerkten persönlichen Bezüge, ist der Roman weit mehr als eine verschlüsselte Autobiographie. * Jetzt die Bibliothek des Konservatismus unterstützen! * PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4AM9E488ETCZ2 Banküberweisung: Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung IBAN: DE15 1009 0000 2125 2750 04 BIC: BEVODEBB * Einen Überblick über die Arbeit der Bibliothek und die nächsten Veranstaltungen finden Sie unter https://www.bdk-berlin.org/ * Facebook: https://www.facebook.com/bdk.bln Instagram: https://www.instagram.com/bdk_berlin/ Twitter: https://twitter.com/BdK_Berlin Gettr: https://gettr.com/user/bdk_berlin
The Art of Love - Von Influencern und Willy Wankers Dildofabrik
The Art of Love - Von Influencern und Willy Wankers Dildofabrik Die Temperaturen sind hoch, die Herzen erhitzen sich und in den Kinos läuft ab dem 13. Juli "The Art of Love". Wie vom Tele-Stammtisch gewohnt, sollte auch dieser Film von zwei passenden Rezensenten besprochen werden. Doch weil unsere Sexual White Chocolate Sven keine Zeit hatte und unser Sexy Gummybear Manuel für „Schweinkram“ extra Bezahlung verlangt hat, haben wir stattdessen einfach kurzerhand Andi und Stu die Komödie über Sex Toys, Influencer, KI und Freundschaft sehen und besprechen lassen. Das Ergebnis ist jetzt vielleicht nicht ganz so erotisch und verführerisch wie gehofft, nach dem Podcast wisst ihr aber dennoch, ob sich der Gang ins Kino lohnt und was "The Art of Love" vielleicht gefehlt hat, um in orgastische Höhen aufzusteigen. Diese erreicht der Tele-Stammtisch übrigens, wenn ihr auf Play drückt. Viel Spaß mit der neuen Folge des Tele-Stammtischs! Trailer Wir liefern euch launige und knackige Filmkritiken, Analysen und Talks über Kino- und Streamingfilme und -serien - immer aktuell, informativ und mit der nötigen Prise Humor. Viel Spaß mit unseren Besprechungen! Website | Youtube | PayPal | BuyMeACoffee Diese Ausgabe ist entstanden in Kooperation mit unserem Partner Cyberghost VPN. Als Hörer/-in des Tele-Stammtischs könnt ihr euch dort 83% Rabatt auf den Zweijahres-Plan sichern und dabei für nur 2,08 Euro pro Monat plus vier Monate gratis endlich das Maximum aus eurem Streamingerlebnis herausholen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter www.cyberghostvpn.com/tstfilmkritiken. Großer Dank und Gruß für das Einsprechen unseres Intros geht raus an Engelbert von Nordhausen - besser bekannt als die deutsche Synchronstimme Samuel L. Jackson! Thank you very much to BASTIAN HAMMER for the orchestral part of the intro! I used the following sounds of freesound.org: 16mm Film Reel by bone666138 wilhelm_scream.wav by Syna-Max backspin.wav by il112 Crowd in a bar (LCR).wav by Leandros.Ntounis Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen Folgt uns ab sofort regelmäßig live auf Twitch: twitch.tv/dertelestammtisch
[Podcast] Rezension: Das Mädchen aus Apulien – Iny Lorentz, gelesen von Anne Moll
In dieser Folge präsentiere ich eine Hörbuchrezension des Buches "Das Mädchen aus Apulien" von Innie Lorenz, gelesen von Andul. Es handelt sich um einen historischen Roman, der im 13. Jahrhundert in Italien spielt. Die Geschichte dreht sich um Panolfina, die Tochter einer Sarrazin-Prinzessin und eines apollischen Grafen. Nach dem Tod ihres Vaters wird Panolfina von einem Nachbarn in seine Burg gebracht, um sie zur Heirat zu zwingen. Doch Panolfina gelingt die Flucht und sie findet Schutz am Hofe von Friedrich, dem König von Sizilien und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sie setzt alles daran, Friedrich zur Rache gegen ihre Feinde zu bewegen. Die Hörbuchrezension gibt einen positiven Eindruck von dem Buch wieder und lobt die gelungene Mischung aus historischen Fakten, Fantasie und einer Prise Romantik. Der Rezensent empfiehlt das Hörbuch und hebt auch die gelungene Darstellung des Klerus hervor. Eine kleine Episode mit der heiligen Elisabeth wird erwähnt, die den Rezensenten dazu veranlasst hat, nach weiteren Informationen zu suchen. Das Hörbuch "Das Mädchen aus Apulien" ist seit 2016 erhältlich und kann für 12 Euro heruntergeladen werden.
Ist die Liebe stärker, je länger sie hält? Julia Schochs neuer Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“
Am Ende von langjährigen Beziehungen: In dieser Folge geht es um „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ von Julia Schoch. Wo geht die Liebe hin, wenn sie verschwunden ist? Das fragt sich Julia Schoch in ihrem Bestseller-Roman, den manche Rezensentinnen und Rezensenten als Jahrhundertroman über die Liebe feiern. Dabei erzählt Julia Schoch kein Fest der Liebe, sondern eher das, was übrigbleibt, wenn das Fest abgefeiert ist: Man steht verkatert in der eigenen Wohnung, man müsste alles mal aufräumen, einiges ist zu Bruch gegangen. In diesem Kater-Zustand befindet sich die 30 Jahre alte Beziehung der Ich-Erzählerin, die sich mit ihrem Text direkt an ihren Partner richtet. „Ich verlasse Dich“, der entscheidende Satz, mit dem es losgeht. Chefredakteur Thomas Thelen und Redakteurin Andrea Zuleger diskutieren darüber, ob das Buch hält, was es verspricht. Vor allem auch, ob der Text die Verheißungen, die der Verlag auf dem Umschlag weckt, einlöst. Was ist das Geheimnis langer Beziehungen und Ehen? Wie entkommt man den Abnutzungserscheinungen der Liebe? Und ist die Dauer einer Beziehung schon ein Wert an sich? Tut jeder, der es einmal so weit geschafft hat, gut daran zu bleiben? Spannende Fragen zu einem Thema, das bei Julia Schoch weniger Gefühlsding als bewusste Entscheidung ist: Bleiben oder gehen? See omnystudio.com/listener for privacy information.
Homophobie, Sex, kleine Männer, starke Frauen: John Irvings neuer Roman „Der letzte Sessellift“
Kann ein Sessellift so spannend sein, dass man um ihn herum einen Roman schreibt? John Irving kann das! 1.100 Seiten dick ist „Der letzte Sessellift“ von John Irving, den schon kurz nach Erscheinen viele Rezensenten für das Opus Magnum des amerikanisch-kanadischen Kultautors halten. Ob es auch sein letztes großes Buch sein könnte und warum es sich zu lesen lohnt, erfahrt Ihr in der zweiten Folge unseres Literatur-Podcasts „Auslese“. Homophobie, Sex, kleine Männer und starke Frauen, die Mutter-Sohn-Beziehung, Suche nach dem Vater, aber auch der Vietnamkrieg, Aids und die Trump-Wahl: „Der letzte Sessellift“, der größtenteils im Schnee von Colorado spielt, liest sich wie ein Best of der wichtigsten Irving-Themen. Es erzählt 80 Jahre aus einem ungewöhnlichen Leben des Adam Brewster in einer ungewöhnlichen Familie voller skurriler, liebenswerter Typen.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Lesestoff SPEZIAL. Vier weihnachtliche Empfehlungen unserer Rezensentinnen/Rezensenten
Viele Bücher und viele Tipps gab es bei WDR3 auch im Jahr 2023. Kurz vor Weihnachten wollen Ihnen vier "Lesestoff" Rezensentinnen und Rezensenten noch vier besondere Empfehlungen ans Herz legen. Fürs Schmökern "zwischen den Jahren". Von Jutta Duhm-Heitzmann; Andrea Gerk; Terrance Albrecht; Christoph Vratz.
Karosh Taha über Toni Morrison, Emine Sevgi Özdamar, Etel Adnan und Zadie Smith.
Meine heutige Gästin ist die wunderbare Schriftstellerin Karosh Taha. Karosh ist im Jahr 2018 mit ihrem furiosen Debüt „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ auf der literarischen Bühne aufgetaucht. Zwei Jahre später hat sie dann mit „Im Bauch der Königin“ nachgelegt, und ist für dieses grandiose Buch verdienterweise mit Lob und Preisen überschüttet worden. Karosh hat nicht eine, nicht zwei, sondern gleich vier Autorinnen mit in unser Gespräch gebracht und sich gewünscht, dass wir uns thematisch auf den Einfluss von Autorinnen of Colour auf unsere Schreibbiographien konzentrieren, aber auch was es für uns selbst bedeutet, als nichtdeutschstämmige Autorinnen öffentlich zu sein. Deshalb sprechen wir erstmal viel über Toni Morrisson, Emine Sevgi Özdamar, Etel Adnan und Zadie Smith, aber auch über Rassismus in der Branche, exotisierende Literaturveranstaltungen mit Samowar, engstrirnige Rezensenten und die Enge von Schubladen, in die man als Migrationsmaskottchen einsortiert wird. Kleiner Disclaimer: Wir hatten leider diesmal auf beiden Seiten ein kleines Lärmproblem – bei Karosh im Hintergrund gab es jede Menge Verkehr und Sirenen, bei mir nebenan gab's Baulärm. Ich hoffe, ihr lasst euch von den kleinen Störgeräuschen nicht abschrecken und könnt dieses lange, intensive, mäandernde Gespräch genauso genießen wie wir, als wir es geführt haben. Und wenn euch der Podcast gefällt, klickt gern auf abonnieren, empfehlt uns weiter und folgt uns auf Instagram unter fempire_podcast. Alles über Karosh findet ihr hier und hier Wir sprechen über Toni Morrisson, Emine Sevgi Özdamar, Etel Adnan und Zadie Smith Außerdem erwähnen wir diesen Artikel und diese Ausstellung.
OverExposition - Ach Du Scheiße... nicht wieder so ein "Genrefilm"
Wenn Inhaltsangaben, Pressetexte und Rezensenten mal wieder eine “Genrefilm”-Überraschung aus Deutschland versprechen, dreht sich Daniel gleich der Magen um. Viel zu oft in der Vergangenheit war der Begriff letztendlich nur eine Vorab-Entschuldigung für gut gemeinte, im Endeffekt aber eben wirklich NUR gut gemeinte, keinesfalls aber gelungene Kinofilme abseits konventioneller deutscher Alltagsproduktionen. “Ach Du Scheisse” veranlasst uns aktuell, dieses wiederkehrende Phänomen aus unserer persönlichen Sicht im Podcast einmal genauer zu erklären.
Richard David Precht, Harald Welzer: Die vierte Gewalt
Alte weiße Männer können per se nichts für ihren alten weißen Schniedel, aber wofür sie etwas können ist, wenn dieser raushängt, mitten in einer deutschen Talkshow, metaphorisch im Gesicht einer deutschen Journalistin und per Bildfernübertragung damit auch in unserem. So war das äußerst unangenehm geschehen, kürzlich, in der TV-Talkshow “Markus Lanz”. Der Schniedel gehörte Richard David Precht, den wir hier kürzlich noch als “den Perückenträger aus Solingen” milde belächelt hatten. Ein zweiter weißer Schniedel hing, das muss gerechterweise gesagt werden, nur halb raus und gehörte dem frisurtechnischen Nacheiferer Prechts, dem Soziologen Harald Welzer.Besprochen werden sollte deren gemeinsam geschriebenes Buch “Die vierte Gewalt: Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird – auch wenn sie keine ist”, ein wissenschaftliches Werk, wie gerade Welzer immer wieder betonte. Eingeladen zur kritischen Textanalyse waren zwei Journalistinnen, die im Buch, so wurde schnell klar, wohl selbst wissenschaftlich beleuchtet wurden, Melanie Amann vom “Spiegel” und Robin Alexander von der “Welt”.Das Buch, nicht nur im Titel ein Frontalangriff auf den Deutschen Journalismus, kam bei den anwesenden Betreibern desselben erwartungsgemäß nicht an und da diese genug Zeit hatten, sich auf die Konfrontation vorzubereiten, sahen die Autoren beide nicht besonders gut aus, zumindest aus der Perspektive dieses unparteiischen Beobachters des Gemetzels. Zwar hatte ich kurz nach der Wende keine Zeitung unter einem Kilogramm Papiergewicht konsumiert, schon weil man in der Mittagspause, die Süddeutsche oder die FAZ auf dem Tisch konzentrierend sein partymüdes Haupt auf diese betten konnte, um ein paar Minuten leise in die Kommentarspalten sabbernd zu ruhen. Aber wann ich das letzte mal ein solches Leitmedium überhaupt in der Hand hatte, geschweige denn darin intensiv gelesen, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Es muss ein Jahrzehnt her sein. Aber natürlich bilde ich mich politisch intellektuell, nur halt nicht, wie die Autoren Precht und Welzer das von mir erwarten. Die Einzigen, die damit umzugehen in der Lage schienen, waren die beiden leitmedialen Journalisten. Und während diese ein Argument nach dem anderen aus dem Buch auseinander nahmen und den Buchautoren um die Ohren hieben, zogen sich bei Precht die Hodensäcke in den Unterbauch zurück, die Beine wurden breiter und breiter aufgestellt und mit scharfer Stimme ergoss sich des Intellektuellen Mansplaing in's Gesicht der Spiegel-Chefredakteurin. Diese lachte ihn aus, Harald Welzer zog sich aufs Wissenschaftliche zurück und Robin Alexander wurde spontan zum Feministen.Die erste Amtshandlung des Rezensenten muss nun sein, sich von den verstörenden Bildern der Veranstaltung zu reinigen und das Buch als solches zu lesen und zu besprechen. Ich verspreche nichts, aber gebe mir Mühe.Das Buch beginnt einleitend mit besagtem Frontalangriff auf die deutsche Presse, die sich vom willfährigen Berichterstatter des Regierungshandelns zum politischen Akteur emanzipiert habe. Es wird ein bisschen Verständnis gezeigt: Internet, das sog. Twitter, Kapitalismus. Es wird viel befußnotet, damit man gleich sieht, dass was man hier liest, auch wirklich Wissenschaft ist.Wir ahnen Schlimmes, doch es folgt das erste Kapitel, das den Begriff “Öffentlichkeit” definiert und angenehm historisch, neutral, sachlich ist und damit offensichtlich geschrieben wurde, als keine aufmüpfigen Frauen im Raum waren. Oder - wahrscheinlicher - von Harald Welzer. Auch hier wird ordentlich befußnotet, wissenschaftliche Quellen wie der “Deutschlandfunk” und die Wochenzeitschrift “Die Zeit” müssen herhalten, weil Wikipedia als Fußnote unwissenschaftlich ist . Das alles, um Zitate zum US-Amerikanischen Herausgeber Hearst zu belegen, einem Kriegstreiber, wie wir lernen. Und wir ahnen, worauf der Kritiker der Waffenlieferungen an die Ukraine abzielt.Im darauf folgenden Kapitel wird das fehlende Vertrauen des Bürgers ins “System” aufgrund Unterrepräsentanz besagten “Bürgers” im Verhältnis zum “Politiker” in den Leitmedien analysiert. Das passiert, wir hatten es schon befürchtet, anhand der Flüchtlingskrise 2015 und der Coronakrise 2020. Untersucht wird das Ganze mit “inhaltsanalytischen Studien”, also Textanalysen von Veröffentlichungen der “Leitmedien” und der Aufschlüsselung nach darin auftauchenden Themen, Personen, Gesellschaftsschichten. Was Precht und Welzer dabei versuchen herauszufinden ist, ob alle Gesellschaftsschichten in der Berichterstattung zu Wort kommen, und ob diese inhaltlich “ausgewogen” ist, also ob alle öffentlichen Meinungen repräsentiert sind.Problematisch dabei: Studien von Extremsituationen als Grundlage zur Beweisführung von Thesen zu verwenden ist generell schwierig und speziell in diesem Fall fragwürdig, denn bei den Fragen, die diese beiden “Krisen” aufgeworfen haben, gibt es nun mal anerkannte moralisch-ethische Grundhaltungen in unserem Land, die eben nicht fifty/fifty "Kieken wa ma, was det Volk so denkt!” zu beantworten sind, sondern im Rahmen der Bundesdeutschen Grundordnung schon eindeutig beantwortet sind: “Flüchtlinge aufnehmen Ja!”, sagt das Asylrecht, “Impfen Ja!”, sagt das Infektionsschutzgesetz. Was zu den Themen in den Leitmedien stand, war also recht erwartbar.Die Haupterkentnis aus den Textanalysen (hier beispielhaft zur Flüchtlingskrise) ist, so das Buch, dass hauptsächlich Politiker zu Wort kamen (zu bis zu 80%), nicht jedoch die Helferinnen oder gar die Betroffenen, also die Flüchtenden. Das klingt dramatisch, ein wirklich kurzes Überlegen kann einen aber darauf bringen, dass in einer unübersichtlichen Situation, einer Krise eben, in der vornehmlich um Ordnung gerungen wird, diejenigen zu Wort kommen, deren Job das praktische Errichten von Ordnung ist. Politiker zum Beispiel. Stattdessen wird beklagt, dass die lokalen Helfer in der Berichterstattung unterrepräsentiert wären und passend zum Ton des ganzen Buches werden gleich mal Parallelen gezogen zu obrigkeitshöriger Wilhelminischer Berichterstattung, no s**t. Das Problem ist doch aber: Wie löst man eine nationale Krise? Diese den “Nothelfern” überzuhelfen ist eine Option, aber sinnführender ist es, in einem solchen Fall nationale (und noch besser europäische) Lösungen zu etablieren. Und darüber wurde berichtet. Verrückt.Hier geht also mit den Autoren der Wunsch nach Sensationalismus durch, sie wählen exakt die nicht repräsentativen Beispiele zur Untersuchung aus und schießen sich damit selbst ins Bein. Wie viel interessanter wäre es, ein medial weniger präsentes Thema zur Textanalyse zu wählen, idealerweise eines, welches nicht in statistisch kaum verwertbaren, minimalen Zeiträumen aufflammt und wieder erlischt. Ich bin sicher, die aufmerksame Leserin unserer gesammelten Rezensionen kommt auf ein paar Ideen.Und am Ende des Abschnitts zur Inhaltsanalyse “Flüchtlingskrise” merken das die Autoren sogar, Zitat: “Aber könnte es nicht sein, dass die leitmediale Berichterstattung der Presse zur sogenannten Migrationskrise diesbezüglich ein Ausnahmefall war?”. So close. Sie setzen fort: “Schauen wir deshalb auf andere Krisenereignisse und ihre mediale Bearbeitung."Es folgt also die gleiche Übung zur Coronakrise ohne jeglichen Erkenntnisgewinn: Politiker stehen während einer Krise im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Wer sonst, fragt man sich.Und weil man auf durchschossenen zwei Knien immer noch irgendwie ins Ziel robben kann, folgt die exakt gleiche Argumentation zur nächsten Krise, der aktuellen, jetzt gleich ganz ohne wissenschaftliche Untersuchungen, weil, ist ja noch im Gange: der Ukrainekrieg. Es lohnt kaum, die gleichen Argumente nochmals zu besprechen, zumal sie diesmal nicht analytisch unterlegt sind. Dass dieses Fehlen einer Analyse das Thema für ein nach wissenschaftlichen Methoden erstelltes Buch ausschließen sollte, ignorieren die beiden Wissenschaftler und so müssen wir ein dutzend Seiten Meinung über uns ergehen lassen, die, wie es Meinungen so an sich haben, teilweise Übereinstimmung erzeugen, hier z. B.: das Fehlen der Berichterstattung in deutschen Medien zur Haltung zum Krieg aus anderen Teilen der Welt. Viele der Meinungen führen jedoch zu entschiedener Ablehnung aufgrund von: Blick auf die f*****g Landkarte.Das nächste Kapitel “The Unmarked Space” greift die Erkenntnisse aus dem vorigen auf und will laut Untertitel extrapolieren, “was Leitmedien nicht thematisieren” und man ist, leicht erschöpft, geneigt hier zum Rotstift zu greifen wie der alte gestrenge Mathelehrer und den Rest des Buches ungelesen wie einen misslungenen mathematischen Beweis durchzustreichen und mit einer 5 zu benoten. Denn wer im ersten Schritt der Beweisführung einen solchen entscheidenden Fehler begeht, wie die beiden Autoren, namentlich Textanalysen nicht repräsentativer Ereignisse für den allgemeinen Erkenntnisgewinn heranzuziehen, begeht etwas, was man in der Philosophie Fallazien nennt, aber da man selbst aus denen noch etwas lernen kann und wir 20 EUR überwiesen haben, nehmen wir die Herausforderung an, das Ding zu Ende zu lesen. Es wird zum Beispiel spannend sein zu sehen, ob der “Fehler” im ersten Schritt nur gemacht wurde um die Thesen wirksamer an den Leser zu verkaufen, die Thesen also trotzdem und im Grunde so vertretbar sind und nur sensationsheischend eingeführt wurden, oder ob die Autoren tatsächlich ihre Integrität als Wissenschaftler aufs Spiel setzen und uns einen großen Wissenschaftsblabla überhelfen, nur um publikumswirksam ihre jeweiligen Lieblingssäue durchs Internet zu ranten, Waffenlieferungen an die Ukraine im Fall Welzer und dass ihn keiner ernst nimmt, den Richard David Precht. Und zugegeben ist das Buch, wenn immer es von Welzer im Erklär- und nicht im Argumentationsmodus (und von Precht gar nicht) geschrieben wird, lesbar und milde interessant.Wohlan, was also wird von unseren Leitmedien nicht thematisiert? Tipps werden angenommen.Zunächst setzt sich ein Pattern fort. In den Einleitungen, hier, “was bedeutet Realität in der Medienlandschaft?”, wimmelt es von Fußnoten, die Eindruck machen, in den anschließenden Behauptungen, die die Grundlage für den Beweis der eigenen Thesen legen sollen, fehlen sie plötzlich. Da wird mal eben in einem Nebensatz die Behauptung aufgestellt, dass Informationen, die nur mit großer Mühe, Aufwand und sorgfältiger Recherche zu erlangen sind, immer seltener würden, eine Behauptung, die nach einer Fußnote mit Belegen dafür schreit, aber ohne diese auskommen muss. Vielleicht liegt es daran, dass erkennbar am anprangernden Schreibstil (“erschreckend”, “Vereinseitigung der Perspektive”, “vorauseilender Gehorsam”) der Solinger Intellektuelle P. die Klinge schwingt und sich erwartbar selbst mutiliert. Der Zweck dieser Operation am eigenen Hirn ist ein rant mit dem Tenor, dass Journalisten lieber Feuilleton-Pingpong mit sich selbst spielen denn zu Recherchieren, lieber mit Eliten kuscheln statt sich dem unsichtbaren Teil der Bevölkerung, den Unterschichten und Derlei, zu widmen.Dabei kommen die Autoren mittelbar zum Thema der engen Vernetzung zwischen Politik und Journalismus und haben dort an sich die richtige Fakten bei der Hand und zitieren auch daraus, hier eine Studie aus 2014, die damals über den Umweg der Satiresendung “Die Anstalt” die Runde machte und die Vernetzung von NATO-nahen Stiftungen und Journalisten wie Joffe und Bittner von der “Zeit” aufdeckten. Wie sich herausstellt, hatte aber Harald Welzer mittlerweile das Worddokument geblockt und kommt, nicht ohne vorherige Absicherung, dass hier keinesfalls ein Lügenpressevorwurf erhoben werden soll (besser ist das) zum erwartbaren Punkt: Waffenlieferungen an die Ukraine. Dass sich die beiden Autoren ausgerechnet den Ukrainekrieg als Beispiel für verengte Pluralisierung in den Medien vornehmen, ist tragisch. Sie gehen damit in die gleichen Fallen, die sie den kritisierten Medien vorwerfen. In Welzers Fall, als Unterzeichner des “Emmabriefes” gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine, nimmt er ein Thema, in welchem er selbst die Öffentlichkeit manipulieren möchte als Beispiel dafür, dass die Medien die Öffentlichkeit manipulieren. Und die Rampensau Precht sagt natürlich “let's go for it” denn er weiß, wann ihr Buch rauskommt und ist sich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt der Krieg noch das Thema No 1 sein wird und damit Medienpräsenz garantiert ist. Das ist tragisch, denn die Vorwürfe der Verengung der medialen Informationsvermittlung sind es wert, dass man ihnen auf den Grund geht, aber, mal abgesehen vom Holocaust, ist jedes Thema geeigneter, das zu diskutieren als ein Krieg, in dem Angreifer und Verteidiger auf einer f*****g Landkarte zu erkennen sind.Das Ende des Kapitels deutet an, welches Mitglied des Autorenduos gleich den Textprozessor beackern darf: mit bestechender Logik schreibt Precht: “Wer in der Politik nicht vorkommt, kommt auch in den Medien nicht vor. Und umgekehrt.” Das stimmt, a) immer, b) wenn doch nicht, dann doch, indem man “zwangsläufig” davor schreibt und c) “Zur Sicherheit machen wir das jetzt kursiv!”.Es geht also um “Gala-Publizistik”, wie das Kapitel überschrieben ist und jetzt geht's zur Sache, denn “Politischer Journalismus sei Journalismus über Politiker, weniger über Politik”. Es riecht nach Futterneid und Brusttrommellei und es wird im ersten Absatz klar, wer der andere Gorilla sein soll: Robin Alexander, Chefredakteur der Welt: jemand der so prototypisch wie ein CDU-Wähler aussieht, dass ihm CDU-Politiker wohl immer alles erzählen müssen und der das dann also weitererzählt. Doch wir werden überrascht. Nicht Precht hat beef, der bisher so fundiert schreibende Welzer nimmt sich das Mitglied des FC Schalke 04 Fanclub “Königsblau Berlin” zur Brust, und zwar anhand einer Story, in der Robin Alexander Informationen aus einer CDU/CSU-Fraktionssitzung zuerst auf Twitter veröffentlichte, statt am nächsten Tag in der “Welt”. Das sei ein Skandal, unjournalistisch und ein Beispiel für das Grundübel, weil man in Realtime in die Fraktionssitzung zurück funke, statt hinterher darüber zu berichten und damit Politik beeinflusse. Man dankt als Leser Harald Welzer leise dafür, dass es nicht darum ging, dass er den Alexander nicht leiden kann (ok, wissen wir nicht) sondern, dass er Twitter nicht leiden kann. Das wissen wir genau, weil Harald Welzer kein Twitterprofil hat. Vielleicht hat er Twitter auch einfach nicht verstanden.Precht übernimmt schnell wieder, schließlich hat er sich die Überschrift des Kapitels ausgedacht. Es folgen freie Assoziationsketten in bildreicher Sprache zum Thema Medien und Politik, die komplett frei von Begründung und komplett zustimmungsfähig sind: Politik wird unipolarer, Politiker unschärfer, Medien lauter. Das ganze unterlegt mit altbekannten (und richtigen) Beispielen aus der Zeit der neunziger und nuller Jahre, wie die Rot-Grünen das gemacht haben, was auch die Schwarz-Gelben gemacht hätten: Kampfeinsätze in Jugoslawien, Dosenpfand und Hartz IV. Kanzlerduelle seien US-Cosplay, polarisierte Wahlkämpfe bringen Einschaltquoten und die bringen Geld, wobei auch hier wieder die Fußnoten mit den Belegen fehlen, angesichts des Autors wohl aus Faulheit, denn wegen fehlender Zahlen, die aber in Deutschland vielleicht nicht ganz so aussagekräftig wären, wie die in den USA, was z.B. die Profite von Spiegel oder RTL in Wahlkampfjahren vs. dazwischen betrifft. Aber es wäre interessant gewesen, das zu vergleichen. Nichts von dem tut weh, nichts von dem macht uns schlauer, aber Precht liest gerne Precht und da müssen wir jetzt alle durch. Was schade ist, weil sich aus diesen Plattitüden und bekannten Weisheiten etwas entwickeln lässt. Dazu muss man natürlich seine Metaphernsucht im Griff haben und vielleicht nicht nur Beispiele aufzählen, die wir alle auch so im TV sehen und die uns alle genauso aufregen, wie z.B. das aufs Wort vorhersagbare Frage- und Antwortspiel zwischen Journalisten und Parteivorsitzenden an Wahlabenden. Da sollte schon mehr kommen, also besser zurück zu Welzer.Aber: F**k! S**t! Der hatte 2012 im Fernsehen den TV-Psychologen gegeben und war damals mit einer psychologischen Fernanalyse des amtierenden Bundespräsidenten Christian Wulff zum Medienschaffenden geworden. Autsch. Das muss natürlich proaktiv erwähnt werden, und zwar mit dem wirklich grandiosen humblebrag, dass man nicht wissen könne, ob Welzer damals zum Rücktritt des Bundespräsidenten beigetragen habe. Man sagt “mea culpa” und macht das Beste draus: man bestätigt seine Tätigkeit als Jäger im Fall Wulff und beschreibt, wie man sich so fühlt als Teil der Meute (Zugehörigkeit, Anerkennung, Komplizenschaft) und haut uns damit allen auf den Kopf. Uns allen heißt in dem Fall: uns allen in der “Wahlverwandtschaft” bei Twitter, wenn es uns auf dem Socialmedia-Dienst nicht um Aufklärung oder gar Wahrung des Gemeinwesens vor Schaden gehe (what?), sondern darum, jemanden zur Strecke zu bringen und dafür Beifall zu bekommen. So schreibt das der R.D.P. Oder der H.W. Ja, HW und RDP, so nennen sich die Bros im Buch. Yo.Zum Glück sind wir in der Twitterfamilie gleich wieder aus der Schusslinie, R.D.P., also der Richard, hält wieder auf seine eigentlichen Feinde, es fallen Worte wie “Enthemmung”, “Moralverlust”, “Anstandsniveau”, “Verunglimpfung” und “Treibjagd”. Das alles explizit auf den deutschen politischen Journalismus bezogen. Unter solchen Substantiven macht es der Precht nicht und wir hoffen im nächsten Kapitel auf Antworten, warum das so ist. Der Titel lässt nichts Gutes hoffen. Er lautet:CursorjournalismusNicht nur das schwache Kunstwort, auch die ersten Sätze im Kapitel lassen uns wissen, wer jetzt schreibt. Denn es geht um: Waffenlieferungen an die Ukraine. Ok, die Marke ist gesetzt und Harald Welzer gibt uns also einen Abriss über den Unterschied zwischen unrealistischen Verschwörungstheorien (Lügenpresse, Coronaleugner) und der tatsächlichen und durchaus belegbaren Regierungsnähe von Journalisten. Das ist der Stuff, wegen dem wir hier sind. Welzer belegt und beschreibt, ordnet ein und ist auf dem besten Wege uns Erkenntnisgewinn, wenn nicht Lösungen zu präsentieren, und muss doch immer wieder auf den Ukrainekrieg zurückkommen, als hätte er einen alten Aufsatz zum Thema zweitverwertet und mit seinem aktuellen beef befüllt. Das ist, wie schon einige Male im Buch, schade, denn natürlich hat Welzer was zu sagen zum Thema und wäre er nicht so abgelenkt, würde er es tun, wir sind sicher. Und tatsächlich, nach und nach bekommen wir interessante Abrisse aus der bundesdeutschen Geschichte, als man noch wusste, wer journalistisch rechts und wer links stand, kongruent zur Polarisierung der politischen Lager. Seit dem Mauerfall ist nichts mehr links oder rechts und alles strebe zur Mitte und das führe dazu, dass die Medien wichtiger würden. Ok. Warum genau? Welzer wird konkreter und führt, man möchte fast sagen “plötzlich” eine stimmige, bedenkenswerte und gut erklärte Theorie der Medien in einer Zeit hoher Komplexität und geringer Aufmerksamkeitsspanne ein. Ziemlich genau zur Hälfte des Buches sagt mein Kindle. Ich komme mir vor wie ein Bergarbeiter, den Abraum hinter sich, die Silberader im Blick. Leider greift Kumpel Precht zur Hacke und meint, statt uns Welzers gut gefügten Ansichten zu überlassen, brauchen wir jetzt schnelle und rassig formulierte Schlussfolgerungen und begründet mit diesen (mal wieder) seine persönlichen Ansichten, die aktuellen Leitmedien wären eine Meute von Bluthündinnen. Es folgen Absätze mit den folgenden Worten, die immer aktuelle TV- und Pressepublikationen beschreiben: “Jagdfieber”, “Marschtakt”, “über jemanden herfallen”, “Verunglimpfen”, “hysterische Ausgrenzung”. Die Pressemeute erzeuge so ein “Wir”, werde also zur homogenen Massen und Welzer übernimmt gerne die Vorlage und verdächtigt diese der unisono Kriegstreiberei durch das Befürworten von: Waffenlieferungen in die Ukraine. Es ist ein bisschen traurig.Was Cursorjournalismus eigentlich ist? Es ist zu bescheuert. Und auch irrelevant. Es lohnt kaum die folgenden Kapitel einzeln durchzugehen, auch wenn das verdächtig Precht-faul klingt. Das Pattern ist immer das gleiche: Welzer doziert und befußnotet sozialpsychologisch mäßig interessant auf eine Schlussfolgerung hin, die immer in etwa darauf hinausläuft, dass Journalisten einfach nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Dann übernimmt Precht und denkt sich ein paar scharfe Adjektive und Metaphern aus, um die Schlussfolgerung für den beschränkter vermuteten Teil der Leserschaft nach Hause zu prügeln. Der klopft sich vermutet auf die Schenkel und wirft Facebook an um die saftigen Formulierungen dort reinzuposten, damit Reichweite werde. “Der Journaille haben wir's gezeigt!” denkt Precht privat und formuliert für die Öffentlichkeit seriös um. “Worauf habe ich mich bloß eingelassen” denkt Welzer, und versteckt sich öffentlich hinter seiner Wissenschaftlerkarriere und hofft, dass Putin bald den Löffel abgibt und die Öffentlichkeit seine peinlichen intellektuellen Entgleisungen zum Thema vergisst.Was vom Anfang bis ans Ende des Buches immer und immer wieder erstaunt, ist, wie unreflektiert man sein kann und man fragt sich: ist das, weil oder trotzdem die Autoren sich permanent in die Öffentlichkeit begeben? Sie schreiben: Man wisse ja, dass es unseriös sei, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, wie das auf diesem Twitter ständig passiere und finden dann ihre Argumente in Reden von Springer-Chef Mathias Döpfner. Man beharrt auf Recherche und dem Schreiben über Dinge, von denen man etwas verstehe und stellt sich dann, wie so ein pickeliger Abiturient in der Berufsberatung, vor, wie Redaktionskonferenzen in großen Tageszeitungen ablaufen, statt mal zu recherchieren, was dort wirklich passiert. Es wird von der ersten Seite an die “Personalisierung der Debatte” angeprangert und man prangert permanent konkret Journalisten an. Es wird erklärt, dass die Journalisten - alle - eine Meute bilden, die sich im groupthink gegenseitig vergewissern und man vergewissert sich permanent in gegenseitiger Zustimmung, das man Recht habe, auch wenn das gar nicht sein kann, weil der eine Autor intellektuell faul und der andere ein anerkannter Wissenschaftler ist.Die Frage bleibt: musste man sich wegen dieses Buches so entblößt in eine Talkshow setzen und ich denke, wir haben sie beantworten können.Denn, wer aus Eitelkeit oder Sendungsbewusstsein behauptet, ein wissenschaftliches Werk zu veröffentlichen, welches bei näherer Betrachtung nur ein Vorwand ist, die zwei, drei talking points, die einen gerade beschäftigen, medienwirksam unter die Leute zu bringen und sich als Thema dieses "wissenschaftlichen Werkes” ausgerechnet den Medienbetrieb raussucht um dann zu 100% folgerichtig von den routinierten Samurais ebendieses Medienbetriebes zu Hasché verarbeitet zu werden, hat an sich nur zwei Betriebsmodi, mit denen er in eine wahrscheinlich lange zugesagte Promotalkshow wie die bei Lanz gehen kann. Man kann, wie Welzer, den gelassenen Wissenschaftler geben und milde lächelnd alle anderen für dumm erklären oder, weil man halt keiner ist, wie Precht, die Beine breit machen und mansplained dann den s**t aus dem eigenen Unsinn, worauf man beleidigt ist, wenn alle über einen lachen.Schade ist das vor allem, weil, selbst wenn man das Alter der Autoren hat, und offenbar nicht anders kann, als den deutschen Journalismus auf die Leitmedien zu verengen, es an diesem einiges zu analysieren gibt. Sein Aufstieg und Fall ist faszinierend und wenn man wirklich nicht mit neuen Medien kann, und hier sind nicht nur die “Direktmedien” gemeint, wie Welzer begriffsschafft, was wir Nichtelitären “social media” nennen, hat man locker ein gutes Buch drauf, wenn man wie Precht in diesen Leitmedien lebt und wie Welzer was Richtiges studiert hat. Aber nein, man weiß tief drin, dass es ein ernsthaftes Werk über ein begrenztes Thema fürs eigene Ego nicht mehr bringt, man will Aufmerksamkeit, tappt in die Projektionsfalle und postuliert: Alles Egozentriker außer ich, ich, ich!Und so sei abschließend die Frage erörtert, die jeder Rezension als Grundlage dienen sollte: für wen ist dieses Buch? Wer könnte sich dafür interessieren, wer wird Genuss beim Lesen empfinden, wer wird sagen “Toll argumentiert!", “Toll formuliert!”?Nun. Mir fallen eigentlich nur zwei Leserinnengruppen ein: die Fans von Richard David Precht und die Fans von Harald Welzer. Und seit dem schniedelschwingenden Auftritt der beiden Autoren in besagter ZDF TV-Show werden sich diese Gruppen wohl entleert haben, bis nur noch jeweils ein Mitglied übrig war und bei Harald Welzer bin ich mir da nicht so sicher. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Während Netflix am überlegen ist, wie man die Investoren (wieder) glücklich machen kann, muss sich Jamie Foxx als Vampirjäger Bud die Frage stellen, wie er schnell an Geld kommt. Die Lösung: Der Gewerkschaft der Vampirjäger beitreten und den Blutsaugern krankenversichert und mit einem Tarifvertrag im Rücken die Fangzähne ziehen. Blöd nur, dass die Bürokraten ihm ein angsthasiges Green Horn namens Seth (Dave Franco) an die Seite stellen. Der hindert Bud zwar nicht an seinem blutigen Tagewerk, sorgt aber bei unseren zwei Rezensenten und TS-Vampiren Timo und Stu durchaus dafür, dass "Day Shift" penetrant nach Knoblauch müffelt. Was an dem Action-Horror-Comedy-Mix aus der Schmiede der "John Wick"-Macher sonst noch komisch riecht und herrlich duftet, verraten sie euch in unserer Besprechung zur neusten Netflix-Eigenproduktion, die seit dem 12. August 2022 beim großen, roten N zu finden ist. Viel Spass mit der neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschlands einzigem Podcast, der nahezu alle Filmstarts der Woche mit einer eigenen Review versieht. Wir liefern euch launige und knackige Filmkritiken, Analysen und Talks über Kino- und Streamingfilme und -serien - immer aktuell, informativ und mit der nötigen Prise Humor. Viel Spaß mit unseren Besprechungen! Lockere Filmkritiken zum selbst mitmachen! Website | PayPal | BuyMeACoffee Großer Dank und Gruß für das Einsprechen unseres neuen Intros geht raus an Engelbert von Nordhausen - besser bekannt als die deutsche Synchronstimme Samuel L. Jackson! Thank you very much to BASTIAN HAMMER for the orchestral part of the intro! I used the following sounds of freesound.org: 16mm Film Reel by bone666138 wilhelm_scream.wav by Syna-Max backspin.wav by il112 Crowd in a bar (LCR).wav by Leandros.Ntounis Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen
Heute gehen wir mit der Berliner Börsen-Zeitung vom 16. Juli 1922 zu den Filmpremieren ins Kino. Ein Programm mit vier kürzeren Charlie-Chaplin Filmen regt den Rezensenten zu der zeitlosen Reflexion an, was Chaplins Komik so einzigartig macht. Ein weiterer Film mit besonderen lebendigen Schauwerten wird mit sog. Schwedenfilmen verglichen - nach dem kriegsbedingten Wareneinfuhrverbot kamen 1921/22 innerhalb kürzester Zeit 20 abendfüllende skandinavische Produktionen in die deutschen Kinos, die rasch als besonders künstlerisch und ästhetisch Wertvoll angesehen wurden, weshalb “Schwedenfilm” zu einem Qualitätslabel wurde. Und schließlich bespricht der Kritiker einen Film, der offensichtlich zu der „Stangenware“ der Zeit gehörte. Für uns war Frank Riede in den Filmpalästen.
Édouard Louis: Wer hat meinen Vater umgebracht
Ein schmaler Band, 77 Seiten, die es einem einfach machen: Die Gefahr der Todsünde des Rezensenten, den Autoren mit dem Ich-Erzähler zu verwechseln, ist schlicht nicht gegeben. “Wer hat meinen Vater umgebracht” ist ein autobiographisch-polemisch-politischer Text.Es wechseln literarische Beschreibungen von Kindheits- und Jugenderinnerungen mit soziologisch-philosophischen Einordnungen und Hinweisen. Diese sind das Gerüst des Autors für die Sinnwerdung der Vater-Sohn-Beziehung.Sein erstes Werk, mit dem Édouard Louis bekannt und erfolgreich wurde, war “ Das Ende von Eddy”, in welchem er autofiktional seine Kindheit beschrieb: aus ärmlichen und von der Abwesenheit des Vaters geprägten Verhältnissen, die wieder und wieder gewaltvoll Normen an Geschlechterverhältnisse durchsetzen. Während dieses Werk als persönliche Abrechnung gelesen und verstanden wurde, errichtet Édouard Louis nun mit dem Abstand einiger Jahre, mit Reflektion, die Verzeihen ermöglicht, einen Interpretationsrahmen. Dieser erlaubt Zugeständnisse an die eigentlich unverzeihlichen Handlungen seines Vaters und gibt die Verantwortung für diese jemand anderem, der - hier zunächst unpersönlich - Politik.Der Vater des Autors ist in eine arme Familie geboren und verliert durch seine Ausbeutung in unbarmherzigen Arbeitsverhältnissen nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Würde, kurz: sein Leben. Die Verhältnisse bringen ihn um. Und diese werden zunehmend schwerer, weil einst vorhandene Sicherungsnetze systematisch verbrannt werden: mit einer Arroganz, die nur besitzt, der nichts von Armut weiß, weil er sie nie erleben musste.Während die fortdauernde Wiederholung des Kreislaufes aus Armut, schlechter Bildung, fehlenden Aufstiegschancen, Alkohol benannt wird, findet Édouard Louis an einer Stelle einen bemerkenswerten Bruch seines Vaters mit einer der als sich unabdingbar gerierenden, zwangsläufig scheinenden wieder und immer wieder reproduzierten Erscheinung: der Gewalt. Zitat: “...du sagtest zu uns: Nie im Leben werde ich die Hand gegen eines meiner Kinder erheben. Gewalt produziert nicht nur Gewalt. Lange habe ich immer wieder gesagt, Gewalt bewirke Gewalt, aber da habe ich mich geirrt. Die Gewalt hat uns vor der Gewalt bewahrt.” Zitatende. Hier wird deutlich, dass es möglich ist, individuelle Entscheidungen zu treffen. In einem gegen sich gerichteten System dieses aufzubrechen, ist jedoch nahezu unmöglich.In den letzten Jahren ist die Diskussion um Klassen, deren Vorhandensein nach dem Kalten Krieg geradezu negiert wurde, erneut aufgeflammt und wird seitdem verstärkt nicht nur in wissenschaftlichen Diskursen, sondern auch literarisch behandelt. Klassismus, also die strukturelle Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder Position, findet sich in Berichten der UN, aber eben auch als Thema der Literatur. Édouard Louis nimmt hier ausdrücklich Bezug auf Didier Eribon und Annie Ernaux, deren Werke ebenfalls stark autobiografisch geprägt sind und die ihre Herkunft behandeln und - auch hierzulande interessant - eine Erklärung finden, warum die Armen rechts wählen.Gewisse Subjekte unseres Rezensentenkollektivs, namentlich Herr Falschgold, lesen vor und während ihrer Lektüre nicht die Rezensionen anderer und nehmen in Kauf, Verbindungen und Anspielungen zu verpassen.Mir hingegen ist das, zumindest nach der Lektüre und vor der Rezension ein großer Spaß, aber wen will ich hier eigentlich verarschen, meistens regt es mich sehr auf. “Wer hat meinen Vater umgebracht” KEIN Satzzeichen am Ende des Titels. Und so wird der Titel häufiger als Frage verstanden, weil die SatzSTELLUNG des Titels es vorgibt, obwohl die 77 Seiten schnell gelesen sind und ab S. 68* die Verantwortlichen für die Misere seines Vaters, die Édouard Louis’ ausgemacht hat, Absatz für Absatz genannt werden: diejenigen, die mit politischer Macht den Armen und Prekären mitgeteilt haben, dass sie selbst Schuld an ihrem Schicksal sind und sich einfach nur mehr anstrengen müssen.Die Frage, die mich während und nach der Lektüre umtrieb, ist die des Adressaten: Wer soll dieses Buch lesen? Wem wird es die Augen öffnen? Wird diese polemische Kampfschrift Einfluss haben, einen Platz finden, und wo?Édouard Louis beschreibt das Projekt der Austerität. Eine bessere findet sich in Karl Heinz Roths & Zissis Papadimitriou “Die Katastrophe verhindern - Manifest für ein egalitäres Europa”, dass allerdings ungleich theoretischer an diese Fragen herantritt. Und so vermutete ich zunächst, dass Édouard Louis mit seinem schmalen Band “Wer hat meinen Vater umgebracht” diesen und sein Umfeld, seine Freunde, die Verarmten erreichen möchte. Sicher war ich mir nicht, denn schon im 2. Absatz von Kapitel 1 werden Homophobie, Transphobie erwähnt, vielleicht also doch eher an die linken Intellektuellen gerichtet, sie aufrütteln, allein, das schien nicht richtig.Peinlich spät kommt mir der Gedanke, dass “Wer hat meinen Vater umgebracht” nicht nur ein Theatertext sein könnte, wie er im kursiv gestellten Vortext mitteilt. Zitat: “Wenn dies ein Theatertext wäre,” Zitatende. Es ist ein Stück, fürs Theater geschrieben. Vorangestellt ist eine genaue Beschreibung des Bühnenaufbaus, es beginnt ein Monolog, dem Vater wird explizit keine Stimme gegeben. Der aus der Armut entkommene gebildete Sohn spricht das gebildete Theaterpublikum an, dass von Armut nur gelesen hat. Sie versucht Édouard Louis zu überzeugen. Soziologen, Philosophen, Schriftsteller werden zitiert. Hier finden sich dann die Gebildeten wieder, können wissend nicken, “Ja, kenne ich, war im Feuilleton”, “Aha, ja”, vielleicht sind sie auch kurz überrascht, obwohl, etwas überraschend Neues findet sich nicht.Am Ende des schmalen Bandes kommt der Vater zu Wort und bestärkt den Sohn in seinen Überzeugungen. Eine kaputte Kindheit zerstört nicht diese Beziehung, die Verhältnisse sind es. Nun kann das Theaterpublikum nach Hause gehen, und beim nächsten Mal trotzdem die Immergleichen wählen, warum auch nicht, oder anders, wen denn sonst?Die vielen Zitate diverser Soziologen, Philosophen, Schriftsteller hatte ich bereits erwähnt. Einiges davon ist fragwürdig oder gleich kompletter Quatsch. Zitat: “Bei deinem Anblick wurde mir klar, dass Langeweile das Schlimmste ist, was einem passieren kann.” Zitatende. Édouard Louis’ Begründung dafür ist so hanebüchen, dass ich mich frage, ob der Übersetzer da beim Verlag rückgefragt hat, ob er das wirklich hinschreiben soll. Hier kommts: Langeweile ist das Schlimmste, weil, die gab es auch in den Konzentrationslagern. No Joke! Da werden Imre Kertész und Charlotte Delbo zitiert, die davon berichtet haben, dass es auch dort LANGEWEILE gab, und dann wird vom Autoren direkt übersehen, der es selbst hingeschrieben hat: Zitat: “ Hunger, Durst, Tod, Öfen, Gaskammern, Massenerschießungen und Hunde, die stets bereit waren, einem die Gliedmaßen zu zerfleischen…” Die Aufzählung geht noch weiter, aber klar, die Langeweile war das Schlimmste. Alter.Am Ende wie immer die Frage, ob die Lektüre empfohlen wird. Ihr erlebt mich etwas ratlos. Pro: Hinterher weiß man, warum Macrons Chancen bei der derzeitigen Wahl ziemlich mies sind, sollten die Wähler*innen angesichts von Trumps Erfolgen, Putins Einmischungen und dem Schrecken des Brexit nicht motiviert genug, statt faschistischer Scheiße nur Scheiße zu wählen. Dazu kommt, dass es ein schmaler Band ist.Contra: Annie Ernaux und Didier Eribon würde ich uneingeschränkt empfehlen. Fazit: Also, ich weiß es wirklich nicht.Es verabschiedet sich Irmgard Lumpini, den Link zum Buch findet Ihr auf unserer Website lobundverriss.substack.com. Nächste Woche wird es aufgrund des Feiertagsmarathons eine alte Diskussion geben, bevor die Bücher der letzten Wochen gemeinsam besprochen werden. Frohe Ostern!* Die Seitenzahl für diejenigen, die sich nur für die Auflösung interessieren.. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Sarah Bröder und Tanja Rieger zu Gast bei Manolito Röhr
Die Leseratten unter unseren Zuhörern werden mit dieser Episode unseres Podcasts ihre Freude haben. Denn es ist Krimizeit. Unter diesem Namen sind Sarah Bröder und Tanja Rieger im Netz zu finden und befassen sich mit der wunderbaren Welt des geschriebenen Wortes. Sie stellen Neuerscheinungen vor, rezensieren Bücher, Filme und Serien und berichten von ihren persönlichen Leseerfahrungen. Aber Tanja und ihre Nichte Sarah lesen nicht nur etliche Bücher, sondern sie arbeiten auch an ihrem ersten eigenen Debütroman. Wir sprechen über die Entstehung ihres Buches, aber auch über die Angst, wie so ein persönliches Projekt von anderen Leseratten bewertet werden könnte, wobei die beiden Frauen eigentlich auf der Seite der Rezensenten stehen. Dies und einiges mehr gibt es in knapp unter einer Stunde zu hören.
Folge 64: Die Flüsse von London von Ben Aaronovitch (Peter Grant #1)
Ich begrüße euch zu einer weiteren Buchbesprechung. Auf den ersten Blick scheint es hier keine besondere Neuheit zu geben. Die Frage ist: Was wäre, wenn es Magie wirklich gäbe, wenn sie von einem geheimen Club kontrolliert und dazu benutzt würde, die Öffentlichkeit vor bösartigen Geistern und übersinnlichen Feinden zu schützen? Aber Ben Aaronovitch bietet etwas Neues, indem er die Metropolitan Police in den Mittelpunkt seiner magischen Welt stellt. Und schon haben wir das Beste aus zwei Welten der Urban Fantasy. so nahe liegend, dass man glauben könnte, dass es diese Art der Literatur schon immer gab. Da mag man vor allem an die berühmten okkulten Detektive wie Hodgsons Carnacki, Blackwoods John Silence oder an LeFanus Dr. Hesselius denken, aber damit hat Peter Grant, der Held der Reihe, gar nichts zu tun (übrigens auch nicht mit Harry Potter, wie oberflächliche Rezensenten behaupten). Am ehesten ist noch die Thursday-Next-Reihe von Jasper Fforde mit Peter Grant verwandt, aber auch die verfolgt einen gänzlich anderen Ansatz. Wäre noch Harry Dresden, die Königsreihe der Urban Fantasy; das gilt aber nur, wenn man Kategorien unbedingt braucht. Und Scott Mebus mit seinen Gods of Manhattan könnte man ebenfalls noch ins Feld führen. Folge direkt herunterladen
Das Jahr neigt sich und wir tun es auch. Die Show #57 rieselt leise auf uns hernieder. Das ist schön, denn draußen rieselt ja noch nicht so viel. Wenig weihnachtlich starten wird deshalb mit einem weiteren Versuchs von Hasbro, seine G.I.-JOE-Marke in ein filmisches Universum zu wandeln. Mit SNAKE EYES startet man eine Origin-Story und Benedikt arbeitet sich an dem Thema ab. Nach dem Spielzeug kommt bei uns der vom Körper abgetrennte Grabscher. Max bespricht einen Sonderling seiner Jugend. Ob DIE KILLERHAND dabei an Federn lässt oder an der zeitlichen Distanz der letzten Ansicht gewinnt, erzählt er, bevor es dann doch etwas märchenhaft wird. Die weibliche Seite von Deep Red Radio erinnert sich zurück an HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Der Zauber, der daraus entstandenen Filmreihe nach den Büchern von J.K. Rowling, besteht bis heute. Ob die erste Verfilmung, neben einem monströsen Franchise, der Alkoholsucht Potters oder den gesellschaftlichen Statements der Autorin, noch kindliche Fantasien beflügeln kann, berichten Julia, Lisa und erstmals auch Maria. Bevor wir dann ein Ohr auf unsere fleißigen Audiokommentare in diesem Jahr werfen, zum reinen Selbstzweck, reist Benedikt zum Mond um Heinz Erhardt zu begegnen. Das Fernsehspiel DIE REISE ZUM MOND nach Motiven von Jules Verne von 1964 regte Interesse beim Rezensenten und dieser wurde belohnt mit… ihr werdet es hören. Abgeschlossen wird die Sendung mit einem flotten Polizeifilm. AUF LEISEN SOHLEN KOMMT DER TOD könnte vom Klang her ein Italowestern sein und der geistige Erschaffer dieses reißerischen Titels hat sicher den einen oder anderen Spaghetti für Deutschland getauft. In der Tat eröffnete sich Benedikt aber ein vielschichtiger und gleichsam kurzweiliger Besuch in einem Bostoner Polizeirevier der 70er Jahre. Klingel-lingel-ling. So isses. Kommt auf die andere Seite… von Silvester. Und zuvor verharrt in besinnlicher Völlerei. Singt mal ein Lied. Und falls es dann mal zu ruhig ist und Zeit wäre über das Leben nachzudenken und was man alles besser machen könnte in der Welt – dann schaltet DEEP RED RADIO ein. Ihr könnt es gebrauchen. Mazel tov.
Das Jahr neigt sich und wir tun es auch. Die Show #57 rieselt leise auf uns hernieder. Das ist schön, denn draußen rieselt ja noch nicht so viel. Wenig weihnachtlich starten wird deshalb mit einem weiteren Versuchs von Hasbro, seine G.I.-JOE-Marke in ein filmisches Universum zu wandeln. Mit SNAKE EYES startet man eine Origin-Story und Benedikt arbeitet sich an dem Thema ab. Nach dem Spielzeug kommt bei uns der vom Körper abgetrennte Grabscher. Max bespricht einen Sonderling seiner Jugend. Ob DIE KILLERHAND dabei an Federn lässt oder an der zeitlichen Distanz der letzten Ansicht gewinnt, erzählt er, bevor es dann doch etwas märchenhaft wird. Die weibliche Seite von Deep Red Radio erinnert sich zurück an HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Der Zauber, der daraus entstandenen Filmreihe nach den Büchern von J.K. Rowling, besteht bis heute. Ob die erste Verfilmung, neben einem monströsen Franchise, der Alkoholsucht Potters oder den gesellschaftlichen Statements der Autorin, noch kindliche Fantasien beflügeln kann, berichten Julia, Lisa und erstmals auch Maria. Bevor wir dann ein Ohr auf unsere fleißigen Audiokommentare in diesem Jahr werfen, zum reinen Selbstzweck, reist Benedikt zum Mond um Heinz Erhardt zu begegnen. Das Fernsehspiel DIE REISE ZUM MOND nach Motiven von Jules Verne von 1964 regte Interesse beim Rezensenten und dieser wurde belohnt mit… ihr werdet es hören. Abgeschlossen wird die Sendung mit einem flotten Polizeifilm. AUF LEISEN SOHLEN KOMMT DER TOD könnte vom Klang her ein Italowestern sein und der geistige Erschaffer dieses reißerischen Titels hat sicher den einen oder anderen Spaghetti für Deutschland getauft. In der Tat eröffnete sich Benedikt aber ein vielschichtiger und gleichsam kurzweiliger Besuch in einem Bostoner Polizeirevier der 70er Jahre. Klingel-lingel-ling. So isses. Kommt auf die andere Seite… von Silvester. Und zuvor verharrt in besinnlicher Völlerei. Singt mal ein Lied. Und falls es dann mal zu ruhig ist und Zeit wäre über das Leben nachzudenken und was man alles besser machen könnte in der Welt – dann schaltet DEEP RED RADIO ein. Ihr könnt es gebrauchen. Mazel tov.
In diesem JediCast dreht sich alles um den sogenannten Krieg der Kopfgeldjäger, oder auch War of the Bounty Hunters, welcher als erstes großes Marvel-Star Wars-Crossover von Mai bis November 2021 erschienen ist und sich rund um die Frage dreht, welche Zwischenstopps Han Solo im Karbonitblock machte, bevor er als Wanddekoration in Jabbas Palast endete und welche Rolle die Organisation Crimson Dawn bei all dem spielt. Mit dabei sind heute neben Florian und Lukas auch unserer Marvel-Mittwoch und IDW Adventures-Rezensent Matthias, der mit Doctor Aphra, Bounty Hunters und einigen One Shots einen großen Teil des Events im Marvel-Mittwoch rezensiert hat. Ob und wie uns die Reihe samt One-Shots, Miniserie und thematisch abgestimmter Ausgaben der fortlaufenden Reihen gefallen hat, soll im Zentrum dieser Folge stehen. Wieso dabei manchmal zu sehr in die Wiederholungskiste gegriffen wurde und was wir sonst noch verbessern würden, teilen wir natürlich wie immer in unserer unendlichen Weisheit mit, während wir versuchen den Überblick über ein wirklich komplexes System an Ausgaben und Handlungssträngen zu behalten. Genau deshalb empfehlen wir auch den spoilerfreien Teil für alle, die einen Zugang zum Event suchen, denn dort erfahrt ihr auch, was man unbedingt gelesen haben muss und was man zunächst auslassen kann. Hinweis: In den Kommentaren zu dieser Ausgabe darf nach Belieben gespoilert werden, damit ihr euch mit uns austauschen und eure Meinung zum Roman kundtun könnt. Also achtet bitte darauf, sofern ihr den Roman noch nicht beendet habt! Zeitmarken spoilerfreier Teil00:00:00 - Begrüßung00:01:35 - Erwartungen nach Ankündigung00:06:40 - Was muss man alles lesen? Was kann man auslassen?Spoilerteil00:12:54 - New Kids on the Block00:19:33 - Kopfgeld auf den Kopfgeldjäger 00:27:56 - Block Party 00:39:18 - Father and Son (on Repeat) 00:47:36 - Das bessere Ende des Events 00:50:22 - Florians TED-Talk00:57:04 - Do not throw away your (One-)Shot!01:10:47 - Lieblingsheft/Panel 01:22:04 - Fazit01:28:39 - Je ein Wunsch für Crimson Reign Blick in die Datenbank Im Folgenden werden die Werke als ganze Handlungsstränge verlinkt. Für eine chronologische Reihenfolge siehe die Timeline oder die Reihenfolge der Erscheinung in der Datenbank. Wie immer sind in der Blog-Version dieses Posts die Werke auch unter dem Beitrag verlinkt. Zur Werksübersicht der:Vorgeschichte: "Wertvolle Fracht" War of the Bounty Hunters/Krieg der Kopfgeldjäger-Minireihe Star Wars-Hauptreihe zum Event Bounty Hunters-Reihe zum Event Doctor Aphra-Reihe zum EventDarth Vader-Reihe zum Event One-Shots zu Jabba, 4-LOM & Zuckuss, Boushh und IG-88 Die Rezensionen Wie alle Marvel-Comics wurden diese wöchentlich im Rahmen unseres Marvel-Mittwochs rezensiert. Eine Übersicht dieser könnt ihr hier über unsere Datenbank-Filter finden. Rezensenten des Crossovers war neben den im JediCast vertretenen noch Maximilian, welcher die Star Wars-Hauptreihe betreute. Den JediCast abonnieren Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten! Abonniert uns also gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts (etc.), oder fügt bequem unsere Feeds in euren präferierten Podcast-Player wie Podcast Addict ein. Alle Links dazu findet ihr oben unter dem Player. Sollte eurer Meinung nach noch ein wichtiger Anbieter fehlen, teilt uns das gerne in den Kommentaren oder per Mail an podcast@jedi-bibliothek.de mit! Erinnerung: In den Kommentaren zu dieser Ausgabe darf nach Belieben gespoilert werden!
Martha Wells: Die Killerbot-Reihe
Zu Zeiten des seligen Gene Roddenberry ist die Zukunft noch rosig. Im Star Trek Universum herrscht, wenn nicht Kommunismus, so doch wenigstens ein demokratischer Sozialismus mit militaristischem Anstrich. Spätestens jedoch mit Neal Stephensons "Snow Crash" und William Gibsons "Neuromancer" Serie bekommt die Zukunft, was sie verdient: Kapitalismus im endlosen Endstadium. Staaten sind Firmen gewichen, Staatenbünde Monopolen. Doktorarbeiten wurden darüber geschrieben, dass Science Fiction nur eine logische Fortsetzung der gesellschaftlichen Zustände ist, in denen sie geschrieben wird, es gibt also keinen Grund sich zu wundern, dass in Martha Wells "Murderbot Diaries", auf Deutsch "Tagebuch eines Killerbots", interstellarer Imperialismus herrscht, auf die brutalstmögliche Art verquickt mit und unterstützt von kapitalistischer Über-den-Tisch-Zieherei. Eine Ära, die an die aktuellen Zustände als die "guten alten Zeiten" zurückdenkt.Wir befinden uns in recht weiter Zukunft und der Weltraum will erobert sein. Also machen sich Forscher und Firmen auf den Weg, in den Raum hinter dem "corporate rim", dem dicht besiedelten "bekannten" Ring von Galaxien und Planetensystemen. Dass das ein gefährlicher Job ist, versteht sich; nur weil Kapitalismus herrscht, ist die Alienflora und -fauna nicht ungefährlicher als im Universum von Captain James T. Kirk und Jean Luc Picard. Aber kein Problem, aus dem sich nicht Profit schlagen ließe, und so bieten intergalaktische Konglomerate von Sicherheitsfirmen Bonds, also Versicherungsverträge, an, die Du dir als hoffnungsvoller Entdecker neuer Welten zulegen kannst. Beziehungsweise musst, denn: "Ein schönes Raumschiff haben Sie da, es wäre doch eine Schande, wenn dem was passiert?", Sie wissen schon. Man bezahlt also eine Summe X, je nach Gefährlichkeit der Mission und Bonität des Entdeckers, dafür rüstet die Sicherheitsbude die Mission so aus, dass die Chancen gut sind, dass wenigstens ein paar Explorer heil zurück kommen. Falls nicht, wird eine erkleckliche Versicherungssumme an die Hinterbliebenen gezahlt. Beziehungsweise deren Arbeitgeber. Falls nichts Gegenteiliges im Kleingedruckten steht.Die Sicherheitsfirmen haben also ein Interesse, dass möglichst wenige Mandanten von Erdwürmern, fleischfressenden Kakteen oder Weltraumpiraten konsumiert werden und rüsten entsprechend technologisch auf: schnelle Raumschiffe, sicher Habitatsystem und ordentlich Waffentechnologie. Die am weitesten entwickelte und versatilste ist der gemeine Security Bot, ein bisschen Menschenhirn mit sehr, sehr viel Technologie und nur noch wenig Fleisch und Blut drum rum, dazu überall Waffen eingebaut und das Äquivalent eines mittleren Amazon-Rechenzentrums in der Birne. Sieht aus wie Arnold, wird aber gesteuert von einem “gouverneur module” unter der Kontrolle der Sicherheitsfirma, dem der security bot gehört. In der deutschen Ausgabe wird das "Chefmodul" genannt. Was läuft bei deutschen Übersetzern schief, fragt man sich.Unser Hauptheld, der sich selbst "Murderbot" nennt, ist ein solcher Security-Roboter mit dem klitzekleinen Unterschied, dass er sein Chefmodul, Jesus... - nennen wir es "Wächtermodul" gehackt und ausgeschaltet hat. Das Modul dient offiziell dazu, dass der Bot keinen Mist macht, also z.B. die zu beschützenden Kunden umnietet, vor allem aber nimmt es dem Bot den, dank eingebautem Menschenhirn unvermeidlichen, aber in der kapitalistischen Verwertungslogik extrem unpraktischen, freien Willen. Denn wer braucht schon einen security bot, der hinterfragt, warum er neben dem Beschützen des Kunden jedes Wort, dass diese sprechen, jede Entdeckung, die sie machen aufzeichnet und zum Wohle des Securityunternehmens nach monetär Verwertbarem durchsucht. Jetzt also ohne ein steuerndes Modul macht unser security bot in der freien Zeit, die er hat, was man als Mensch so macht, wenn man freie Zeit hat: er guckt Netflix. Und jeder, der schon einmal Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen in einem Museum oder Supermarkt beobachtet hat, weiß, freie Zeit hat man da zu nahe 100%. Also ist er bei Folge 304 von "Vom Aufstieg und Fall des heiligen Mondes" (wir breiten das Tuch des Schweigen über die deutsche Übersetzung) und mit der Serie Worldhoppers ist er auch schon durch.Das alles schaut er in jeder freien Minute, während er im Hauptjob dafür sorgt, dass seine Mandanten, ein Forschungsteam der nicht-kommerziellen "preservation alliance" nicht von Erdwürmern gefressen werden. Das gelingt ihm bei der Expedition, mit der wir in die Serie einsteigen, nur geradeso, dennoch sind die Kunden endlos dankbar und laden ihn ein, statt im Kofferraum des Raumgleiters, vorn, bei den Passagieren, zurück zur Basis zu fliegen. Vielleicht haben sie nur Angst, auf alle Fälle ist das extrem ungewöhnlich und vor allem unpraktisch, denn Murderbot mit freiem Willen muss diesen ohne spielen. Wenn sein Arbeitgeber mitbekommt, dass er ohne Wächtermodul rum rennt, würde er umgehend abgeschaltet und recycelt.Normalerweise hat Murderbot im Einsatz einen Helm mit undurchsichtigem Visier auf, aber ausgerechnet als er sich in der Umkleide des Raumgleiters seiner alienbesudelten Klamotten entledigt, wird er zur Chefin der Expedition gebeten, damit diese sich für die Lebensrettung bedanken kann. Was an sich schon unerhört ist, denn a) hat er nur seinen Job gemacht, und b) werden murderbots im allgemeinen behandelt wie Werkzeuge, was ihm durchaus recht ist, zumal seit er sein Wächtermodul ausgeschaltet hat und Murderbot einfach nur in Ruhe Netflix gucken will. (Netflix heißt im Buch natürlich neutral "Media", aber wir wissen was gemeint ist). Also steht Murderbot vor Dr. Mensah, der Expeditionsleiterin, und starrt an ihr vorbei an die Wand. Er schaut sich und seinen Gegenübern prinzipiell lieber über die Security-Kameras zu, in Menschenaugen schauen ist extrem irritierend. Und wieso sind hier alle dankbar? Für genau den Fall, dass in einer Sickergrube zähnefletschende Erdwürmer Hunger haben, ist er doch hier. Aber ein "Dankeschön" tut irgendwie gut. Als die Lebensgerettete ihn gar umarmen möchte, wird ihm die ganze Rührseligkeit jedoch zu viel. "I had an emotion, and I hate having an emotion." wie murderbot solche Augenblicke beschreibt und stellt sich in eine Ecke des Raumes mit dem Gesicht zur Wand. Hier verlassen wir die Story weitestgehend, sie ist interessant, genügend innovativ und fesselnd. Martha Wells spannt in den fünf entstanden Bänden, im deutschen aktuell in zwei Büchern zusammengefasst, einen Bogen auf, der die Serie noch eine Weile tragen wird. Darunter jedoch, und das macht den Reiz der Serie aus, geht es, wie immer in guter utopischer Literatur, um die ganz großen Fragen. Science Fiction trägt das Abhandeln von wissenschaftlichen Themen ja schon in der Genrebezeichnung, üblicherweise spricht das vor allem Leserinnen an, die STEM-affin sind, wie man heute sagt, also science, technology, engineering and mathematics brauchen um einzuschlafen. Martha Wells lässt diese auch nicht im Regen stehen, es knallt und warped und hacked was das Zeug hält. Aber sie behandelt auch die despektierlich "weiche Wissenschaften", "soft science", genannten Fachgebiete und die sind, so ehrlich muss man sein, für Belletristik auch besser geeignet, hier: Psychologie, Philosophie und Soziologie.Beginnen wir mit einem Besuch beim Therapeuten: wir merkten ja schon in der eingangs beschriebenen Szene, dass Murderbot nicht wirklich mit seiner neuen, freien Welt klar kommt. Das beginnt damit, dass er sich trotz ordentlich Rechenleistung und guten Wörterbüchern sprachlich nicht in ihr zurecht findet. Auf Effizienz programmiert, denkt und redet er wie ein Handbuch für einen HP Laserjet, nur dass er nicht beschreibt, wie man einen Papierstau entfernt sondern, wie man gegen drei feindliche Militärroboter mit dem Leben davon kommt. Wobei ihm seine Programmierung gar nicht hilft ist, wie man mit jemandem umgeht, der ihm nicht sagt, was er machen soll und ihn nicht wie ein Möbel behandelt. Das muss er erst lernen und wir merken bald, dass er seine moralische "Erziehung" von seinem Medienkonsum bekommt, mit den erwartbaren, aber durchaus nicht nur negativen, Konsequenzen.Damit ist Murderbot natürlich und erwartbar zumindest im Autismus-Spektrum diagnostizierbar. Das ist ja heutzutage jeder und auch dem Rezensenten wurde das schon vorgeworfen, meist in Situationen, wenn man unangemeldeten Besuchern nicht sofort ein komplettes Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen anbietet, weil man gerade auf dem Hometrainer sitzt, eine klare Fehldiagnose also. Murderbot aber zeigt offensichtlich alle Anzeichen und das ist von Martha Wells bezweckt. Das Genre selbst und die für scifi-fremde Leser manchmal zu technischen Beschreibungen in der Killerbot-Serie sprechen, so kann man vermuten, keine kleine Anzahl von Bewohnern des Asperger- und Austismusspektrum als Leser an und diese wiederum identifizieren sich natürlich gerne mit einem Protagonisten, der sich nicht als Kind, sondern als voll entwickeltes Individuum mit der Situation auseinandersetzen muss und kann. Das ist subtile Lebenshilfe und nicht nur für Betroffene sondern auch deren Gegenüber. Wirklich toll!Philosophisch gibt es kaum eine größere Frage als "Was soll das alles?", eine Frage, die sich Murderbot mit aktivem, den freien Willen ausschaltendem Wächermodul nie stellen musste, welche aber ohne dieses auf einmal allgegenwärtig ist. Hier wendet sich Martha Wells an eine breitere Schicht von Lesern: wer hat sich nicht schon die "Worum geht's hier eigentlich?"-Frage gestellt, früh um zwei in der Bar. Die Antworten findet Murderbot in seinen Lieblingsserien, was nicht die dümmste Quelle sein muss, er sieht Serien über Hilfsbereitschaft und Mitgefühl, was ihn als ehemaligen Mitarbeiter eines Serviceunternehmens anspricht. Einzig, dass er jetzt selbst entscheiden muss, wen er killt - und warum - macht ihm heftig zu schaffen. Dort helfen historische Serien: die Fehler der Geschichte zu kennen, hilft diese zu vermeiden. Und wenn er gar nicht weiß wohin im Universum, gibt es immer noch Serien, in denen der Weltraum erforscht wird, mit den größten Abenteuern, die man sich vorstellen kann. Wir lernen jedoch bald, was am meisten in Murderbot bohrt: es ist die fragmentarische Erinnerung an ein Massaker, von ihm selbst verübt, von seinem "Arbeitgeber" unvollständig gelöscht. Er hat sich seinen Namen ja nicht umsonst gegeben. Mit dem neu gewonnenen Gewissen lässt ihm das keine Ruhe, jedoch wird er moralische Hilfe bekommen von seinen letzten "richtigen" Kunden, die mit den Erdwürmen, mit Dr. Mensah an der Spitze der "preservation alliance", gewissermaßen eine community von Hippies inmitten einer hyperkapitalistischen Gesellschaft. Es wird der Punkt kommen, der Sache auf den Grund zu gehen. Murderbot will wissen, warum er ein murderbot ist. Keine Angst vor Spoilern, aber die Antwort wird eine sein, die man gerne von Massakristen aller Art hört, hier aber stimmt: die Gesellschaft ist schuld. Womit wir zur Soziologie kommen. Martha Wells beschreibt im setting der gesamten Serie eine logische Fortsetzung der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, ein Kapitalismus, der nur noch für sich selbst existiert, mit Vertragsverhandlungen, bei der jeder Preis sich danach richtet, wie viel man aus Dir rausholen kann ohne dich umzubringen, mit Vertragspraktiken klar erkennbar angelehnt an die Versicherungsverträge der amerikanischen Krankenversicherungsmafia, wo Du erst im Versicherungsfall erfährst, wofür Du alles nicht versichert bist. In einer solchen Gesellschaft kann es normal bis notwendig sein, ein paar dutzend Zivilisten abknallen zu lassen von einer Maschine, der man vorher das Gewissen entfernt hat. Warum genau, werden wir erfahren. Es wird eine Parabel sein auf die Welt, in der wir leben und was aus ihr werden kann, wenn wir nicht aufpassen.Das alles passiert, keine Angst, sublim und unterhaltsam. Alle Bände bauen aufeinander auf wie Folgen einer Netflixserie. Wir ahnen noch einen großen Bang in der Zukunft: es gibt eine allgegenwärtige Alientechnologie, die wir erst im letzten Band näher kennenlernen und die spannende Fortsetzungen verspricht. Das Englisch des Originals ist lesbar, im Stil manchmal seltsam deutsch, was daher rührt, dass Murderbot in der Ich-Perspektive Dinge kompliziert umschreibt, die eigentlich ganz einfach sind. Liebe zum Beispiel, die sich zwischen genitallosen Robotern und, no s**t, noch viel genitalloseren Bordcomputern von Raumschiffen natürlich nicht mit "Schnickschnack, sie wissen schon" beschreiben lässt sondern ein wenig mehr Exploration erfordert. Ein bisschen deutsch halt. Die deutsche Übersetzung hingegen ist leider lieblos, warum zum Beispiel, bitte, wird der im Englischen völlig normale Begriff "Clients" im Deutschen immer mit dem eher ungebräuchlichen "Klienten" übersetzt, wo es doch simple "Kunden" oder "Mandanten" sind und das die Beziehung eines mordenden Serviceangestellten zu diesen haargenau beschreibt? Ist das Faulheit oder am Ende auch nur dem Druck des Marktes, hier des Übersetzermarktes, geschuldet, der Übersetzer am Rand des Existenzminimums hält? Haben wir in Deutschland, um genau das zu Verhindern, nicht eine Buchpreisbindung? Aber auch weil der englische Text von Technologismen nur so wimmelt, sich jeder zweite Absatz mit Firewalls, Feeds und Killware beschäftigt und das im Deutschen dann immer klingt wie ein IBM Benutzerhandbuch aus dem Jahr 1986, bringt der Konsum des Buches in englischer Sprache deutlich mehr Vergnügen.Eine Verfilmung des Materials liegt auf der Hand und der drunterlaufernde Handlungsstrang von Netflixserien biedert sich schon fast an, sie könnte aber auch schwierig werden. Die vielen technologischen Möglichkeiten, die Murderbot zur Verfügung hat um aussichtslose Actionszenen zu gewinnen, sind schon in Schriftform herausfordernd. Murderbot geht keinen Meter ohne zwanzig Drohnen um ihn herum, die ihm mit ihren Video- und Datenfeeds helfen, schneller als jeder Mensch, hochkomplexe Analysen zu erstellen und anhand derer zu handeln. Genau das wird im Buch auch beschrieben, es wimmelt nur so von Sätzen über die Veränderungen der Wahrscheinlichkeit von 85% auf 89% für Vorgehen A versus Vorgehen B und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, fetzt das seltsam und man sieht die Welt schnell mit den Augen eines murderbot. Wenn sich Murderbot aber in einer der Episoden klont, um als reine Software, gewissermaßen als Computervirus, die Kontrolle über eine Raumstation zu bekommen, wird es selbst lesend verdammt kompliziert, verlässt einen zuweilen das Vorstellungsvermögen. Bei einer potentiellen filmischen Umsetzung denke ich dabei in der Darstellung an 90er Jahre Klassiker wie "Johnny Mnemonic" und "The Lawnmowerman" und diese Ästhetik ist nicht das einzige aus den Neunzigern, was wir alle nie mehr sehen wollen. Aber vielleicht hat ja jemand eine brillante Idee.Bis dahin bleibt die Empfehlung eines Lesevergnügens und immenser intellektueller Stimulierung in Form der englischsprachigen "Murderbot Series" von Martha Wells und, wenn es sein muss, mit sprachlich leicht eingeschränktem Vergnügen, in der deutschen Übersetzung als "Tagebuch eines Killerbots" und "Der Netzwerk Effekt".In der nächsten Woche bespricht Anne Findeisen von Harper Lee „Gehe hin, stelle einen Wächter“, den die Autorin bereits vor ihrem Weltbestseller „Wer die Nachtigall stört“ schrieb und der lange als verschollen galt. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Die Diskussion - Wesjohann, Rijneveld, Blau
Wie jetzt jede 4. Episode von Lob und Verriss diskutieren wir die besprochenen Bücher nachdem alle die Zeit gehabt haben, in die Werke der jeweils anderen Rezensenten reinzulesen. Diesmal geht es also um Achim Wesjohanns “Freiheit statt Liberalismus”, Marieke Lucas Rijnevelds "Was man sät" und um Jessica Anya Blaus Roman “Mary Jane”In der nächsten Episode fühlt sich Herr Falschgold einem mordendem Roboter sehr verbunden. Er bespricht “Tagebuch eines Killerbots” von Martha Wells. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Sind Rezensenten zu kritisch? Wir quatschen mit Gela aus unserem Discord über dieses spannende Thema. Arne schwärmt noch über Faiyum und über seinen Podcast.
MonkeyTalk Podcast #6 - Fluch oder Segen? Mein Leben als Rezensent. Mit Roy, Andreas und Alexej
In dieser Folge reden wir über das Dasein als Rezensenten und die damit verbundenen Pflichten und Vorteile. Viel Spaß!Rezensionen, News und noch vieles mehr findet ihr auf unserer Seite: https://www.boardgamemonkeys.comFolgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen: https://www.facebook.com/realBoardgameMonkeys https://www.instagram.com/boardgamemonkeys https://twitter.com/BoardgameMonkey Support the show (https://www.patreon.com/BoardgameMonkeys?fan_landing=true)
Mit THE BABYSITTER: KILLER QUEEN setzt Regisseur McG seinen schrägen, von Zuschauern wie Rezensenten nur wenig wohlwollend aufgenommenen Netflix-Erfolg fort. Ob das Sequel der Horrorkomödie McGs ersten Mix aus Gewalt und Witz adäquat fortführt, verrät Antje Wessels euch in ihrer Kritik.
Sachkundig und anschaulich stellen die Rezensenten von WDR 3 Neuerscheinungen vor - die großen Titel ebenso wie den Geheimtipp. Und helfen zu entscheiden, was zu lesen sich lohnt.
Nr.58: With great power comes great responsibility – Von Brettspiel-Bloggern, Influenzern und Rezensenten, ihrer Kompetenz und ihrer Verantwortung (mit Sven Siemen)
Sven Siemen, die Pina Bausch der deutschen Brettspielblogger, hat in seinem Vlog Brettballett die Frage nach dem Expertentum bei Bloggern und Influencern aufgeworfen, was zu ein wenig Aufruhr gesorgt hat. Das Thema wollten wir nun auch mal angehen und daher haben wir uns einfach mal den Sven eingeladen. Wie nun die finale Antwort auf die … Weiterlesen Nr.58: With great power comes great responsibility – Von Brettspiel-Bloggern, Influenzern und Rezensenten, ihrer Kompetenz und ihrer Verantwortung (mit Sven Siemen) →
Nr.52: Fünf Jahre sind eine Ewigkeit – Spiele 2014 und 2015
Da denkt man manchmal, dass es bestimmte Spiele schon seit gefühlt immer schon geben würde, dabei sind sie erst seit fünf oder sechs Jahren auf dem Markt. Ein Effekt der gerade bei Rezensenten grassierenden Cult-of-the-New-Denkweise, der auch wir uns nicht verschließen können. Deswegen gibt es einige Überraschungen im dritten Teil unserer Jahrzehnts-Rückschau. An Medien gibt … Weiterlesen Nr.52: Fünf Jahre sind eine Ewigkeit – Spiele 2014 und 2015 →
Das wird im Buch erklärt – Die ersten fünf Folgen “Star Trek: Picard”
Der Podcast ist endlich im ausklingenden 24. Jahrhundert angekommen! die drei Rezensenten des TrekZone Networks diskutieren nach fünf Folgen enttäuschte und erfüllte Erwartungen der neuen Serie rund um Jean-Luc Picard und wagen sich an ein paar wilde Theorien über den Fortgang. Stetiger Begleiter der Diskussion ist der Prequel-Roman "Die letzte und einzige Hofnung", ohne den so Manches nicht plausibel scheint.
Das wird im Buch erklärt - Die ersten fünf Folgen "Star Trek: Picard"
Der Podcast ist endlich im ausklingenden 24. Jahrhundert angekommen! die drei Rezensenten des TrekZone Networks diskutieren nach fünf Folgen enttäuschte und erfüllte Erwartungen der neuen Serie rund um Jean-Luc Picard und wagen sich an ein paar wilde Theorien über den Fortgang. Stetiger Begleiter der Diskussion ist der Prequel-Roman "Die letzte und einzige Hofnung", ohne den so Manches nicht plausibel scheint.
Wie Du Dir erfolgreich gute Gewohnheiten zulegst
Ich freue mich sehr, dass Du dabei bist! Passend zum Jahresbeginn möchte ich heute mit Dir über Gewohnheiten sprechen. Jetzt haben die meisten von uns viele Pläne und gute Vorsätze fürs Neue Jahr geschmiedet. Aber wir kennen das alle: im Januar sind wir noch total motiviert und spätestens im Februar fallen wir wieder zurück in alte Gewohnheiten, in den alten Trott. Wie kannst Du das vermeiden? Wenn Du ein paar Gesetzmäßigkeiten der Neurowissenschaft verstehst, dann wird es Dir spielend leicht fallen, alte Gewohnheiten ab- und Dir neue zuzulegen. Und Gewohnheiten sind es letztlich, die uns helfen, um einen Weg erfolgreich gehen zu können. In dieser Episode erfährst Du warum Dein Gehirn Dich beim Lernen neuer Gewohnheiten ständig sabotiert wie Du Deine Schaltzentrale überlisten kannst, um Dir erfolgreich neue Gewohnheiten zuzulegen was ein Konservenglas mit Dopamin zu tun hat und welche 5 Methoden Dir helfen, um garantiert und erfolgreich neue Gewohnheiten zu erlernen In dieser Episode erwähne ich zudem das Buch von Mel Robbins, "Die 5 Sekunden Regel" oder "5- Second Rule". Diese Buch kann ich Dir unbedingt empfehlen, wenn Du ab und zu einen kleinen Motivationsschub brauchst. Erhältlich ist es überall, wo es Bücher gibt. Ich bin sehr gespannt, wie Dir die Episode gefällt und ob Du die ein oder andere Methode bereits für Dich anwenden konntest. Schreibe mir Deine Kommentare gerne auf Instagram auf @dr.med.dorothea.leinung oder auf meinem Blog auf www.dorothealeinung.com. Ich freue mich reisig auf jeden einzelnen Kommentar von Euch! Bewerte den Podcast auch sehr gerne auf Itunes. Laß ein paar Sterne und eine kleine Rezension da, damit machst Du mir eine große Freude! Unter allen Rezensenten verlose ich einmal im Monat ein 60 minütiges 1:1 Coaching mit mir. Also: mach mit! Vielleicht sprechen wir uns dann bald persönlich! Das würde mich sehr freuen! Bis bald! Deine Dorothea PS: Du bist göttlich!
Rezensionen: Gerhard Luhofer: Mascha Kaléko “Liebst du mich eigentlich?” (Briefe)
Mascha Kaléko (1907 – 1975) fand in den Zwanzigerjahren in Berlin Anschluss an die intellektuellen Kreise des Romanischen Cafés. Zunächst veröffentlichte sie Gedichte in Zeitungen, bevor sie 1933 mit dem ›Lyrischen Stenogrammheft‹ ihren ersten großen Erfolg feiern konnte. 1938 emigrierte sie in die USA, 1959 siedelte sie von dort nach Israel über. Mascha Kaléko zählt neben Sarah Kirsch, Hilde Domin, Marie Luise Kaschnitz, Nelly Sachs und Else Lasker- Schüler zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie können die Rezension nachlesen auf dem Blog des Rezensenten: radiergummi.wordpress.com.
Wie Du Deine Kreativität für Dich nutzen kannst, um Dein volles Potential zu entfalten
Hallo und schön, dass Du da bist! Heute erwartet Dich eine ganz besondere Folge. Es geht heute um das wundervolle Feld der Kreativität. Ich spreche darüber, dass es die Kreativität ist, die die Menschheit überhaupt erst so weit gebracht hat. Außerdem erfährst Du, wie Du herausfindest, welcher Kreativitätstyp Du bist wie Du kreative Techniken für Deine seelische und körperliche Gesundheit nutzen kannst wie Du durch Kreativität Burn-out und Bore-out verhinderst und wie Du Dein volles Potential entfalten kannst, wenn Du Dir erlaubst, deine Kreativität voll auszuleben Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit dieser Episode und hoffe, dass sie Dir viel Inspiration bietet! Danke fürs Zuhören! Schreib mir gerne in die Kommentare, wie Dir diese Episode gefallen hat und was Du für Dich mitnehmen konntest. Auch freue ich mich, wenn Du diesen Podcast bewertest und mir eine kleine Rezension da läßt. Unter allen Rezensenten verlose ich einmal im Monat ein 1:1 Coaching mit mir plus Persönlichkeitspotenzialanalyse. Die Gewinner gebe ich immer am ersten Mittwoch des Monats hier auf Instagram bekannt. Also, ich freu mich, wenn Du dabei bist und wir uns vielleicht demnächst persönlich sprechen können. Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Zeit, hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer Du grad bist und bis zum nächsten Mal! Deine Dorothea PS: Du bist göttlich! Mehr zu Dorothea Leinung: Website: www.dorothealeinung.com Youtubekanal: Mehrarztfürdich Instagram: @dr.med.dorothea.leinung
Selbstheilungskräfte aktivieren - Interview mit Christiane Nitschke Teil I
Ich begrüße Dich sehr herzlich zum ersten Teil meines Interviews mit der wunderbaren Christiane Nitschke und freue mich sehr, dass Du dabei bist! Dieses Gespräch hat mich persönlich tief berührt, da uns Christiane einen sehr offenherzigen Einblick in ihr Leben gewährt. In dieser Episode nimmt sie uns mit auf die Reise in ihre Vergangenheit und gewährt uns tiefe Einblicke in ihr Leben, ihre Erfahrungen, Traumata und seelischen Verletzungen. Sie berichtet uns von ihren schweren körperlichen Erkrankungen, angefangen bei ihrem Reizdarmsyndrom, den schweren Koliken, die sie lange gequält haben, dem Ausfall ihrer Bauchspeicheldrüse, ihrer Darmentzündung, bis hin zum Rheuma und der Fibromyalgie. Lange Zeit hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht, dass ihre Erkrankungen vielleicht etwas mit ihrer Psyche zu tun haben könnten. Erst durch die Fehlgeburt, die sie erleidet, wird sie schließlich dazu gezwungen, eine Pause einzulegen und auf ihr Leben zu schauen. Nach vielen Jahren schwerer körperlicher Beschwerden und der Einnahme starker Medikamente beschließt Christiane dadurch schließlich, alternative Wege der Heilung zu beschreiten, weil sie feststellt, dass die Schulmedizin allein ihr nicht wirklich helfen kann. Glücklicherweise hat sie in ihrem Rheumatologen einen verständnisvollen und aufgeschlossenen Arzt, der sie auf ihrem Weg unterstützt. Mit Hilfe von Meditation, Klangtherapie, Familienaufstellung und Tiefenpsychologie deckt sie nach und nach die schweren Bürden auf, die ihre Seele mit sich herumschleppt und begreift, wie diese Verletzungen ihren Ausdruck in den Beschwerden ihres Körpers gefunden haben. Nach und nach „räumt sie ihre Schubladen“ auf – wie sie es nennt. Und mit jeder gewonnenen Ordnung, jedem abgeworfenen Ballast kommt sie Stück für Stück ihrer Heilung näher. Heute ist Christiane nahezu frei von Medikamenten und hinsichtlich ihrer körperlichen Symptome auf einem ganz anderen und viel besseren Level als vor ihrer Reise. In dieser Episode erfährst Du wie seelische Verwundungen zu Krankheiten führen können, warum viele Menschen es nicht wagen, sich auf die Suche nach den tieferen Ursachen ihrer Krankheiten zu machen, warum ein starker familiärer und/oder partnerschaftlicher Rückhalt so wichtig für den Heilungsprozeß ist, wie wichtig es ist, in den Schmerz hineinzugehen und diesen anzunehmen, wie es Dir gelingen kann, alte Muster zu durchbrechen und wie Dir Spiritualität helfen kann, körperliche Probleme zu besiegen Faszinierend finde ich, dass sie trotz dieser vielen Schicksalsschläge nie ihren Mut und ihre positive Lebenseinstellung verloren hat. Egal wie hart das Leben zuschlägt, sie steht immer wieder auf und bietet dem Schicksal die Stirn – mit großem Erfolg! Christiane findest Du übrigens auf Instagram unter @nitschke_gold oder auf Facebook unter Christiane Nitschke. Ich hoffe, Dich inspiriert diese Episode dazu, auch einmal in den eigenen „Schubladen“ zu schauen, ob es da nicht etwas zu entrümpeln gibt und ob der Ballast im eigenen Keller vielleicht etwas mit Deinen körperlichen Beschwerden oder eingeschränkten Vitalität zu tun hat. Schreib mir gerne in die Kommentare bei Instagram unter @dr.med.dorothea.leinung oder auf dem Blog meiner Website www.dorothealeinung.com, wie Dir diese Episode gefallen hat und was Du für Dich mitnehmen konntest. Auch freue ich mich, wenn Du diesen Podcast bewertest und mir eine kleine Rezension da läßt. Unter allen Rezensenten verlose ich einmal im Monat ein 1:1 Coaching mit mir plus Persönlichkeitspotenzialanalyse. Die Gewinner gebe ich immer am ersten Mittwoch des Monats auf Instagram bekannt. Also, ich freu mich, wenn Du dabei bist und wir uns vielleicht demnächst persönlich sprechen können. Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Zeit, hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer Du grad bist und ich freu mich aufs nächste Mal! Deine Doro Hier findest Du noch einmal alle Links zu Dr. Dorothea Leinung: Website: www.dorothealeinung.com Instagram: @dr.med.dorothea.leinung Unseren Medizin-Info Kanal „Mehrarztfuerdich“ findest Du auf Youtube bzw. unter folgendem Link: https://www.youtube.com/channel/UCNQvL2QlesyxN3O12j4GtLw
Selbstheilungskräfte aktivieren - Interview mit Christiane Nitschke Teil II
Ich begrüße Dich sehr herzlich zum zweiten Teil meines Interviews mit der wunderbaren Christiane Nitschke und freue mich sehr, dass Du dabei bist! In dieser Episode berichtet Christiane uns von zwei schwerwiegenden Kindheitstraumata, wie diese sie nachhaltig geprägt und maßgeblich zur Krankheitsentstehung beigetragen haben. Sie spricht mit mir darüber, wie sehr ihr erst durch die Fibromyalgiefolge auf meinem YouTube Medizinkanal „Mehrarztfuerdich“ klar wurde, welchen starken Einfluß Kindheitserlebnisse auf das Entwickeln einer Fibromyalgie hat und wie sehr dies auch auf sie zutrifft. Außerdem erfährst Du, wie Du mit Deinen eigenen Trauma“bomben“ umgehst und sie gezielt entschärfen kannst wie Christiane es geschafft hat, ihre inneren Konflikte Stück für Stück aufzulösen und so Heilung zu erlangen warum es so wichtig ist, für seine eigenen Rechte zu kämpfen und warum man gerade da nie locker lassen darf warum es so wichtig ist, in den Kern Deiner stärksten Emotionen wie Wut, Trauer und Verzweiflung hineinzugehen, wenn Du wirkliche Heilung willst und wie uns Vergebungsarbeit und Liebe hilft, Frieden mit unserer Vergangenheit zu schließen und uns Heilung zu schenken Nach vielen Jahren schwerer körperlicher Beschwerden und der Einnahme starker Medikamente ist Christiane durch das Beschreiten ihres Heilungsweges jetzt nahezu frei von Medikamenten und deutlich beschwerdegebessert. Sie zeigt Dir duch ihr Beispiel Wege auf, wie auch Du Deine eigenen Selbstheilungskräft aktivieren und Dich von Krankheiten befreien kannst. Christiane findest Du übrigens auf Instagram unter @nitschke_gold oder auf Facebook unter Christiane Nitschke. Ich hoffe, Dich inspiriert diese Episode dazu, auch einmal in den eigenen „Schubladen“ zu schauen, ob es da nicht etwas zu entrümpeln gibt und ob der Ballast im eigenen Keller vielleicht etwas mit Deinen körperlichen Beschwerden oder eingeschränkten Vitalität zu tun hat. Schreib mir gerne in die Kommentare bei Instagram unter @dr.med.dorothea.leinung oder auf dem Blog meiner Website www.dorothealeinung.com, wie Dir diese Episode gefallen hat und was Du für Dich mitnehmen konntest. Auch freue ich mich, wenn Du diesen Podcast bewertest und mir eine kleine Rezension da läßt. Unter allen Rezensenten verlose ich einmal im Monat ein 1:1 Coaching mit mir plus Persönlichkeitspotenzialanalyse. Die Gewinner gebe ich immer am ersten Mittwoch des Monats auf Instagram bekannt. Also, ich freu mich, wenn Du dabei bist und wir uns vielleicht demnächst persönlich sprechen können. Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Zeit, hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer Du grad bist und ich freu mich aufs nächste Mal! Deine Doro Hier findest Du noch einmal alle Links zu Dr. Dorothea Leinung: Website: www.dorothealeinung.com Instagram: @dr.med.dorothea.leinung Unseren Medizin-Info Kanal „Mehrarztfuerdich“ findest Du auf Youtube bzw. unter folgendem Link: https://www.youtube.com/channel/UCNQvL2QlesyxN3O12j4GtLw
Herzlich willkommen zu dieser Episode! Ich freue mich sehr, dass Du dabei bist und Dir die Zeit nimmst, diese Folge anzuhören. Vielen Dank dafür! In dieser Podcastfolge geht es um das große Thema der Angst. Ich spreche darüber, warum Angst eigentlich eine sinnvolle Einrichtung ist, was sie mit unserem Körper macht, wann sie uns krank macht und wie Du sie besiegen kannst. Du erfährst etwas über den Rumpelstilzcheneffekt und was wir aus ihm lernen können. Außerdem teile ich mit Dir, welcher Angsttraum mich jahrelang heimgesucht hat und wie ich ihn mit einem simplen Trick losgeworden bin. Zu guter Letzt spreche ich noch über ein besonderes Tool, dass Du auch mit Deinen Kindern durchführen kannst, wenn sie vielleicht manchmal unter Ängsten leiden. Dieses Tool ist sehr einfach, aber extrem effektiv! Alles in allem erfährst Du also die drei Schritteformel, die ich persönlich anwende, um meine angstreiche Situationen in den Griff zu bekommen. Danke für´s Zuhören! Schreib mir gerne in die Kommentare bei Instagram unter @dr.med.dorothea.leinung oder auf dem Blog meiner Website www.dorothealeinung.com, wie Dir diese Episode gefallen hat und was Du für Dich mitnehmen konntest. Auch freue ich mich, wenn Du diesen Podcast bewertest und mir eine kleine Rezension da läßt. Unter allen Rezensenten verlose ich einmal im Monat ein 1:1 Coaching mit mir plus Persönlichkeitspotenzialanalyse. Die Gewinner gebe ich immer am ersten Mittwoch des Monats auf Instagram bekannt. Also, ich freu mich, wenn Du dabei bist und wir uns vielleicht demnächst persönlich sprechen können. Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Zeit, hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer Du grad bist und ich freu mich aufs nächste Mal! Deine Doro Deine Dorothea PS: Du bist göttlich! Mehr zu Dorothea Leinung: www.dorothealeinung.com Youtubekanal: Mehrarztfürdich Instagram: @dr.med.dorothea.leinung
In dieser belebten und angeschickerten ersten Folge des Podcasts "shot stories" sprechen wir mit dem Dichter Martin Piekar über Rum, Ruhm, Hass, Liebe und Poesie. Unter allen Rezensenten wird bis Ende Mai ein Exemplar seines aktuellen Gedichtbandes "Amok PerVers" verlost. Also bewertet und kommentiert, was das Zeug hält!
- Neue Betas: Das bringen iOS 10.3 und macOS 10.12.4 - Rückkanal: App-Entwickler können künftig Rezensenten im App Store antworten - Zuschriften unserer Hörer Links zur Sendung: - 9to5Mac: Hands-On mit iOS 10.3 beta 1 - https://9to5mac.com/2017/01/24/ios-10-3-beta-1-hands-on-video-find-my-airpods/ - 9to5Mac: App-Entwickler können im App Store antworten - https://9to5mac.com/2017/01/24/apple-will-let-developers-reply-to-reviews-in-the-app-store-soon-for-ios-and-mac-apps/ - MacTechNews: iOS 10.3 erlaubt dynamische App Icons - http://www.mactechnews.de/news/article/iOS-10-3-erlaubt-App-Icons-mit-Statusinformationen-166137.html - Podcasts offline auf der Watch: WatchPlayer - https://itunes.apple.com/de/app/watchplayer/id1170672458?mt=8 - Hörerlink: Mattel baut Alexa für Kinder - http://www.fastcodesign.com/3066881/mattel-is-building-an-alexa-for-kids
405 – Jahresrückblick & erste Ausgabe "Frag Tom"
Inhalt der heutigen Folge: Danke an das Feedback zur Episode 400 und für 15 neue 5-Sterne Rezensionen auf iTunes (alle Rezensenten werden namentlich genannt) Hauptthema: Jahresrückblick 2015: Alles kam anders als es geplant war. Eigentlich wollten wir diesen Sommer nach Alaska und Kanada. Aber wir blieben überwiegend in San Diego/ Kalifornien. Pläne wurden durch „Zufälle“ durchkreuzt. Anfangs haben wir uns geärgert, wenn etwas nicht wie geplant geklappt hat, dann aber haben wir die Zeichen des Universums verstanden und es ist meist immer deutlich besser gekommen. Letztendlich waren wir froh, dass unsere Pläne durchkreuzt waren. Was alles geschehen ist und was wir draus gelernt haben, erfährst Du in dieser Episode. Ebenfalls gibt es die erste Ausgabe von Frag Tom. Martin stellt eine Frage zu seiner bevorstehenden Selbständigkeit und Tom beantwortet diese in dieser Epsiode. Wenn auch Du eine Frage hast, schicke Tom eine Sprachnachricht über unsere Website, und er beantwortet Dir diese in einer der nächsten Episoden. Die letzte und entscheidende Frage zum Jahresende, welche Dich zum Nachdenken anregen soll: Wenn Du Dein Jahr in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Wenn Dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Du uns eine kurze (hoffentlich 5-Sterne-) Rezension schreibst. Danke. Wir freuen uns über Deine Kommentare und Erfahrungen zu diesem Thema im Kommentarfeld unter diesem Podcast, per e-Mail oder auf www.facebook.com/TomsTalkTime Viel Spaß beim Anhören! Dein Tom ;) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mehr Freiheit, mehr Geld und mehr Spaß mit DEINEM eigenen Podcast. Erfahre jetzt, warum es auch für Dich Sinn macht, Deinen eigenen Podcast zu starten. Jetzt hier zum kostenlosen Podcast-Workshop anmelden: Podcastkurs.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
395 - Wenn Du 2 Hasen gleichzeitig jagst...
Late Night Podcasting live vom Cardiff Beach in San Diego/ Kalifornien Die heutige Folge wurde am wunderschönen Cardiff-Beach (Kalifornien) nach Sonnenuntergang aufgenommen. Themen: Danke an neue Rezensenten, welche eine Rezension & Bewertung auf iTunes geschrieben haben. Wir leben am Pazifik und sind zu selten am Strand Hauptthema: Wenn Du 2 Hasen gleichzeitig jagst, fängst Du keinen von beiden In diese Folge rede ich genau über dieses Thema. Und zwar aus aktuellem Anlass. Denn momentan gibt es vier Projekte, die alle umgesetzt werden sollen. Am besten sofort. Und am Besten gleichzeitig. Kennst Du das? Das tückische daran ist, dass man es anfangs gar nicht merkt, was gerade passiert. So war es zumindest bei mir. Es öffneten sich immer mehr Türen und damit auch immer mehr Chancen und interessante Projekte. Von den unzähligen Ideen ganz zu schweigen, die ich zwischendurch schon abweise. Aber diese 4 Projekte sind super spannend und, was mir ganz wichtig ist, mit jedem einzelnen davon kann ich die Welt ein kleines Stück verändern. Ich erzähle Dir, wie ich mit „Multi-Projekten“ umgehe und was für mich gut funktioniert. Ich verrate Dir auch, was in meinen Augen richtige Produktivitäts-Killer und Zeitfresser sind. Ich freue mich auf Deine Kommentare und auf Deine Antwort, wie Du mit solchen Situationen umgehst. Wenn Dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Du uns eine kurze (hoffentlich 5-Sterne-) Rezension schreibst. Danke. Wir freuen uns über Deine Kommentare und Erfahrungen zu diesem Thema im Kommentarfeld unter diesem Podcast, per e-Mail oder auf www.facebook.com/TomsTalkTime Viel Spaß beim Anhören!Tom ;) p.s. Wenn Dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen wenn Du mir auf iTunes eine Bewertung & Rezension, gerne auch mit 5 Sternen ;) hinterlässt. Vielen Dank! p.p.s. Gerne kannst Du mir eine Mail mit einer Deiner Erfolgsgeschichten oder auch einfach einen Themenvorschlag schicken. Ich freue mich immer über Anregungen die von meinen Zuhörern kommen. Anregungen bitte an: Redaktion (at) TomsTalkTime (dot) com
Welt im Ohr lud den Rezensenten zu einer Diskussion mit dem Autor ein, bei der es um grundsätzliche wissenschaftstheoretische Positionen ebenso ging wie um die Frage, welche Arten von Wissenschaftskooperationen die dringlichsten globalen Probleme am ehesten zu lösen helfen.(Auszug aus der Rezension)… Auf seiner philosophisch-literarischen Odyssee auf den Spuren von Geistesgrößen wie Galileo Galilei, Alexander von Humboldt, Charles Darwin oder Ivan Illich und Stephen Hawking geleitet Obrecht seine Leser durch den Kosmos beherrschender Wissenssphären, von Astro- und Kernphysik, Evolutions- und Hirntheorie, Globalisierungs- und Chaosforschung. Ihren Ausgangspunkt nimmt diese Abenteuerreise in den Grenzgebieten unserer modernen Welt, wo trotz Jahrzehnten einer wissenschaftsbasierten Entwicklungspolitik der Erfolg ausbleibt. Hier sterben täglich 20.000 Kinder an schmutzigem Wasser und flüchten 100 Millionen vor Hunger und Krieg. Persönlich konfrontiert mit solch beschämenden Erfahrungen im Rahmen zahlloser Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um den Globus sucht der habilitierte Soziologe nach Antworten, warum es wenigen immer besser gehe, den meisten aber immer schlechter, wofür der "wissende" Westen die wachsenden Probleme wie Klimakollaps, Ozeanvergiftung, Waldvernichtung und Verelendung hinzunehmen scheint.Die Antwort ist für den Autor erschreckend einfach, aber tragisch paradox: Wir machen alles richtig – gemäß unseren Antworten von gestern, während die Probleme längst von morgen sind …Die gesamte Rezension finden Sie hierSendungsverantwortung: Andreas ObrechtSendetermin: Freitag, 11.09.2015, 20:00-21.00 UhrMusik: Retro Stefson-Kimba Live; Salam-Kairo; Tchakare Kanyembe- track_02 Nachzuhören auf Free Music Archive (FMA) eine Community für freie, legale und unlimitierte Musik, die unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht wurde. Publikation: Wozu wissen wollen? Wissen – Herrschaft – Welterfahrung. Ein Beitrag zur Wissensdiskussion aus kultur- und wissenssoziologischer Perspektive 480 Seiten, gebunden mit SU. Wien – Ohlsdorf: Edition Ausblick 2014 ISBN 978-3903798-10-6
23.03.1964: War die Beatlemania daran schuld, dass sich John Lennons Buch "In His Own Write" sofort so großartig verkaufte? Jedenfalls gerieten auch die seriösen Rezensenten ins Schwärmen, als Lennon am 23. März 1964 seine abgefahrene Nonsense-Literatur veröffentlichte.